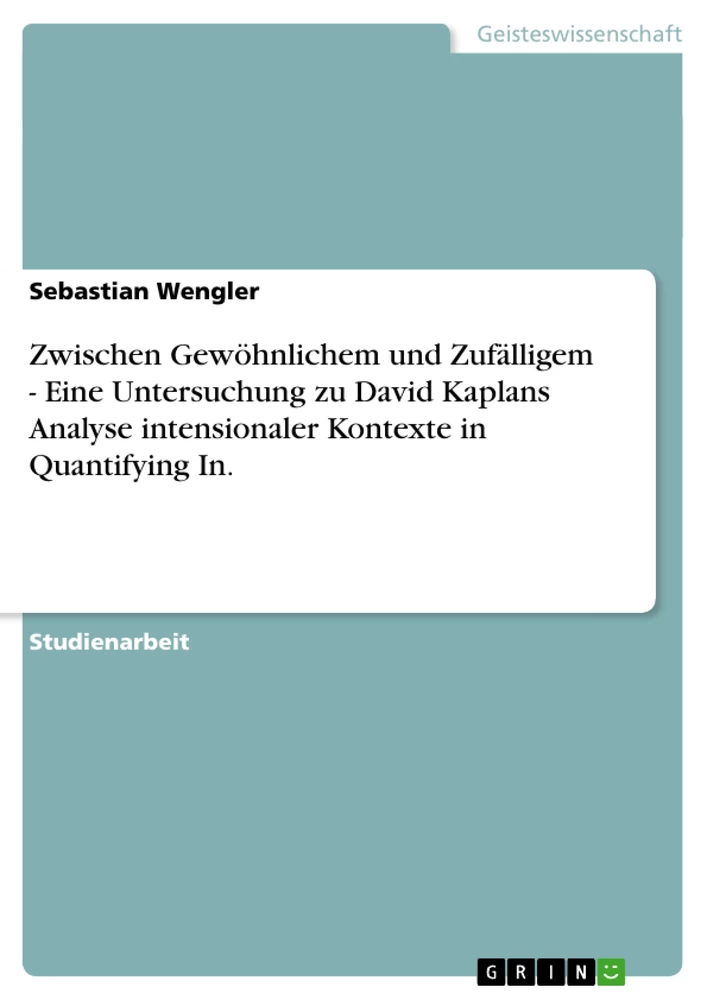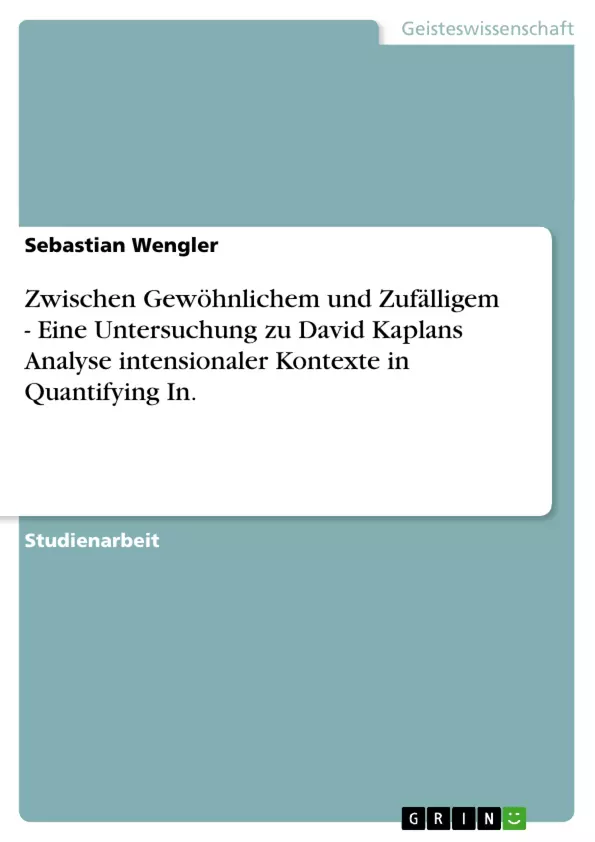In dieser Arbeit widme ich mich einem Problem, das dann entsteht, wenn wir uns fragen, wie eigentlich nicht extensionale natürlichsprachliche Kontexte - nennen wir sie mit einer bestimmten Tradition zunächst einfach intensionale1 Kontexte - zu verstehen sind und d. h. zunächst, wie sie logisch-semantisch analysiert werden sollten. Solche Kontexte begegnen uns ständig, wenn wir z. B. unsere Meinung sagen bzw. uns über Meinungen anderer äußern und damit eine (oder mehrere) bestimmte Überzeugung(en) über einen (oder mehrere) bestimmten Sachverhalt(e) ausdrücken bzw. zusprechen/zuschreiben. Oder wenn wir die gesagten/geschrieben Meinungen anderer Personen (beispielsweise in Zitaten) wiedergeben; wenn wir sagen, dass es morgen möglicherweise Schnee geben wird oder dass wir Beethoven besser als Mozart finden. Der nahe liegenden Frage, ob nicht etwa Fälle des ersten Typs grundlegend sind, da ja jeder uns bekannten sprachlichen Äußerung (sei sie (natur)wissenschaftlicher, umgangssprachlich-alltäglicher oder philosophischer Natur) - so sie aufrichtig, ernst und informativ ist - eine (oder mehrere) Überzeugung(en) in dem Sinne zugrunde liegt/liegen, dass, wenn jemand „Morgen wird es möglicherweise Schnee geben.“ sagt oder diesem Satz zustimmt, auch glauben muss, dass es morgen möglicherweise Schnee geben wird2; diese und mit ihr einhergehende Fragen also werde ich im Folgenden nicht stellen oder zu beantworten versuche. Vielleicht gibt es aber dafür Anknüpfungspunkte.
Vielmehr möchte ich - duplexemplarisch sozusagen - zum einen anhand einer klassischen modernen Position und ihrem kritischen Impetus gegen eine andere klassische moderne Position eine bestimmte Behandlungsweise des eingangs genannten Problems und mit ihm verbundener resp. abgeleiteter Probleme und Fragen darstellen und (zumeist in den Fußnoten) kommentieren. Erstere Position ist die des frühen David Kaplan, wie er sie in seinem Essay Quantifying In aus den Jahren 1968-69 zur Sprache gebracht hat und letztere die Willard Van Orman Quines. Zum anderen werde ich nicht alle Arten solcher nicht extensionaler Kontexte, sondern nur drei sehr wichtige (Anführung, alethische Modalität und Zuschreibungen propositionaler Einstellungen) untersuchen, wie es mir in gewisser Weise von den Texten genannter Autoren vorgegeben ist.[...]
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Quines Ansatz für eine Interpretation intensionaler Kontexte
- 1.1. Undurchsichtigkeit der Bezugnahme
- 1.2. Zwei Lesarten - ein Dilemma
- 2. Kaplans Lösungsversuch des Quantifikationsproblems bei intensionalen Kontexten
- 2.1. Problemstellung und erste Schritte
- 2.1.1. Gewöhnliches, Zufälliges und das Dazwischen
- 2.1.2. Von Frege über Church zur Quantifikation In
- 2.2. Die Geschichte mit dem Spion - eine Fortsetzung
- 2.3 Ein Vorschlag zur Güte - Kaplans Theorie der Namen
- 2.3.1. Von normierten Namen
- 2.3.2. Von lebenden Namen
- 2.1. Problemstellung und erste Schritte
- 3. Resümee und Fazit
- 4. Erwähnte und verwendete Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die logisch-semantische Analyse intensionaler Kontexte in der natürlichsprachlichen Kommunikation. Sie vergleicht und kontrastiert den Ansatz von Willard Van Orman Quine mit dem von David Kaplan, insbesondere dessen Arbeit "Quantifying In". Der Fokus liegt auf der Frage, ob und wie intensionale Kontexte auf extensionale reduziert werden können.
- Analyse intensionaler Kontexte in der natürlichen Sprache
- Vergleich der Ansätze von Quine und Kaplan
- Das Problem der Bezugnahme und Undurchsichtigkeit in intensionalen Kontexten
- Die Reduzierbarkeit intensionaler auf extensionale Kontexte
- Kaplans Theorie der Namen
Zusammenfassung der Kapitel
0. Einleitung: Die Einleitung führt in die Problematik der logisch-semantischen Analyse intensionaler Kontexte ein und skizziert den Forschungsansatz der Arbeit. Sie benennt die zentrale Fragestellung der Reduzierbarkeit intensionaler auf extensionale Kontexte und kündigt den Vergleich der Positionen Quines und Kaplans an. Die Einleitung betont die Relevanz der Untersuchung von Anführung, alethischer Modalität und Zuschreibung propositionaler Einstellungen als exemplarische Fälle für Intensionalität. Der methodische Ansatz der Arbeit wird ebenfalls erläutert.
1. Quines Ansatz für eine Interpretation intensionaler Kontexte: Dieses Kapitel skizziert Quines Kritik an der Behandlung intensionaler Kontexte. Quine argumentiert, dass diese Kontexte in Bezug auf ihre Bezugnahmefunktion undurchsichtig (opak) sind. Er verwendet das Beispiel „Cicero enthält sechs Buchstaben“, um zu zeigen, dass die Wahrheit der Aussage nicht nur vom Referenten des Namens „Cicero“ abhängt, sondern auch von seiner Form. Quines Konzept der Bezugsunerforschlichkeit und Übersetzungsunbestimmtheit wird im Kontext der Analyse intensionaler Kontexte diskutiert, wobei ein möglicher Zusammenhang zu diesen breiteren Thesen angedeutet aber nicht weiter verfolgt wird. Das Kapitel legt somit den analytischen Rahmen für den Vergleich mit Kaplans Ansatz.
2. Kaplans Lösungsversuch des Quantifikationsproblems bei intensionalen Kontexten: Dieses Kapitel präsentiert Kaplans Versuch, das Quantifikationsproblem in intensionalen Kontexten zu lösen. Es beschreibt Kaplans Konzept von "gewöhnlichen", "zufälligen" und den dazwischenliegenden Fällen. Kaplans Theorie der Namen, insbesondere die Unterscheidung zwischen normierten und lebenden Namen, wird detailliert analysiert. Die "Geschichte mit dem Spion" dient als illustratives Beispiel für die Herausforderungen der Quantifikation in intensionalen Kontexten und wie Kaplans Theorie diese adressiert. Dieses Kapitel bietet eine detaillierte Auseinandersetzung mit Kaplans Argumentation und seinen zentralen Begriffen.
Schlüsselwörter
Intensionale Kontexte, Extensionale Kontexte, Quine, Kaplan, Quantifizierung, Bezugnahme, Undurchsichtigkeit, Referenz, Modalität, Propositionale Einstellungen, Namen, Sinn, Bedeutung, Reduktion.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Logisch-semantische Analyse intensionaler Kontexte
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit der logisch-semantischen Analyse intensionaler Kontexte in der natürlichen Sprache. Im Mittelpunkt steht der Vergleich und Kontrast der Ansätze von Willard Van Orman Quine und David Kaplan zur Behandlung dieser Kontexte, insbesondere hinsichtlich der Frage, ob und wie intensionale Kontexte auf extensionale reduziert werden können.
Welche Ansätze werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht den Ansatz von Willard Van Orman Quine mit dem von David Kaplan, speziell dessen Arbeit "Quantifying In". Der Fokus liegt auf der unterschiedlichen Behandlung der Bezugnahme und Undurchsichtigkeit in intensionalen Kontexten.
Was sind intensionale Kontexte?
Intensionale Kontexte sind sprachliche Ausdrücke, in denen die Bedeutung eines Ausdrucks nicht allein durch seinen Referenten (Extension) bestimmt wird, sondern auch durch seinen Sinn (Intension) eine Rolle spielt. Beispiele hierfür sind Anführung, alethische Modalität und Zuschreibung propositionaler Einstellungen.
Welches Problem wird untersucht?
Ein zentrales Problem ist die Reduzierbarkeit intensionaler auf extensionale Kontexte. Die Arbeit untersucht, ob und wie sich die semantische Analyse intensionaler Kontexte auf die einfachere Analyse extensionaler Kontexte zurückführen lässt.
Wie geht Quine mit intensionalen Kontexten um?
Quine kritisiert die Behandlung intensionaler Kontexte und argumentiert, dass diese in Bezug auf ihre Bezugnahmefunktion undurchsichtig (opak) sind. Er zeigt anhand von Beispielen, dass die Wahrheit einer Aussage nicht nur vom Referenten abhängt, sondern auch von der Form des Ausdrucks.
Wie versucht Kaplan das Quantifikationsproblem in intensionalen Kontexten zu lösen?
Kaplan versucht das Quantifikationsproblem in intensionalen Kontexten zu lösen, indem er zwischen "gewöhnlichen", "zufälligen" und dazwischenliegenden Fällen unterscheidet. Seine Theorie der Namen, mit der Unterscheidung zwischen normierten und lebenden Namen, spielt dabei eine zentrale Rolle.
Was ist Kaplans Theorie der Namen?
Kaplans Theorie der Namen unterscheidet zwischen normierten Namen (die immer auf denselben Referenten verweisen) und lebenden Namen (deren Referenz von Kontext abhängen kann). Diese Unterscheidung ist wichtig für seine Lösung des Quantifikationsproblems in intensionalen Kontexten.
Welche Schlüsselbegriffe werden behandelt?
Schlüsselbegriffe sind: Intensionale Kontexte, Extensionale Kontexte, Quine, Kaplan, Quantifizierung, Bezugnahme, Undurchsichtigkeit, Referenz, Modalität, Propositionale Einstellungen, Namen, Sinn, Bedeutung, Reduktion.
Welche Kapitel enthält die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu Quines Ansatz, ein Kapitel zu Kaplans Lösungsversuch, ein Resümee und ein Literaturverzeichnis. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der logisch-semantischen Analyse intensionaler Kontexte.
Wo finde ich mehr Informationen?
Das vollständige Inhaltsverzeichnis, eine detaillierte Zusammenfassung der Kapitel und die Zielsetzung der Arbeit sind im HTML-Dokument enthalten.
- Citation du texte
- Sebastian Wengler (Auteur), 2007, Zwischen Gewöhnlichem und Zufälligem - Eine Untersuchung zu David Kaplans Analyse intensionaler Kontexte in Quantifying In., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88268