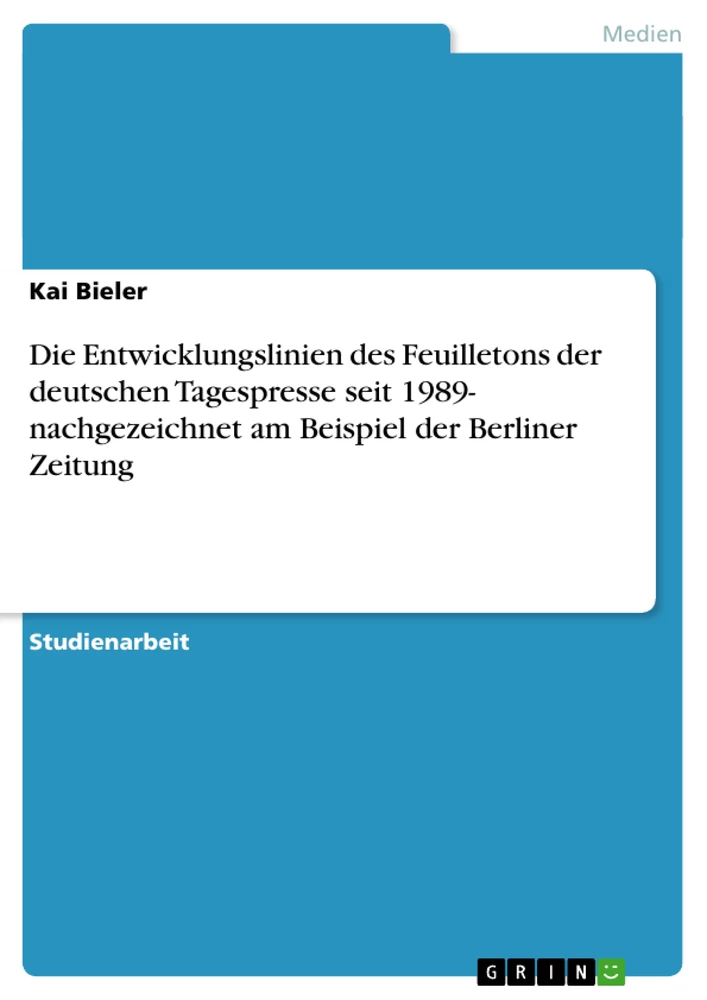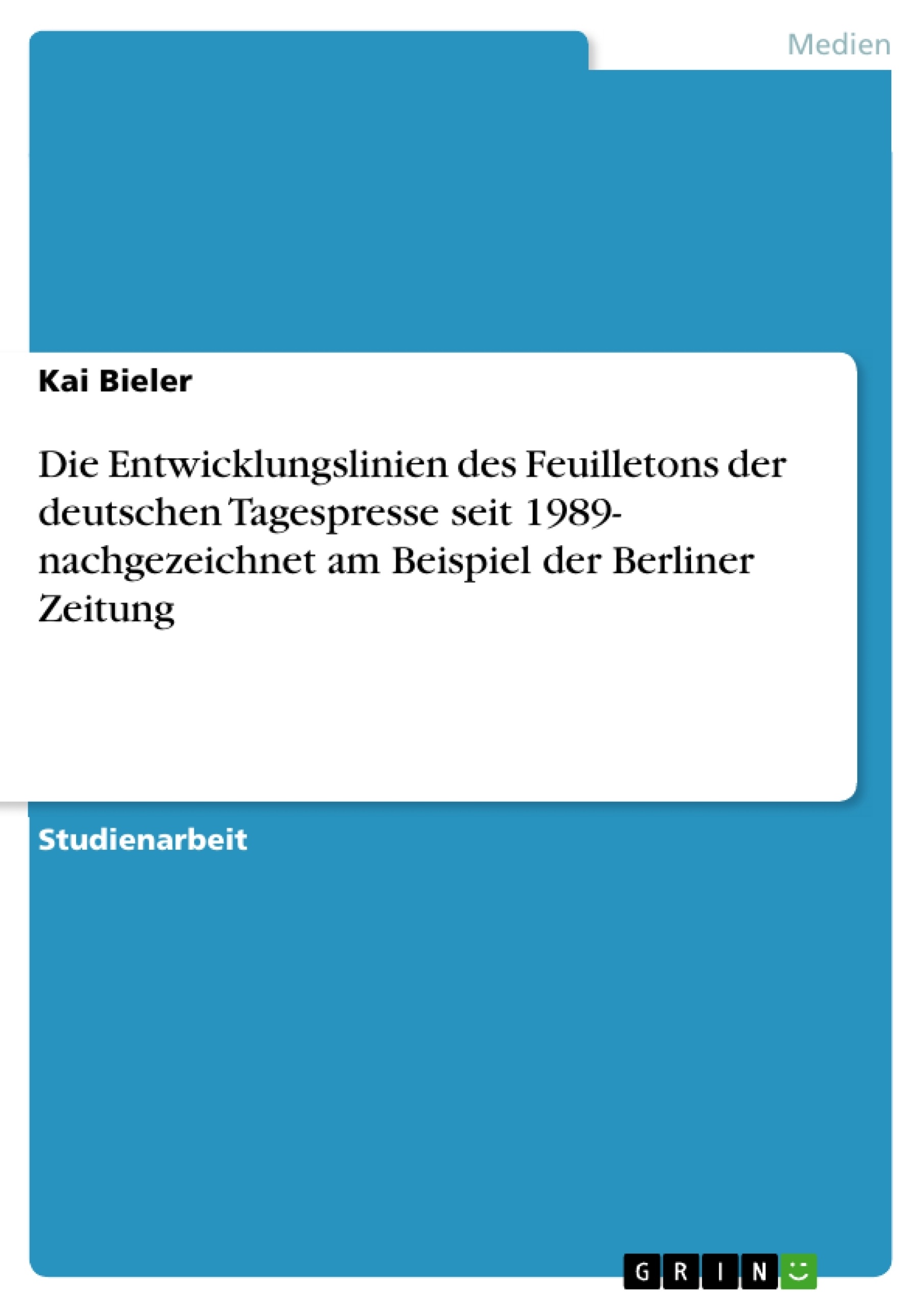Es soll um das Feuilleton gehen. Nicht um das Genre, angesiedelt im Niemandsland der Kategorien zwischen Journalismus und Literatur. Auch nicht um die Stilform, jenes scheinbar an der Oberfläche verbleibende, das die Schwierigkeiten und Komplexität des Daseins dem Leser unterhaltend und anschaulich nahe bringt. Gegenstand der Untersuchung ist das Ressort „Feuilleton“ als „Bezeichnung für den kulturellen Teil der Zeitungen(...)Seiner Zusammensetzung nach enthält es die traditionelle Mischung von kulturellen Nachrichten, Berichten, Kritiken und schöpferischer Unterhaltung.“
Am Beispiel des Feuilletons der regionalen Tageszeitung „Berliner Zeitung“ soll dabei zwei Fragestellungen nachgegangen werden: Erstens, welche Entwicklungslinien kennzeichnen die Kulturseiten der deutschen Tagespresse in den letzten Jahren? Im Mittelpunkt werden hier der Begriff des „politischen Feuilletons“ und der aktuelle Streit um die thematischen Grenzen der Kulturberichterstattung stehen. Und zweitens: Welche Rolle spielt das Feuilleton im speziellen Fall der „Berliner Zeitung“, für deren Entwicklung, verlegerische Zielstellung und Perspektive? Wie zu zeigen sein wird, gibt es zwischen beiden Komplexen verschiedene Parallelen und Schnittpunkte.
Inhaltsverzeichnis
- Um welches Feuilleton geht es?
- Leben mit dem „Lügenblatt“
- Hauptstadtzeitung statt „Washington Post“
- Relaunch
- das Feuilleton wird zum Aushängeschild
- Mit politischen Feuilleton zur Meinungsführerschaft?
- Was kann, was darf das Feuilleton?
- Themenseiten und Beilagen- Ausweg aus dem Dilemma
- Viel Theater auf dem „Rezensionsfriedhof“
- Fazit und Ausblick auf den „Ort der Utopie“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Feuilleton der Berliner Zeitung seit 1989. Die Hauptziele sind die Analyse der Entwicklungslinien des Feuilletons in der deutschen Tagespresse und die Rolle des Feuilletons innerhalb der Berliner Zeitung hinsichtlich deren Entwicklung, verlegerischer Zielsetzung und Perspektive. Die Arbeit beleuchtet die Parallelen und Schnittpunkte zwischen beiden Aspekten.
- Entwicklung des Feuilletons in der deutschen Tagespresse seit 1989
- Das „politische Feuilleton“ und seine thematischen Grenzen
- Die Rolle des Feuilletons in der Berliner Zeitung
- Der Einfluss der politischen Lage auf das Feuilleton
- Der Wandel der Berliner Zeitung nach der Wende
Zusammenfassung der Kapitel
Um welches Feuilleton geht es?: Der einführende Abschnitt klärt die Zielsetzung der Arbeit. Es geht nicht um das Feuilleton als Genre oder Stilform, sondern um das Ressort „Feuilleton“ als kultureller Teil von Zeitungen. Die Arbeit konzentriert sich auf die Entwicklung des Feuilletons der Berliner Zeitung seit 1989, untersucht dessen Entwicklungslinien innerhalb der deutschen Tagespresse und dessen Rolle innerhalb der Zeitung selbst. Die Verbindung zwischen beiden Aspekten wird als zentrales Thema herausgestellt.
Leben mit dem „Lügenblatt“: Dieses Kapitel zeichnet ein Porträt der Berliner Zeitung von ihrer Gründung 1945 bis zur Wende 1989 nach. Es beschreibt die Zeitung als älteste deutsche Zeitung der Nachkriegszeit und beleuchtet ihren Weg unter sowjetischer und später SED-Kontrolle. Der Text beschreibt die Zensur und den Einfluss der SED auf die Berichterstattung, illustriert am Beispiel der Berichterstattung über die Leipziger Messe 1988. Trotz der staatlichen Einflussnahme wird darauf hingewiesen, dass auch differenzierte Berichterstattung und subtile Kritik vorhanden waren, die von den Lesern interpretiert werden mussten.
Hauptstadtzeitung statt „Washington Post“: Dieses Kapitel beschreibt die Herausforderungen der Berliner Zeitung nach der Wende. Es behandelt den Führungswechsel, die Stasi-Enthüllungen und die gesellschaftlichen Konflikte der Übergangszeit. Der Verkauf des Berliner Verlags an verschiedene Verlage, beginnend mit Robert Maxwell und später Gruner + Jahr, wird detailliert dargestellt. Der Versuch, die Zeitung zu einer liberalen, überregionalen Zeitung im Stil der „Washington Post“ umzugestalten, wird analysiert und kritisch betrachtet, indem der Kommentar von Jens Reich über die Diskrepanz zwischen Anspruch und Realität in den 1990er Jahren zitiert wird.
Schlüsselwörter
Berliner Zeitung, Feuilleton, deutsche Tagespresse, politische Wende 1989, SED, Zensur, Medienlandschaft, Entwicklungslinien, Kulturberichterstattung, politisches Feuilleton, Überregionalität, Verlegerische Zielstellung.
Häufig gestellte Fragen: Analyse des Feuilletons der Berliner Zeitung seit 1989
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das Feuilleton der Berliner Zeitung seit 1989. Der Fokus liegt nicht auf dem Feuilleton als Genre, sondern auf dem Ressort „Feuilleton“ als kultureller Bestandteil der Zeitung. Die Untersuchung beleuchtet dessen Entwicklung innerhalb der deutschen Tagespresse und dessen Rolle innerhalb der Berliner Zeitung selbst, sowie die Verbindung zwischen diesen beiden Aspekten.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die Entwicklungslinien des Feuilletons in der deutschen Tagespresse seit 1989, die Rolle des „politischen Feuilletons“ und dessen thematische Grenzen, den Einfluss der politischen Lage auf das Feuilleton, den Wandel der Berliner Zeitung nach der Wende und die Rolle des Feuilletons innerhalb der Zeitung hinsichtlich deren Entwicklung, verlegerischer Zielsetzung und Perspektive.
Wie wird die Entwicklung des Feuilletons der Berliner Zeitung vor 1989 dargestellt?
Das Kapitel „Leben mit dem ‚Lügenblatt‘“ beschreibt die Berliner Zeitung von ihrer Gründung 1945 bis zur Wende 1989. Es beleuchtet die Zeit unter sowjetischer und SED-Kontrolle, die Zensur und den Einfluss der SED auf die Berichterstattung, zeigt aber auch subtile Kritik und differenzierte Berichterstattung auf, die von den Lesern interpretiert werden musste. Die Leipziger Messe 1988 dient als Beispiel.
Wie beschreibt die Arbeit die Situation nach der Wende 1989?
Das Kapitel „Hauptstadtzeitung statt ‚Washington Post‘“ behandelt die Herausforderungen nach der Wende: Führungswechsel, Stasi-Enthüllungen, gesellschaftliche Konflikte und den Verkauf des Berliner Verlags. Der Versuch, die Zeitung zu einer liberalen, überregionalen Zeitung umzugestalten, wird analysiert und kritisch betrachtet, unter anderem durch die Zitierung eines Kommentars von Jens Reich.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu folgenden Themen: Einführung (Zielsetzung), „Leben mit dem ‚Lügenblatt‘“ (Berliner Zeitung vor der Wende), „Hauptstadtzeitung statt ‚Washington Post‘“ (Berliner Zeitung nach der Wende), weitere Kapitel analysieren den Relaunch des Feuilletons, dessen Rolle als Aushängeschild, die Möglichkeiten und Grenzen des politischen Feuilletons, den Einsatz von Themenseiten und Beilagen, die Rezensionslandschaft und einen Ausblick.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Berliner Zeitung, Feuilleton, deutsche Tagespresse, politische Wende 1989, SED, Zensur, Medienlandschaft, Entwicklungslinien, Kulturberichterstattung, politisches Feuilleton, Überregionalität, Verlegerische Zielstellung.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Entwicklungslinien des Feuilletons in der deutschen Tagespresse zu analysieren und die Rolle des Feuilletons innerhalb der Berliner Zeitung hinsichtlich deren Entwicklung, verlegerischer Zielsetzung und Perspektive zu untersuchen. Die Parallelen und Schnittpunkte zwischen beiden Aspekten werden beleuchtet.
- Citar trabajo
- Kai Bieler (Autor), 2001, Die Entwicklungslinien des Feuilletons der deutschen Tagespresse seit 1989- nachgezeichnet am Beispiel der Berliner Zeitung , Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/8828