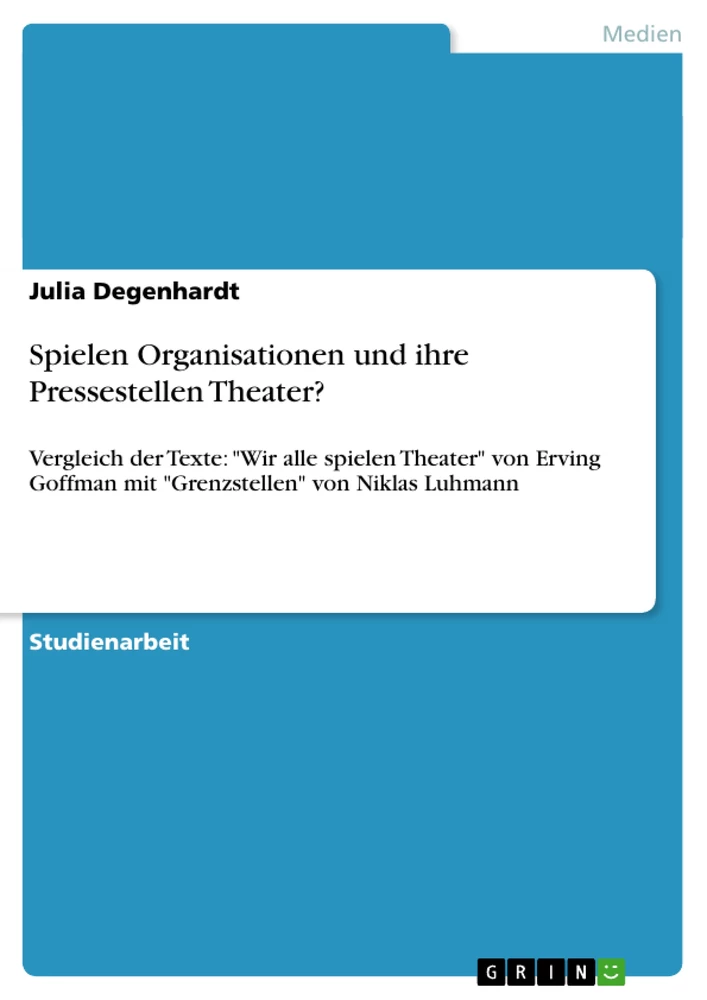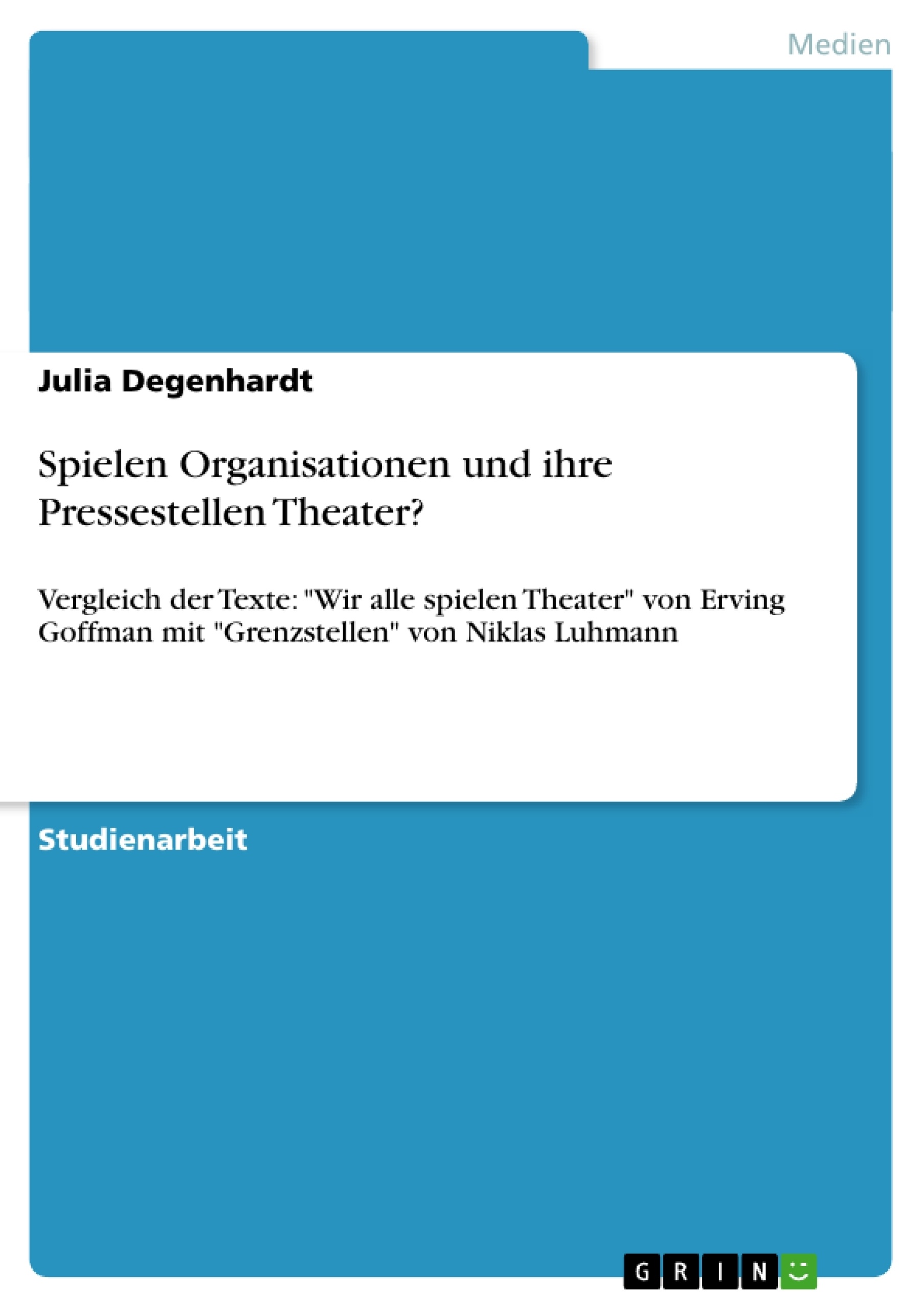Sobald man eine soziale Interaktion mit einer fremden (anderen) Person beginnt, stellt man an sich selbst fest, dass man im Normalfall von Anfang an versuchen wird, bei der anderen Person gut anzukommen bzw. einen guten Eindruck zu machen. Man will heraus-bekommen, was der andere über einen denkt bzw. von einem hält. Wenn man etwas möchte wird man sich auf eine bestimmte Art und Weise dem anderen gegenüber verhalten, um die gewünschte Reaktion zu erzielen. Natürlich versucht man, soviel wie Mögliche über sein Gegenüber zu erfahren. Dem sind jedoch Grenzen gesetzt, da der andere nie alles über sich preisgeben wird.
Am Anfang einer Interaktion versucht jeder sich in einer eigenen Art und Weise darzustellen. Diese Darstellungen unterscheiden sich dahingehend, ob es sich um Fremde oder Freunde handelt. Darüber hinaus wird man versuchen, die Darstellungsweise des anderen darauf abzutasten, ob es versteckte Hinweise gibt, die die Persönlichkeit des Gegenübers zu definieren erlauben und ob es Hinweise auf die Richtigkeit der Aussage des anderen gibt. Diese Überprüfung ist jedoch ein schwieriges Unterfangen. Häufig verwendet man kleine Hilfsmittel an. Bspw. beobachtet man genau die Gestik und Mimik der anderen Person, da dies oft unbewusste Handlungen sind, die helfen können eine Person und deren Charakter zu erkennen.
Organisationen agieren in gleicher Weise. Sie müssen mit ihrer Umwelt, dies können andere Organisationen, die Öffentlichkeit oder die Medien sein, in Kontakt treten und die Kommunikation als einen Dialog aufrechterhalten. Auch sie nehmen auf dem Wettbewerbsmarkt eine bestimmte Rolle ein und definieren was sie sind bzw. was sie sein wollen. In Erving Goffmans Theorie ist das Theater ein Modell der sozialen Welt. Alle Menschen spielen in sozialen Interaktionen Theater und setzten dazu verschiedene Fassaden auf. Niklas Luhmanns definiert in seinem Text „Grenzstellen“ die Verbindungsstelle zwischen einem System und seiner Umwelt sowie seine Aufgaben und Funktionen. Hier stellen sich die Fragen, ob dies auch auf Organisationen bzw. auf die Grenzstellen angewendet werden kann. Spielen Organisationen und ihre Pressestellen ebenfalls Theater? Setzten sie sich auch auf eine bestimmte Art und Weise in Szene? Versuchen sie ihr Gegenüber zu beeinflussen? Gibt es bei ihnen eine Vorder- und eine Hinterbühne?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Texterläuterungen
- „Wir alle spielen Theater“ von Erving Goffman
- „Grenzstellen“ nach Niklas Luhmann
- Grenzstellendefinition angewendet auf Organisationen
- Public Relations als Grenzstelle von Organisationen
- Vergleich der beiden Texte
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text analysiert die Verbindung von Goffmans „Wir alle spielen Theater“ mit Luhmanns „Grenzstellen“ und untersucht, ob Organisationen und ihre Pressestellen Theater spielen. Das Ziel ist es, die Theorien der beiden Autoren auf die Praxis von Organisationen anzuwenden und herauszufinden, ob die Konzepte der Selbstdarstellung und der Grenzstellen im Kontext von Organisationen und ihrer Kommunikation relevant sind.
- Das Konzept der Selbstdarstellung im Alltag nach Goffman
- Luhmanns Theorie der Grenzstellen und deren Anwendung auf Organisationen
- Die Rolle der Public Relations als Grenzstelle
- Der Vergleich von Goffmans und Luhmanns Theorien
- Die Frage, ob Organisationen Theater spielen und ihre Pressestellen als „Vorderbühne“ fungieren
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die zentrale Frage nach der Rolle des Theaters in der Kommunikation von Organisationen und ihren Pressestellen. Sie führt das Konzept der Selbstdarstellung in sozialen Interaktionen ein und erläutert, wie Individuen versuchen, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Die Einleitung stellt die Verbindung zu Organisationen her und zeigt, wie diese ebenfalls im Wettbewerb um Aufmerksamkeit und Ressourcen mit ihrer Umwelt kommunizieren.
Texterläuterungen
„Wir alle spielen Theater“ von Erving Goffman
Dieser Abschnitt erklärt Goffmans Theorie der Selbstdarstellung, die er mit einer Theaterbühne vergleicht. Goffman analysiert, wie Personen in sozialen Interaktionen verschiedene Rollen spielen und ihre Persönlichkeit je nach Kontext anpassen. Er beschreibt die Unterscheidung zwischen Vorder- und Hinterbühne und die Regeln, die das soziale Spiel beherrschen.
„Grenzstellen“ nach Niklas Luhmann
Dieser Teil beschreibt Luhmanns Theorie der Grenzstellen. Luhmann definiert Grenzstellen als die Verbindung zwischen einem System und seiner Umwelt. Dieser Abschnitt erläutert, wie die Grenzstellen die Kommunikation zwischen dem System und der Umwelt ermöglichen und gleichzeitig die Identität des Systems bewahren.
Vergleich der beiden Texte
Dieser Abschnitt vergleicht Goffmans Theorie der Selbstdarstellung mit Luhmanns Theorie der Grenzstellen. Er untersucht, ob und wie sich die Konzepte der beiden Autoren auf die Kommunikation von Organisationen anwenden lassen. Der Vergleich analysiert, ob Organisationen als „Theaterbühnen“ fungieren und ihre Pressestellen als „Vorderbühne“ dienen, um einen bestimmten Eindruck auf die Öffentlichkeit zu vermitteln.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Textes sind: Selbstdarstellung, Theater, Vorderbühne, Hinterbühne, Grenzstelle, Organisation, Public Relations, Kommunikation, Umwelt, System, Interaktion, Goffman, Luhmann.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Erving Goffmans Konzept „Wir alle spielen Theater“?
Goffman vergleicht soziale Interaktionen mit einer Theateraufführung. Menschen schlüpfen in Rollen und nutzen „Fassaden“, um bei ihrem Gegenüber einen bestimmten Eindruck zu hinterlassen.
Was sind „Grenzstellen“ nach Niklas Luhmann?
Grenzstellen sind die Verbindungsglieder zwischen einem System (z. B. einer Organisation) und seiner Umwelt. Sie steuern den Informationsaustausch und schützen gleichzeitig die Identität des Systems.
Spielen Organisationen tatsächlich Theater?
Ja, im übertragenen Sinne. Organisationen inszenieren sich gegenüber der Öffentlichkeit und den Medien, um ihr Image zu pflegen und Vertrauen aufzubauen, was Goffmans Vorderbühne entspricht.
Welche Rolle spielt die Pressestelle in diesem Vergleich?
Die Pressestelle fungiert als „Vorderbühne“ der Organisation. Sie ist die Grenzstelle, die gezielt Informationen filtert und aufbereitet, um die Wahrnehmung in der Umwelt zu beeinflussen.
Was ist der Unterschied zwischen Vorderbühne und Hinterbühne?
Die Vorderbühne ist der Ort der offiziellen Darstellung vor Publikum. Auf der Hinterbühne (intern) können sich Akteure von ihrer Rolle erholen und Dinge besprechen, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind.
- Citar trabajo
- Julia Degenhardt (Autor), 2006, Spielen Organisationen und ihre Pressestellen Theater?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88349