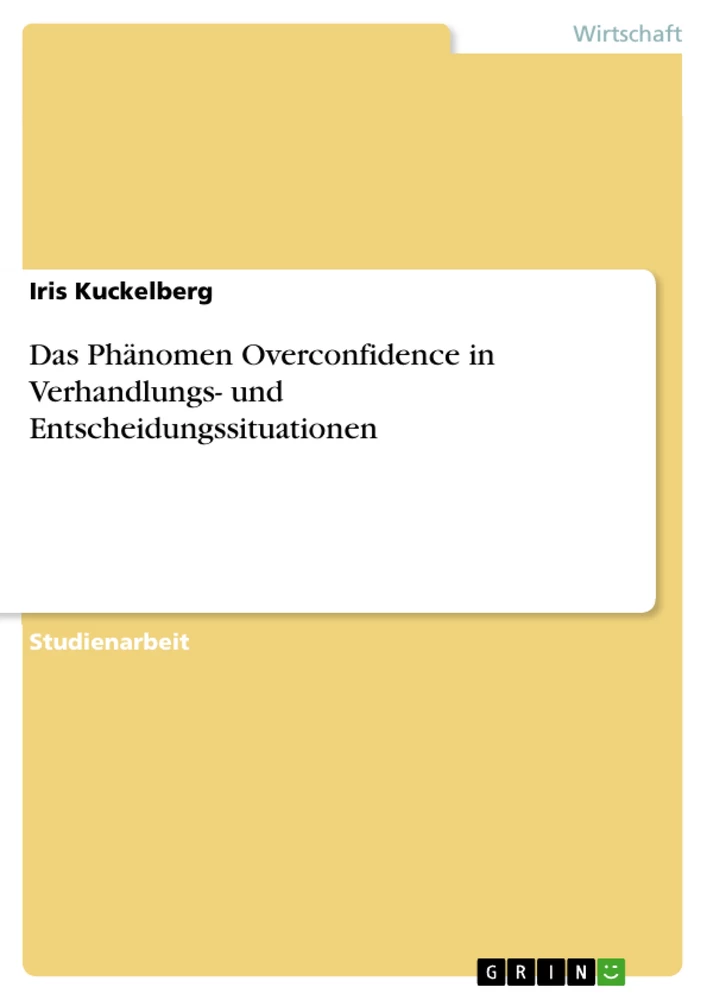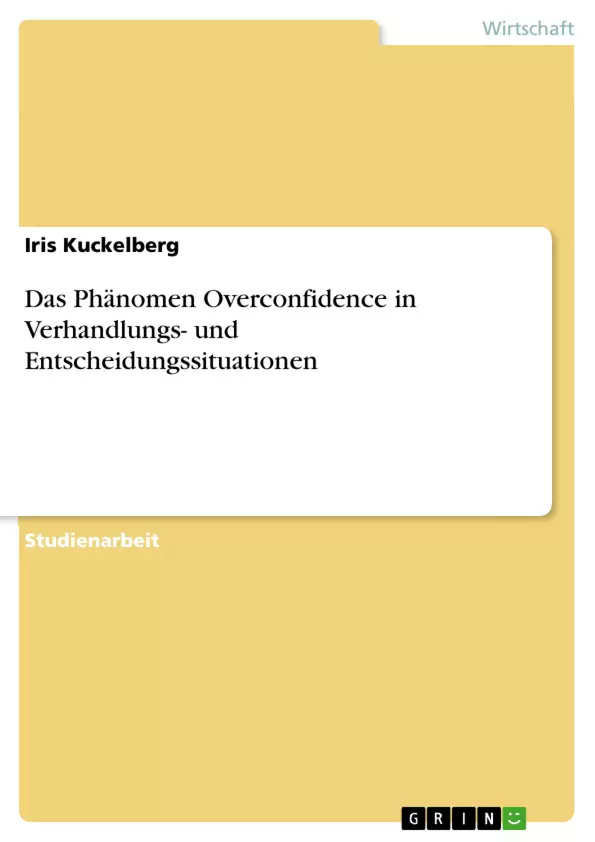„Fünfzig Prozent der Wirtschaft sind Psychologie. Wirtschaft ist eine Veranstaltung von Menschen, nicht von Computern“ sagte Alfred Herrhausen (1930-89), deutscher Bankier und Vorstandssprecher der Deutschen Bank und erkannte somit die Relevanz psychologischer Prozesse und Phänomene, die jeden Menschen in seinem Handeln beeinflussen.
Als Grundlage der neoklassischen Wirtschaftstheorie dient die Annahme des homo oeconomicus. Die Idealvorstellung geht von einem unbegrenzten Arbeitsspeicher und einer unendlich hohen Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung aus. Zur Findung von rationalen Entscheidungen definiert der homo oeconomicus seine Ziele und hierarchisiert diese. Er bestimmt die Wahrscheinlichkeit, dass bestimmte Alternativen zum Erreichen dieser Ziele führen. Nach elaborierten mathematischen Entscheidungsregeln wählt der homo oeconomicus die Alternative mit dem höchsten Erwartungswert aus. Die Theorie besagt demnach, dass z.B. Investoren, Manager, Analysten ihre Entscheidungen unter vollkommener Rationalität treffen.
Doch wie sieht es in der Realität aus, in unserem Alltag der beherrscht ist von einer Informationsflut, dem Bedürfnis als leistungsfähiger und kompetenter Mensch zu erscheinen und der Notwendigkeit schnell Entscheidungen zu treffen, aber ohne die Zeit zu haben alle Möglichkeiten mathematisch auszurechnen?
Diese Arbeit versucht einen Einblick zu geben, wie es aufgrund des psychologischen Phänomens des Overconfidence Bias im menschlichen Alltagsleben zu Fehlentscheidungen, sowie im Finanzmarkt zu Börsencrashs, extremen Auf- und Abschwüngen und Spekulationsblasen führen kann. Der Finanzmarkt spiegelt menschliche Hoffnungen und Ängste wieder und zeigt somit, dass auch die Psychologie neben den klassischen ökonomischen Modellen und Theorien eine entscheidende Rolle übernimmt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- GRUNDLAGEN
- Rational ist Irrational - Wie die Psychologie die Ökonomie beeinflusst
- Overconfidence - Was bedeutet das konkret?
- Messung der Overconfidence
- URSACHEN DES OVERCONFIDENCE PHÄNOMENS
- Motivationale Ursachen und Anwendung
- Kognitive Ursachen und Anwendung
- Overconfidence und externe Einflüsse
- Behavioral Finance und Overconfidence
- ZUSAMMENFASSENDE ERKENNTNISSE
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Phänomen der Overconfidence in Verhandlungs- und Entscheidungssituationen. Die Arbeit untersucht die Ursachen und Folgen von Überkonfidenz und beleuchtet, wie dieses psychologische Phänomen die Ökonomie, insbesondere den Finanzmarkt, beeinflusst.
- Das Konzept der Overconfidence und seine Auswirkungen auf die Entscheidungsfindung
- Die Relevanz psychologischer Prozesse für ökonomische Modelle
- Untersuchung der Ursachen von Overconfidence, sowohl motivationaler als auch kognitiver Art
- Die Rolle von Overconfidence in der Behavioral Finance und seine Auswirkungen auf den Finanzmarkt
- Kritik an der Annahme des homo oeconomicus und die Bedeutung der "Bounded Rationality"
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Relevanz psychologischer Prozesse für die Ökonomie dar und beleuchtet die Annahme des homo oeconomicus im Kontext der neoklassischen Wirtschaftstheorie. Es wird die Diskrepanz zwischen theoretischer Rationalität und der realen Entscheidungsfindung im menschlichen Alltag aufgezeigt.
GRUNDLAGEN
Rational ist Irrational- Wie die Psychologie die Ökonomie beeinflusst
Dieser Abschnitt definiert den Begriff der Rationalität und zeigt auf, dass diese subjektiv und von individuellen Präferenzen beeinflusst ist. Es werden Kriterien für Rationalität erörtert und das Konzept der "Bounded Rationality" eingeführt, das die Begrenztheit menschlichen Entscheidungsverhaltens berücksichtigt.
Overconfidence - Was bedeutet das konkret?
Der Abschnitt erklärt, was Overconfidence bedeutet und in welchen Formen es sich manifestieren kann. Es werden verschiedene empirische Studien erwähnt, die die Auswirkungen von Overconfidence auf das menschliche Verhalten untersuchen, z.B. den "better than average effect" und die "Illusion of Control".
Messung der Overconfidence
Dieser Abschnitt beschreibt verschiedene Methoden zur Messung von Overconfidence, einschließlich der Analyse von Konfidenzintervallen und der Kalibrierung von Wahrscheinlichkeitseinschätzungen.
URSACHEN DES OVERCONFIDENCE PHÄNOMENS
Motivationale Ursachen und Anwendung
Dieser Abschnitt behandelt die motivationalen Ursachen von Overconfidence, z.B. das Bedürfnis nach Selbstbestätigung und der Wunsch nach sozialer Anerkennung.
Kognitive Ursachen und Anwendung
Dieser Abschnitt erklärt die kognitiven Ursachen von Overconfidence, z.B. selektive Informationsverarbeitung, Erinnerungsverzerrungen und das "availability bias".
Overconfidence und externe Einflüsse
Dieser Abschnitt untersucht, wie externe Faktoren wie Gruppendruck, soziale Normen und die Medien das Auftreten von Overconfidence beeinflussen können.
Behavioral Finance und Overconfidence
Dieser Abschnitt beschreibt die Rolle von Overconfidence in der Behavioral Finance und wie es zu Marktineffizienzen, Börsencrashs und Spekulationsblasen führen kann.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Seminararbeit sind: Overconfidence, Rationalität, "Bounded Rationality", homo oeconomicus, Behavioral Finance, Entscheidungstheorie, Psychologie, Finanzmarkt, Informationsverarbeitung, kognitiv, motivational, Bias, Marktineffizienzen, Spekulationsblasen.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem Phänomen Overconfidence?
Overconfidence (Überkonfidenz) beschreibt die psychologische Tendenz von Menschen, ihre eigenen Fähigkeiten, ihr Wissen und ihre Vorhersagegenauigkeit systematisch zu überschätzen.
Wie beeinflusst Overconfidence den Finanzmarkt?
Sie kann zu exzessivem Handel, Marktineffizienzen, Spekulationsblasen und letztlich zu Börsencrashs führen, da Investoren Risiken unterschätzen und ihren Informationen zu sehr vertrauen.
Was ist der Unterschied zwischen dem „Homo oeconomicus“ und der Realität?
Der „Homo oeconomicus“ entscheidet rein rational und mathematisch. In der Realität sind Menschen durch begrenzte Informationsverarbeitung (Bounded Rationality) und psychologische Biases beeinflusst.
Was sind motivationale Ursachen für Overconfidence?
Dazu zählen das Bedürfnis nach einem positiven Selbstbild, der Wunsch nach sozialer Anerkennung und das Gefühl von Kontrolle über eigentlich zufällige Ereignisse (Illusion of Control).
Was bedeutet „Better-than-average-Effekt“?
Dies ist eine Form der Overconfidence, bei der die Mehrheit der Menschen glaubt, in bestimmten Bereichen (z. B. Autofahren) besser zu sein als der Durchschnitt, was statistisch unmöglich ist.
Wie wird Overconfidence gemessen?
Häufig durch Kalibrierungstests, bei denen Probanden ihr Wissen schätzen und ein Konfidenzintervall angeben müssen. Liegt die tatsächliche Trefferquote unter der geschätzten Sicherheit, liegt Overconfidence vor.
- Quote paper
- Iris Kuckelberg (Author), 2007, Das Phänomen Overconfidence in Verhandlungs- und Entscheidungssituationen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88412