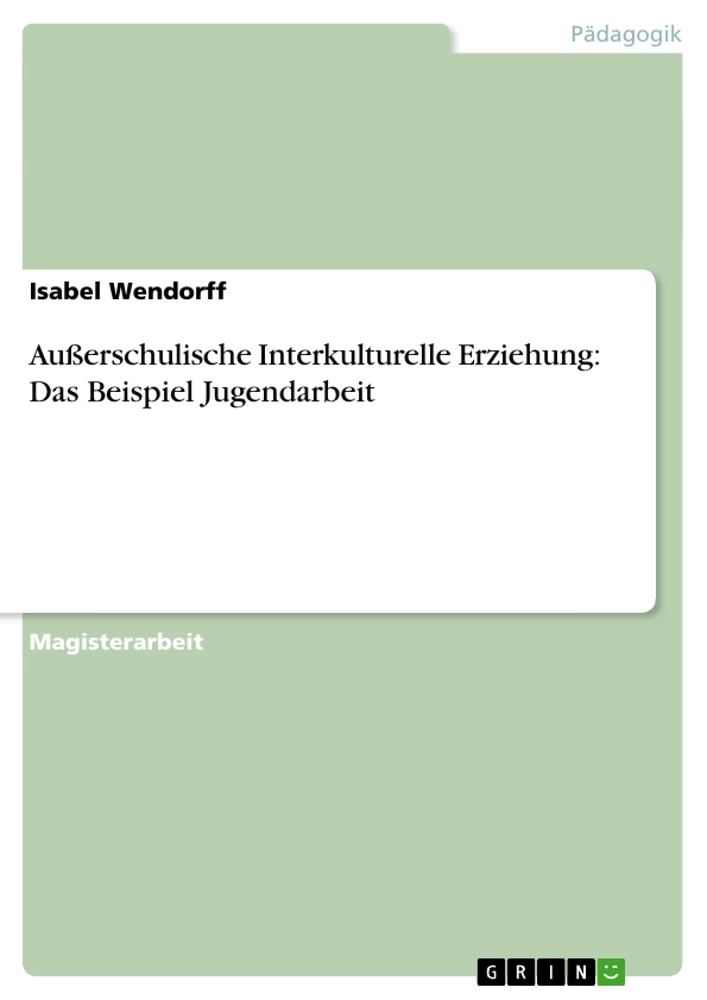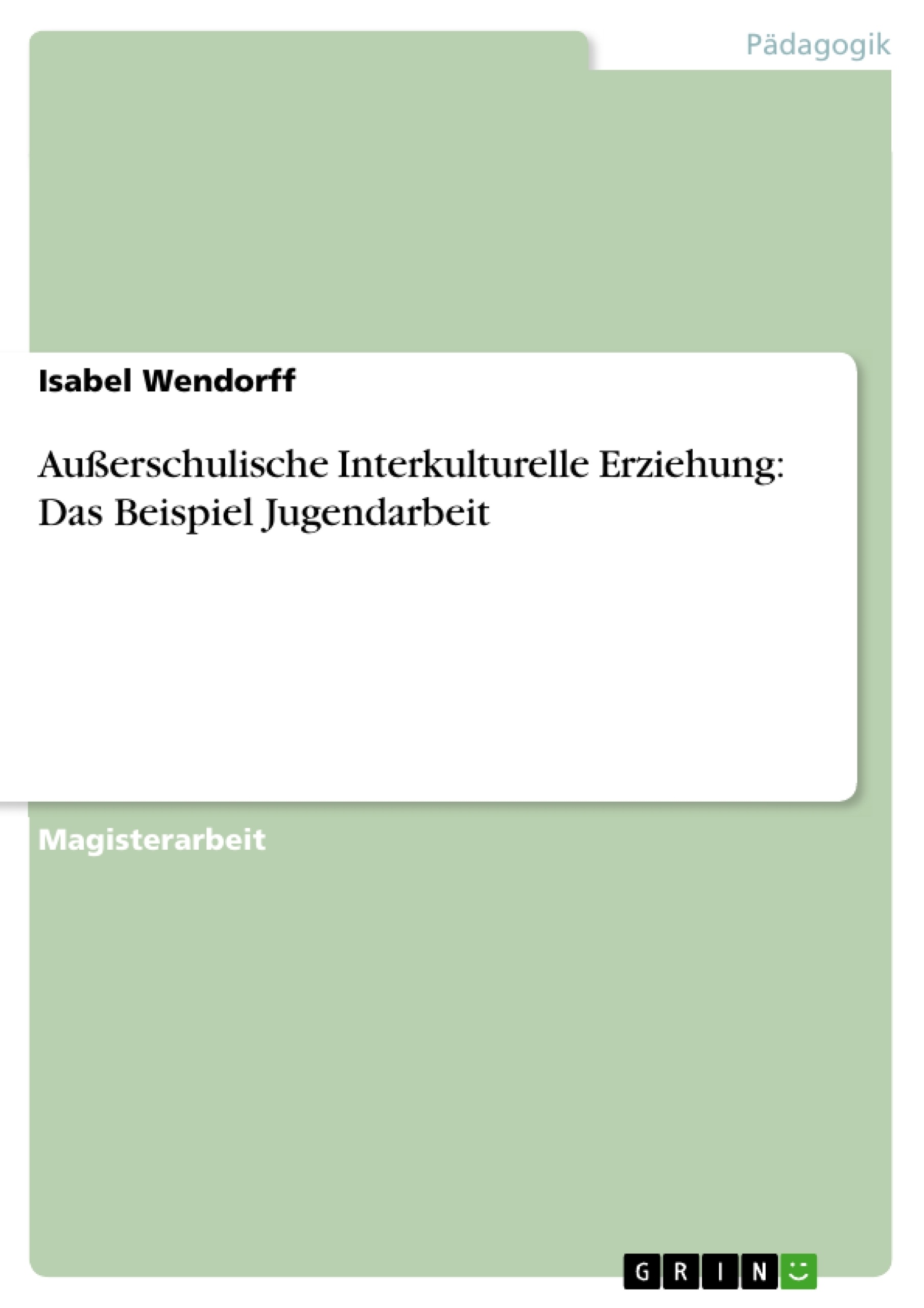Die Diskussion um die multikulturelle Gesellschaft ist nichts neues. Gerade in den letzten Monaten flammte sie, nicht zuletzt durch die Aktualität des Wahlkampfes, erneut auf.
Die Arbeitsmigranten, die in den 1950er Jahren angeworben wurden, haben sich im Zuge der Familienzusammenführung zu einem beständigen Teil der Gesellschaft entwickelt. Mit andauernder Aufenthaltesdauer der zunächst als ′Gäste′ angesehenen Migranten, stieg auch die Zahl der nachgezogenen oder hier geborenen Kinder.
Dadurch war ein ganz neues Problemfeld entstanden:
Zwar hatten diese Kinder ebenfalls den Status ′Gast′, bzw. ′Ausländer′, jedoch wuchsen sie nicht in ihrer sogenannten ′Heimat′ auf; viele kennen diese nur aus Urlaubsaufenthalten. Der Lebensmittelpunkt dieser Kinder war und ist Deutschland. Einerseits leben sie in einer Familie, die häufig noch stark von der Kultur des Herkunftslandes geprägt ist, andererseits nimmt die soziale Umwelt des Aufnahmelandes entscheidenden Einfluss auf ihr Leben. So entstand die Problematik, auf der das Thema dieser Arbeit basiert, und die häufig als ′Kulturkonflikt′ bezeichnet wird.
Gerade in urbanen Gesellschaften stoßen Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen und Lebenseinstellungen aufeinander. Diese so entstehende multikulturelle Gesellschaft ist jedoch nur existenzfähig, wenn alle Menschen, sowohl ′Ausländer′ als auch ′Einheimische′ mit diesen Differenzen konstruktiv umzugehen wissen.
Zunächst reagierte die Gesellschaft auf diesen ′Konflikt′ mit Fördermaßnahmen für ausländische Kinder, die sich allerdings auf die Behebung von Sprachdefiziten in der Schule beschränkte. Jedoch stellte sich bald heraus, dass diese Strategie nicht den gewünschten Erfolg brachte, und allenfalls einen Teilaspekt der Problematik behandelte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Alltagsleben und Problemfelder ausländischer Jugendlicher
- Politische und rechtliche Situation
- Wohnsituation
- Strukturdaten zur ausländischen Wohnbevölkerung
- Folgen schlechter Wohnverhältnisse
- Freizeitgestaltung
- Allgemeine Beobachtungen zum Freizeitverhalten
- Einfluss der Medien
- Zur 'Ausländerkriminalität'
- Religion
- Grundzüge des Islam
- Zur Rollenverteilung und Familienstruktur in islamischen Familien
- Erziehungsideale in traditionellen türkischen Familien
- Schule und Bildung
- Problemfeld Schule
- Situation auf dem Arbeitsmarkt
- Zum 'Identitätskonflikt' ausländischer Jugendlicher
- Identitätskonzepte
- E. Erikson
- G.H. Mead
- Krappmann
- Rolle der familiären Sozialisation
- Sekundäre Sozialisation
- Zum 'Kulturkonflikt'
- Identitätskonzepte
- Zusammenfassung
- Kultur und Ethnizität als soziale Kategorie
- Der Kulturbegriff
- Umgang mit Fremdheit
- Begriffliche Abgrenzungen
- Soziale Bedingungen zur Konstruktion von Fremdbildern
- Zur sozialen Funktion von Fremdbildern
- Schlussfolgerungen: Anforderungen an eine Interkulturelle Pädagogik
- Interkulturelle Erziehung
- Geschichte und Entwicklung
- Kritik an der interkulturellen Pädagogik
- Integration als Ziel Interkultureller Erziehung
- Erziehungsziel Interkulturelle Kompetenz
- Zur Begriffsbestimmung Interkulturelle Kompetenz
- Interkulturelle Kompetenz in pädagogischen Handlungsfeldern
- Förderung Interkultureller Kompetenz
- Antirassistische Ansätze
- Zusammenfassung
- Jugendarbeit
- Kurze Geschichte der Jugendarbeit
- Aufgaben der Jugendarbeit
- Ansätze in der Jugendarbeit
- Jugendaustausch und Jugendbegegnung
- Interkulturelle Jugendarbeit in München
- Situation in München
- Grundlagen und Konzepte interkultureller Jugendarbeit
- Grundlagen
- Ziele
- Methoden
- Leitlinien des Kreisjugendringes zur interkulturellen Arbeit
- Der erweiterte Kulturbegriff
- Der kulturspezifische Ansatz
- Der transkulturelle Ansatz
- Der interkulturelle Ansatz
- Angebote und Projekte der Jugendzentren
- Aktive Mitarbeit
- Medienarbeit
- Mädchen- und Jungenarbeit
- Freizeitpädagogische Angebote
- Grenzen der interkulturellen Jugendarbeit
- Evaluation und Weiterentwicklung
- 'Pädagogik der Vielfalt' statt interkultureller Pädagogik?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit untersucht die Herausforderungen der interkulturellen Erziehung am Beispiel der Jugendarbeit. Sie analysiert die Problemfelder und Lebensrealitäten ausländischer Jugendlicher im Kontext einer multikulturellen Gesellschaft, wobei der Fokus insbesondere auf der Identitätsbildung und den Auswirkungen des 'Kulturkonflikts' liegt.
- Analyse der Lebensbedingungen und Herausforderungen ausländischer Jugendlicher in Deutschland
- Erörterung des 'Kulturkonflikts' und seiner Auswirkungen auf die Identitätsentwicklung
- Bedeutung und Entwicklung interkultureller Erziehung und ihrer Ansätze
- Analyse und Bewertung interkultureller Jugendarbeit in München
- Diskussion der Relevanz des Konzepts der 'Pädagogik der Vielfalt' im Kontext der interkulturellen Erziehung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Aktualität und Bedeutung des Themas 'interkulturelle Erziehung' im Kontext der multikulturellen Gesellschaft beleuchtet.
Das zweite Kapitel analysiert das Alltagsleben und die Problemfelder ausländischer Jugendlicher in Deutschland. Es werden Themen wie die politische und rechtliche Situation, Wohnsituation, Freizeitgestaltung, 'Ausländerkriminalität', Religion, Schule und Bildung sowie der 'Identitätskonflikt' behandelt. Dieses Kapitel beleuchtet die spezifischen Herausforderungen, denen ausländische Jugendliche im deutschen Kontext gegenüberstehen.
Kapitel drei widmet sich dem Kulturbegriff und dem Umgang mit Fremdheit in der Gesellschaft. Es werden die sozialen Bedingungen zur Konstruktion von Fremdbildern und deren soziale Funktion erläutert. Im Anschluss werden Anforderungen an eine Interkulturelle Pädagogik formuliert.
Kapitel vier beschäftigt sich mit der Interkulturellen Erziehung. Es werden Geschichte und Entwicklung sowie Kritik an diesem Konzept beleuchtet. Die Arbeit beleuchtet die Integration als Ziel Interkultureller Erziehung und die Bedeutung der Interkulturellen Kompetenz. Darüber hinaus werden antirassistische Ansätze und die Zusammenfassung des Themas Interkulturelle Erziehung behandelt.
Kapitel fünf bietet einen Überblick über die Jugendarbeit in Deutschland, ihre Geschichte, Aufgaben und Ansätze. Es wird auch der Jugendaustausch und die Jugendbegegnung als wichtige Elemente der Jugendarbeit beleuchtet.
Kapitel sechs fokussiert sich auf die interkulturelle Jugendarbeit in München. Es werden die Situation in München, die Grundlagen und Konzepte interkultureller Jugendarbeit, Leitlinien des Kreisjugendringes zur interkulturellen Arbeit, Angebote und Projekte der Jugendzentren sowie die Grenzen und Weiterentwicklung der interkulturellen Jugendarbeit behandelt.
Das siebte Kapitel diskutiert die Frage, ob die 'Pädagogik der Vielfalt' eine Alternative oder Ergänzung zur interkulturellen Pädagogik darstellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Interkulturelle Erziehung, 'Kulturkonflikt', Identitätsentwicklung, Ausländische Jugendliche, Jugendarbeit, Integration, Interkulturelle Kompetenz, Antirassismus und 'Pädagogik der Vielfalt'.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter interkultureller Erziehung in der Jugendarbeit?
Es handelt sich um pädagogische Ansätze, die das Zusammenleben von Jugendlichen unterschiedlicher kultureller Herkunft fördern und interkulturelle Kompetenz vermitteln.
Was ist der „Kulturkonflikt“ bei ausländischen Jugendlichen?
Er beschreibt die Spannung zwischen der traditionellen Kultur des Elternhauses und der sozialen Umwelt des Aufnahmelandes, die die Identitätsbildung beeinflusst.
Welche Ziele verfolgt die interkulturelle Jugendarbeit in München?
Ziele sind die Integration, die Förderung der Teilhabe durch Medien- und Freizeitprojekte sowie der Abbau von Vorurteilen durch Begegnungsprogramme.
Was unterscheidet den transkulturellen vom interkulturellen Ansatz?
Der interkulturelle Ansatz betont den Dialog zwischen Kulturen, während der transkulturelle Ansatz davon ausgeht, dass Kulturen heute stark vermischt und nicht mehr klar abgrenzbar sind.
Welche Rolle spielen Medien in der Identitätsentwicklung von Migrantenkindern?
Medien beeinflussen die Freizeitgestaltung und bieten Orientierungspunkte sowohl in der Sprache des Herkunftslandes als auch in der des Aufnahmelandes.
- Quote paper
- Isabel Wendorff (Author), 2002, Außerschulische Interkulturelle Erziehung: Das Beispiel Jugendarbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/8842