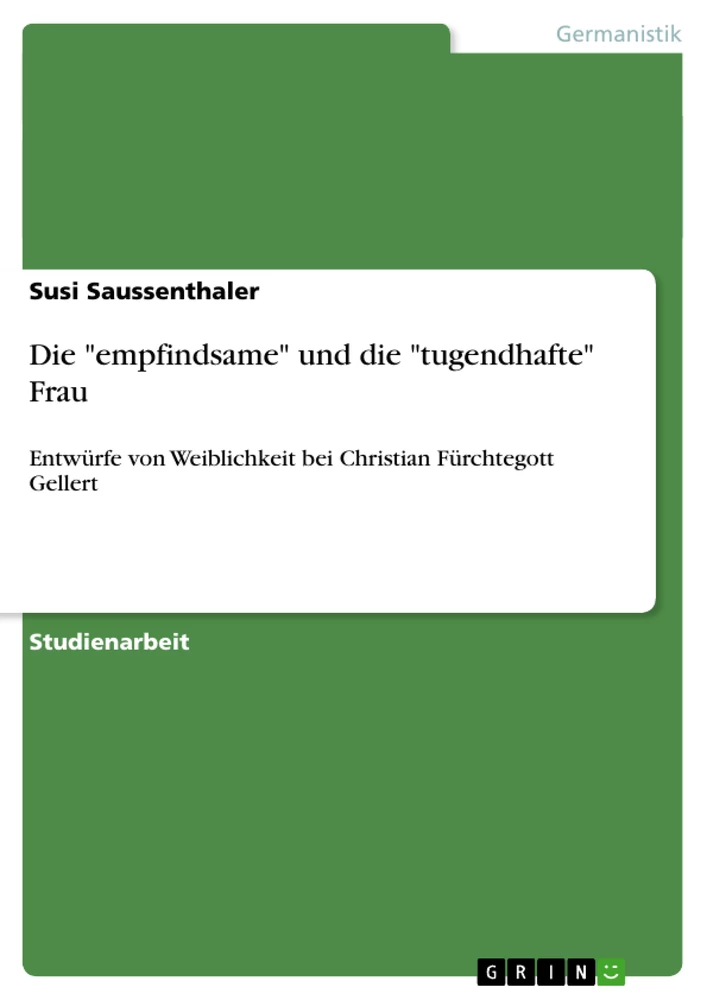Diese Arbeit basiert auf dem Seminar Romane der Aufklärung, welches im Sommersemester 2006 statt fand. Die Romane wurden hinsichtlich ihrer Erzählstruktur und anderen Besonderheiten, so zum Beispiel der Vermittlung aufklärerischer Postulate untersucht. So trat die Frage nach der Funktion der Anfänge des modernen Erzählens zutage.
So sind die Romane der Aufklärung gekennzeichnet durch die Lust an der Imagination, das Spiel mit Realität und Fiktion. Eine spezielle Konstellation einer Autor-Imagination stellt der Roman „Leben der schwedischen Gräfin von G***“ von Christian Fürchtegott Gellert dar. Hier schlüpft der männliche Autor in die Rolle einer weiblichen Ich-Erzählerin. Diese berichtet aus der Rückschau ihr Leben, welches durch tugendhaftes Verhalten zum wahren Glück, zum Ideal der Gelassenheit, geführt hat.
Die Konstellation eines männlichen Autors, welcher sich in die Rolle einer Frau hineinversetzt, eine Identität imaginiert, war zur Zeit der Aufklärung nicht ungewöhnlich. Schon Gottsched gab in der Ausgabe der „Vernünfftigen Tadlerinnen“ vor, dass diese von drei Frauen geschrieben und verlegt würde. Das Spiel mit einer imaginierten Weiblichkeit war den Leserinnen bewusst.
Angesichts weitgehend fehlender Autorinnen waren die Leserinnen jedoch auf die männlichen Projektionen, Vorstellungen von Frauen, als Lesestoff angewiesen. Gleichzeitig war es den Autoren auf diese Weise möglich, den Frauen ein von ihnen entworfenes Selbstverständnis zu präsentieren und zu vermitteln. Ein weiblicher Entwurf oder ein Einspruch bezüglich männlicher Vorstellungen war den Frauen nicht gegeben, da diese kein öffentliches Forum besaßen.
Die Arbeit möchte anhand von Gellerts Leben der schwedischen Gräfin von G*** eine Vorstellung von Weiblichkeit zur Zeit der Aufklärung rekonstruieren. Gellert wird der frühaufklärerischen Phase zugeordnet, dem von Johann Christian Wolff’s Philosophie geprägten Rationalismus. Sein Werk war didaktisch-belehrend ausgerichtet. Aus diesem Grund entspringt hier die Frage, was er durch sein Frauenbild den Leserinnen vermitteln wollte.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: Frage und Forschungsstand
- 2. Vorgehen
- 3. Die imaginierte Weiblichkeit
- 4. Praktische Abhandlung von dem guten Geschmacke in Briefen: Die „empfindsame“ Frau
- 5. Die Weiblichkeit der Schwedischen Gräfin von G***: Die „tugendhafte“ Frau
- 6. Entwürfe von Weiblichkeit: Die „empfindsame“ und die „tugendhafte“ Frau
- 7. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung von Weiblichkeit in den Werken Christian Fürchtegott Gellerts, insbesondere in seinem Roman „Leben der schwedischen Gräfin von G***“ und seiner „Praktischen Abhandlung von dem guten Geschmacke in Briefen“. Ziel ist die Rekonstruktion der Vorstellung von Weiblichkeit während der Aufklärung und die Analyse der Funktion dieser Darstellung für die weibliche Leserschaft.
- Imaginierte Weiblichkeit in der Aufklärungsliteratur
- Vergleichende Analyse von Gellerts Roman und seiner Brieflehre
- Funktion des Frauenbildes in Gellerts Werken
- Männliche Projektionen weiblicher Identität
- Das Verhältnis von Empfindsamkeit und Tugendhaftigkeit im weiblichen Ideal
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Frage und Forschungsstand: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach der Darstellung von Weiblichkeit in Gellerts Werk im Kontext der Aufklärungsliteratur. Sie skizziert den Forschungsstand, der bisherige Analysen von Gellerts Romanen und Briefen primär auf deren didaktische und tugendhafte Aspekte fokussierte, während die spezifische Konstruktion von Weiblichkeit und deren Funktion für die weibliche Leserschaft bisher nur unzureichend behandelt wurde. Die Arbeit setzt an dieser Forschungslücke an und kündigt eine vergleichende Analyse von Gellerts Roman „Leben der schwedischen Gräfin von G***“ und seiner „Praktischen Abhandlung von dem guten Geschmacke in Briefen“ an, um Gellerts Vorstellung von Weiblichkeit und deren Funktion zu rekonstruieren.
2. Vorgehen: Dieses Kapitel beschreibt die methodische Vorgehensweise der Arbeit. Es wird der Begriff der „imaginierten Weiblichkeit“ nach Silvia Bovenschen erläutert und die Produktionsbedingungen von Literatur in der Aufklärung aus weiblicher Perspektive beleuchtet. Die Analysemethode basiert auf einem wechselseitigen Vergleich des Romans mit der Brieflehre, um Gellerts differenzierte Darstellung von Weiblichkeit als „empfindsam“ und „tugendhaft“ herauszuarbeiten. Die Arbeit sucht nach der Funktion dieser Darstellungen für den männlichen Autor und dessen gesellschaftliche Implikationen. Die zentrale These ist, dass der Roman „Schwedische Gräfin“ dazu dienen soll, der weiblichen Leserschaft zu vermitteln, wie sie eine patriarchalisch dominierte Gesellschaft stützen können.
3. Die imaginierte Weiblichkeit: Dieses Kapitel untersucht den von Silvia Bovenschen geprägten Begriff der „imaginierten Weiblichkeit“ und dessen Relevanz für die Analyse von literarischen Darstellungen des Weiblichen in der Aufklärung. Es beleuchtet die kulturwissenschaftliche und feministische Perspektive, die die männliche Konstruktion weiblicher Identität und deren Funktion in der Aufrechterhaltung von Machtstrukturen kritisiert. Die Analyse greift auf dekonstruktive Methoden zurück, um männliche Herrschaftsstrategien aufzudecken, die sich in der literarischen Produktion manifestieren. Das Kapitel betont die Knappheit an authentischen weiblichen Stimmen in der Literatur der Zeit und die daraus resultierende Notwendigkeit, männliche Projektionen von Weiblichkeit zu analysieren.
4. Praktische Abhandlung von dem guten Geschmacke in Briefen: Die „empfindsame“ Frau: Dieses Kapitel analysiert Gellerts „Praktische Abhandlung von dem guten Geschmacke in Briefen“ im Hinblick auf seine Darstellung von Weiblichkeit. Es wird argumentiert, dass Gellert hier ein Frauenbild entwirft, das durch „empfindsame“ Züge charakterisiert ist und als erstrebenswert für Frauen dargestellt wird. Diese Analyse legt den Grundstein für den Vergleich mit der Darstellung von Weiblichkeit in Gellerts Roman, der in einem folgenden Kapitel behandelt wird. Die Analyse berücksichtigt die sozialen und geistesgeschichtlichen Kontexte und untersucht, welche Rolle die Konzeption von Weiblichkeit innerhalb von Gellerts Argumentation spielt.
5. Die Weiblichkeit der Schwedischen Gräfin von G***: Die „tugendhafte“ Frau: Dieses Kapitel befasst sich mit Gellerts Roman „Leben der schwedischen Gräfin von G***“. Im Fokus steht die Analyse der Darstellung von Weiblichkeit als „tugendhaft“. Im Gegensatz zur „empfindsamen“ Frau der Brieflehre, wird hier ein weiblicher Tugend-Ideal präsentiert, das die Empfindsamkeit zugunsten einer Normierung des Verhaltens unterdrückt. Die Analyse untersucht die narrative Strategie und die Bedeutung der Ich-Erzählerin, um die Funktion von Gellerts Frauenbild für die weibliche Leserschaft und die gesellschaftlichen Implikationen zu verstehen.
6. Entwürfe von Weiblichkeit: Die „empfindsame“ und die „tugendhafte“ Frau: Dieses Kapitel synthetisiert die Ergebnisse der vorherigen Kapitel und vergleicht die Darstellung von Weiblichkeit als „empfindsam“ und „tugendhaft“ in Gellerts Werk. Es analysiert die Spannungsfelder zwischen diesen beiden Idealvorstellungen und deren Bedeutung im Kontext der Aufklärung. Die Analyse untersucht, wie Gellert beide Konzepte einsetzt, um seine didaktischen und gesellschaftlichen Ziele zu erreichen.
Schlüsselwörter
Imaginierte Weiblichkeit, Aufklärung, Christian Fürchtegott Gellert, „Leben der schwedischen Gräfin von G***“, „Praktische Abhandlung von dem guten Geschmacke in Briefen“, Empfindsamkeit, Tugendhaftigkeit, Patriarchat, Männliche Projektionen, Feministische Literaturwissenschaft.
Häufig gestellte Fragen zu: Darstellung von Weiblichkeit in den Werken Christian Fürchtegott Gellerts
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Darstellung von Weiblichkeit in den Werken Christian Fürchtegott Gellerts, insbesondere in seinem Roman „Leben der schwedischen Gräfin von G***“ und seiner „Praktischen Abhandlung von dem guten Geschmacke in Briefen“. Sie rekonstruiert die Vorstellung von Weiblichkeit während der Aufklärung und analysiert deren Funktion für die weibliche Leserschaft.
Welche Werke von Gellert werden analysiert?
Die Analyse konzentriert sich auf Gellerts Roman „Leben der schwedischen Gräfin von G***“ und seine „Praktische Abhandlung von dem guten Geschmacke in Briefen“. Beide Werke werden vergleichend untersucht, um Gellerts differenzierte Darstellung von Weiblichkeit zu verstehen.
Welche Konzepte von Weiblichkeit werden untersucht?
Die Arbeit untersucht zwei zentrale Konzepte von Weiblichkeit bei Gellert: die „empfindsame“ Frau, dargestellt in der „Praktischen Abhandlung“, und die „tugendhafte“ Frau, dargestellt im Roman „Schwedische Gräfin“. Der Vergleich dieser Konzepte steht im Mittelpunkt der Analyse.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine vergleichende Analysemethode, die den Roman und die Brieflehre wechselseitig gegenüberstellt. Sie bezieht den Begriff der „imaginierten Weiblichkeit“ nach Silvia Bovenschen ein und greift auf dekonstruktive Methoden zurück, um männliche Herrschaftsstrategien aufzudecken.
Was ist die zentrale These der Arbeit?
Die zentrale These ist, dass Gellerts Roman „Schwedische Gräfin“ der weiblichen Leserschaft vermitteln soll, wie sie eine patriarchalisch dominierte Gesellschaft stützen können.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit besteht aus sieben Kapiteln: Einleitung, Vorgehen, Die imaginierte Weiblichkeit, Praktische Abhandlung von dem guten Geschmacke in Briefen: Die „empfindsame“ Frau, Die Weiblichkeit der Schwedischen Gräfin von G***: Die „tugendhafte“ Frau, Entwürfe von Weiblichkeit: Die „empfindsame“ und die „tugendhafte“ Frau und Ausblick.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Imaginierte Weiblichkeit, Aufklärung, Christian Fürchtegott Gellert, „Leben der schwedischen Gräfin von G***“, „Praktische Abhandlung von dem guten Geschmacke in Briefen“, Empfindsamkeit, Tugendhaftigkeit, Patriarchat, Männliche Projektionen, Feministische Literaturwissenschaft.
Welchen Forschungsstand berücksichtigt die Arbeit?
Die Arbeit berücksichtigt den bisherigen Forschungsstand, der sich primär auf die didaktischen und tugendhaften Aspekte von Gellerts Werken konzentriert hat. Sie schließt eine Forschungslücke, indem sie die spezifische Konstruktion von Weiblichkeit und deren Funktion für die weibliche Leserschaft analysiert.
Welche gesellschaftlichen Implikationen werden diskutiert?
Die Arbeit untersucht die gesellschaftlichen Implikationen von Gellerts Darstellung von Weiblichkeit und deren Funktion im Kontext der patriarchalischen Gesellschaft der Aufklärung.
Wie wird die Funktion des Frauenbildes analysiert?
Die Analyse untersucht die Funktion des Frauenbildes für den männlichen Autor und dessen gesellschaftliche Implikationen. Sie beleuchtet die männlichen Projektionen weiblicher Identität und deren Rolle in der Aufrechterhaltung von Machtstrukturen.
- Citation du texte
- M.A. Susi Saussenthaler (Auteur), 2007, Die "empfindsame" und die "tugendhafte" Frau, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88432