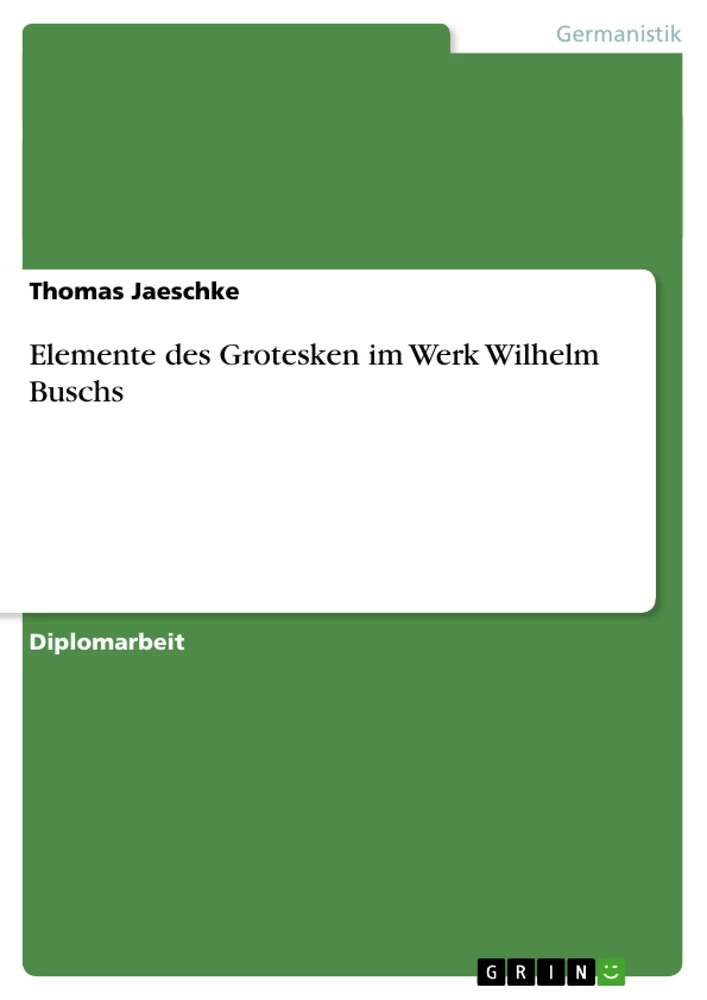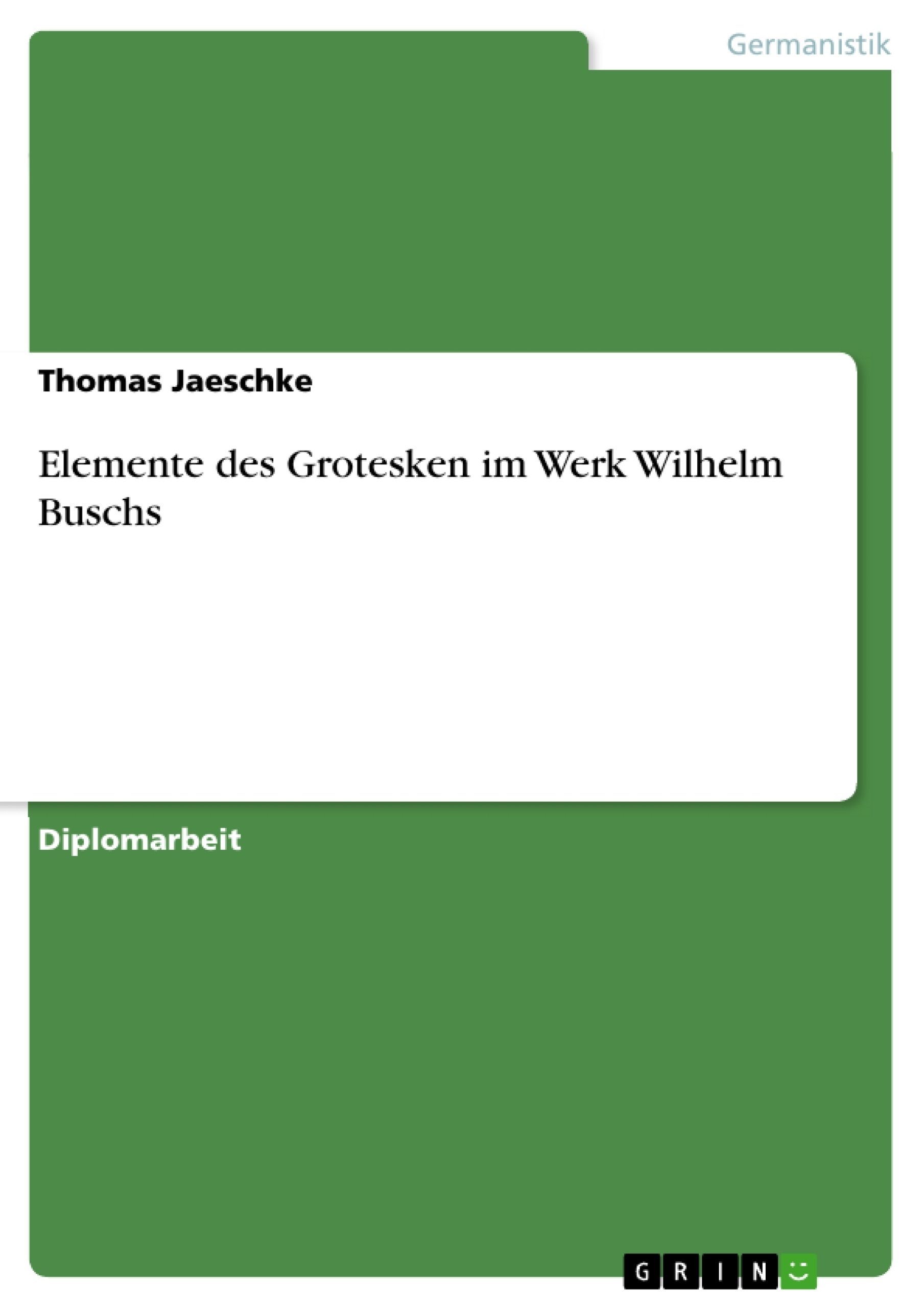Wilhelm Buschs zweifellos große Verdienste als innovativer Zeichner, Karikaturist und Pionier des Cartoons werden inzwischen allgemein anerkannt und gewürdigt. Doch so populär sein Werk durch alle Leserschichten hindurch bis in die Gegenwart ist, so unbeirrt gelten Buschs Bildergeschichten weiterhin als „gemütvoll-humoristischer Hausschatz“, der bei Amüsierbedarf unter der Rubrik „Schmunzel-Lektüre“ gehoben und schnell konsumiert werden kann. Die geläufige Art der Rezeption sicherte seinem Schöpfer schon zu Lebzeiten ein finanziell komfortables Auskommen, und allein schon dieser Umstand verleiht der öffentlich gepflegten Lesart des Werkes insofern eine gewisse Deutungsberechtigung.
Bei genauerer Betrachtung indes wird sie der Vielschichtigkeit des Busch-Figurenkosmos´ gleichzeitig kaum gerecht: einer bizarren, nihilistischen Zeichenwelt, einem Quälwerk, strotzend voller Greueltaten, Vernichtung und Tod.
Wie nun versteht es Busch, seine tiefdunkle Sicht auf das Leben handwerklich so meisterlich prallbunt und bekömmlich zu gestalten, daß sich Generationen von Lesern über die kruden Missgeschicke seiner Witzfiguren gut unterhalten fühlen können?
Antworten auf diese interessante Frage versucht die vorliegende Arbeit über die Analyse grotesker Stilelemente (als Teil der Komischen Gattung), im Zusammenwirken von Inhalt und zeichnerischer Form in Buschs Werk zu finden.“
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Das Grotesk-Komische
- 1.1 Das Komische und die ihm untergeordneten komischen Formen
- 1.1.1 Das Komische
- 1.1.2 Der Witz
- 1.1.3 Der Humor (inkl. Schwarzer Humor)
- 1.1.4 Die Satire
- 1.1.5 Die Karikatur, die Parodie und verwandte Formen
- 1.1.6 Das Tragikomische
- 1.2 Das Groteske als Form des Komischen
- 1.2.1 Etymologischer und historischer Ursprung des Grotesken
- 1.2.2 Das Charakteristische des Grotesken unter Berücksichtigung verschiedener Theorieansätze - eine Diskussion
- 1.2.3 Die Besonderheit des Grotesken. Ein Abgrenzungsversuch gegenüber ihm nahestehende komische Formen
- 1.2.4 Resümee und Herausarbeitung eines Arbeitsbegriffes 'grotesk'
- 1.1 Das Komische und die ihm untergeordneten komischen Formen
- 2. Das Grotesk-Komische im Werk Wilhelm Buschs
- 2.1 DIE BILDERGESCHICHTEN
- 2.1.1 „Mein genre ist genre.“ Die Bildergeschichten im Kontext ihrer traditionellen literarischen Vorbilder Teil I: Die volkstümlichen Gattungen
- 2.1.2 „Es saust der Stock, es schwirrt die Rute.“ Die Bildergeschichten im Kontext ihrer traditionellen literarischen Vorbilder Teil II: Die traditionelle Kinderliteratur
- 2.1.3 „In diesem Reich geborner Flegel.“ 'Böse' Tiere und Kinder versus 'dressierte Bürger' - die Typizität der Figuren als Teil von Buschs Willenskonzept
- 2.1.4 „Wer beobachten will, darf nicht mitspielen...“ Synthese und Dissonanz im Bild-Text-Verhältnis der Bildergeschichten
- 2.1.5 „Punkt zwölf erscheint der Knochenmann.“ Elemente des Grotesk-Komischen in den Bildergeschichten - Einleitungsteil:
- 2.1.5.1 Die Tücke des Objekts
- 2.1.5.2 Die Ornamentalisierung des Leibes
- 2.1.5.3 Die Deformation des Körpers
- 2.2 „Kleiner Schnickschnack auf Druckpapier“ - Die Prosa als groteske Epik „Eduards Traum“ (1891) und „Der Schmetterling“ (1895)
- 2.1 DIE BILDERGESCHICHTEN
- 3. Resümee - Die Aporie der Figurenwelt
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die weniger bekannten grotesken Elemente im Werk Wilhelm Buschs. Ziel ist es, über den bekannten Ruf Buschs als Humoristen hinauszugehen und seine Werke unter dem Aspekt des Grotesken zu analysieren. Dabei wird der Begriff des Grotesken selbst definiert und in Beziehung zu anderen komischen Formen gesetzt.
- Definition und Abgrenzung des Grotesken
- Analyse des Grotesken in Buschs Bildergeschichten
- Untersuchung grotesker Elemente in Buschs Prosa
- Zusammenhang zwischen Groteske und den Figuren in Buschs Werk
- Rezeption und Verständnis von Buschs Werk
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die gängige Rezeption von Wilhelm Buschs Werk und kündigt die Arbeit an, die sich mit den weniger bekannten grotesken Aspekten seines Schaffens auseinandersetzen wird. Sie stellt fest, dass die verbreitete Wahrnehmung Buschs sich hauptsächlich auf seine humoristischen Aspekte konzentriert und weniger auf die tiefschürfenden und bisweilen grotesken Elemente in seinen Werken eingeht. Die Arbeit zielt darauf ab, diese bisher unterbelichtete Seite von Buschs Werk zu untersuchen und zu analysieren.
1. Das Grotesk-Komische: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die Analyse. Es definiert den Begriff des Komischen und differenziert zwischen verschiedenen Formen wie Witz, Humor, Satire, Karikatur und Tragikomik. Im Mittelpunkt steht die eingehende Erörterung des Grotesken als spezifische Form des Komischen. Der etymologische und historische Ursprung wird untersucht und verschiedene Theorieansätze zur Charakterisierung des Grotesken werden diskutiert. Abschließend wird ein Arbeitsbegriff für "grotesk" entwickelt, der als Grundlage für die anschließende Analyse von Buschs Werk dient. Der Fokus liegt auf der Abgrenzung des Grotesken von anderen komischen Formen und der Herausarbeitung seiner spezifischen Merkmale.
2. Das Grotesk-Komische im Werk Wilhelm Buschs: Dieses Kapitel wendet die im ersten Kapitel entwickelten theoretischen Konzepte auf das Werk Wilhelm Buschs an. Es untersucht zunächst die Bildergeschichten, indem es verschiedene Aspekte wie die Figuren, das Bild-Text-Verhältnis und die Darstellung von Objekten und Körpern unter dem Blickwinkel des Grotesken analysiert. Die Analyse der Bildergeschichten wird detailliert durchgeführt, und dabei wird auf die traditionellen literarischen Vorbilder und die typischen Figuren eingegangen. Im zweiten Teil werden Buschs Prosawerke wie "Eduards Traum" und "Der Schmetterling" betrachtet, wobei auch hier der Fokus auf den grotesken Aspekten liegt. Das Kapitel zeigt, wie Busch verschiedene Techniken einsetzt, um groteske Effekte zu erzielen und beleuchtet dabei die Verbindung zwischen Groteske und der speziellen Figurenwelt in Buschs Werken.
Schlüsselwörter
Wilhelm Busch, Groteske, Komik, Bildergeschichten, Prosa, Satire, Karikatur, Figuren, Typizität, Bild-Text-Verhältnis, Rezeption, Humoristik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: Das Grotesk-Komische im Werk Wilhelm Buschs
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht die grotesken Elemente im Werk Wilhelm Buschs. Sie geht über die gängige Wahrnehmung Buschs als reinen Humoristen hinaus und analysiert seine Werke unter dem Aspekt des Grotesken. Dabei wird der Begriff des Grotesken definiert und im Verhältnis zu anderen komischen Formen betrachtet.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Definition und Abgrenzung des Grotesken, Analyse des Grotesken in Buschs Bildergeschichten, Untersuchung grotesker Elemente in Buschs Prosa, Zusammenhang zwischen Groteske und den Figuren in Buschs Werk, sowie die Rezeption und das Verständnis von Buschs Werk.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in drei Hauptkapitel gegliedert: Das erste Kapitel legt die theoretischen Grundlagen, indem es das Groteske definiert und von anderen komischen Formen abgrenzt. Das zweite Kapitel wendet diese Theorie auf das Werk Wilhelm Buschs an, indem es sowohl seine Bildergeschichten als auch seine Prosawerke analysiert. Das dritte Kapitel bietet ein Resümee und fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Aspekte von Wilhelm Buschs Werk werden analysiert?
Die Arbeit analysiert sowohl Buschs Bildergeschichten als auch seine Prosa, insbesondere "Eduards Traum" und "Der Schmetterling". Im Fokus stehen dabei die Figuren, das Bild-Text-Verhältnis in den Bildergeschichten, die Darstellung von Objekten und Körpern, sowie die Techniken, die Busch zur Erzeugung grotesker Effekte einsetzt.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit diskutiert verschiedene Theorieansätze zur Charakterisierung des Grotesken und entwickelt einen eigenen Arbeitsbegriff für "grotesk", der als Grundlage für die Analyse dient. Es wird zwischen verschiedenen komischen Formen wie Witz, Humor, Satire, Karikatur und Tragikomik differenziert.
Was ist das Ergebnis der Analyse?
Die Arbeit zeigt, dass in Buschs Werk, neben dem bekannten Humor, auch deutlich groteske Elemente vorhanden sind. Die Analyse beleuchtet die Verbindung zwischen Groteske und der spezifischen Figurenwelt in Buschs Werken und trägt zu einem differenzierteren Verständnis seines Schaffens bei.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Wilhelm Busch, Groteske, Komik, Bildergeschichten, Prosa, Satire, Karikatur, Figuren, Typizität, Bild-Text-Verhältnis, Rezeption und Humoristik.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für alle, die sich für Wilhelm Busch, die deutsche Literatur des 19. Jahrhunderts, Komiktheorie und die Analyse literarischer Groteske interessieren. Sie bietet einen neuen Blick auf das Werk Buschs und trägt zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Thema bei.
- Citation du texte
- Thomas Jaeschke (Auteur), 1997, Elemente des Grotesken im Werk Wilhelm Buschs, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88446