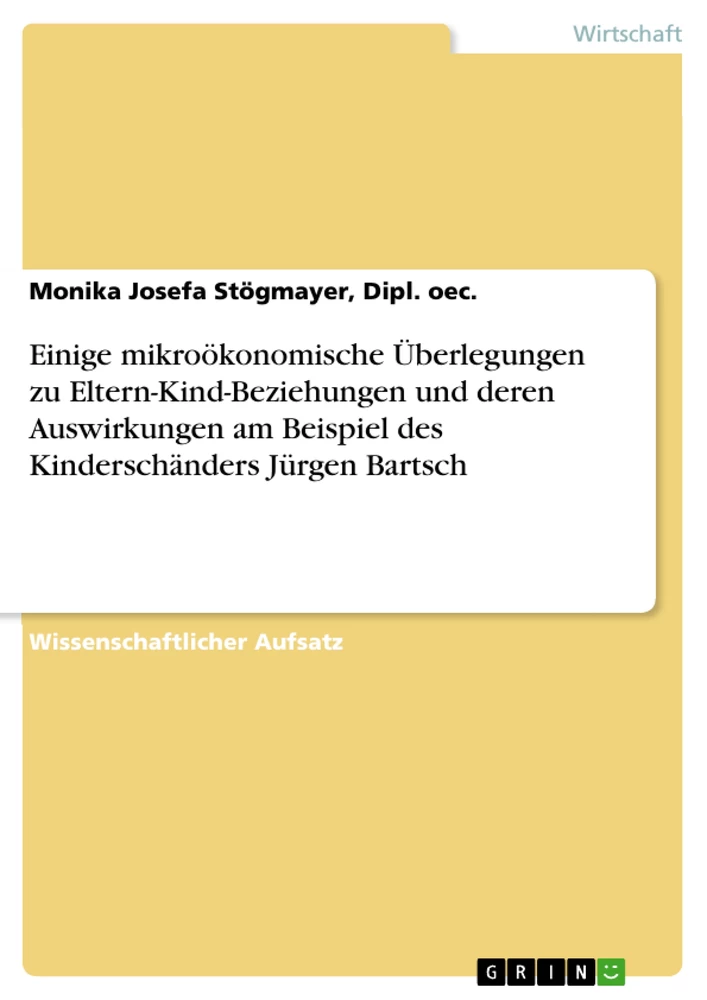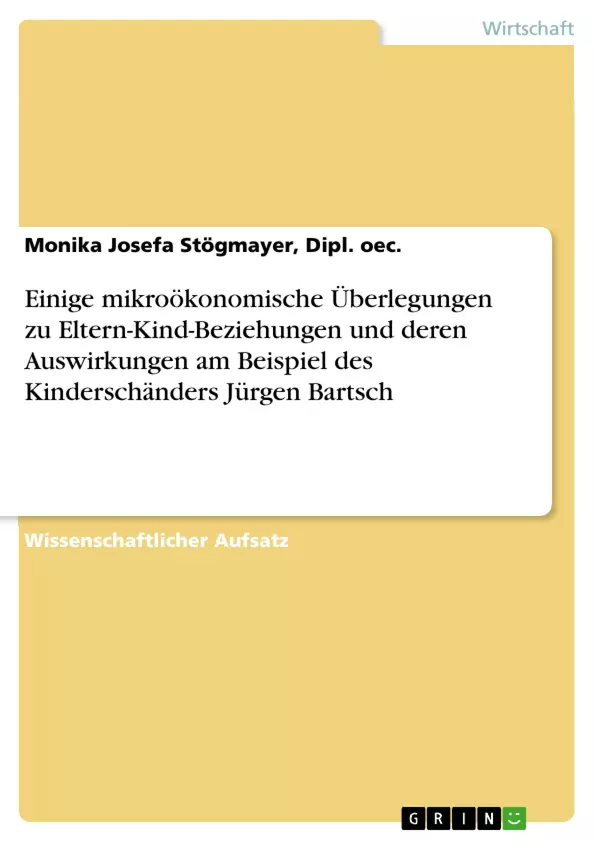Kann man die Beziehung zwischen Eltern und Kind ökonomisch betrachten und darf man darüber hinaus sogar so weit gehen, diese zu monetarisieren und eine Kosten-Nutzen-Analyse anzustellen. Gemäß dem oben zitierten Imperativ Galileis bereits vor etwa 300 Jahren soll man das auf jeden Fall versuchen.
In diesem Aufsatz wird ein bislang ungewohnter mikroökonomischer Schritt in diese Richtung gewagt und versucht, die Eltern-Kind-Beziehung aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Eine Monetarisierung wird jedoch sicher noch eine Weile auf sich warten lassen.1 Erst wenn es gelingt, die Nutzen bzw. Kosten von Einzelnen konkret in monetärer Form zu beziffern, wird man demnach auch Wohlfahrtsfunktionen, beispielsweise in der Form W = W (U1, ..., Um)
maximieren können.
Es war zunächst Garry S. Becker, der mit seiner Ökonomischen Erklärung menschlichen Verhaltens bei so manchem, auch bei so manchem Ökonomen, Aversion und Widerspruch hervorrief, und bis heute gilt sein Werk - vor allem im deutschen Sprachraum - als äußerst umstritten.
In diesem Aufsatz wird die Behauptung aufgestellt, dass Babies von der Natur quasi mit einem natürlichen Budget ausgestattet sind. Zu diesem Budget zählt beispielsweise die Möglichkeit eines Kleinkindes, seine Bezugspersonen anzulächeln und damit diese für ihre Fürsorge zu entschädigen, denn normalerweise empfindet ein Erwachsener Freude (und gewinnt aus dieser Freude einen Nutzen), wenn das Baby zufrieden lächelt.
Inhaltsverzeichnis
- Einige mikroökonomische Überlegungen zu Eltern-Kind-Beziehungen und deren Auswirkungen am Beispiel des Kinderschänders Jürgen Bartsch
- Einleitung
- Das natürliche Budget eines Babies
- Körpersprache als natürliche Ressourcen des Kindes
- Die Interpretation der Körpersprache
- Die Verwendung des natürlichen Budgets
- Das Beispiel des Kinderschänders Jürgen Bartsch
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Aufsatz untersucht die Eltern-Kind-Beziehung aus einer mikroökonomischen Perspektive. Ziel ist es, das Verhalten von Eltern und Kindern in Bezug auf Fürsorge und Bedürfnisbefriedigung anhand ökonomischer Prinzipien zu analysieren. Dabei wird das Konzept eines natürlichen Budgets für Babies eingeführt, das ihnen von Geburt an zur Verfügung steht und ihnen ermöglicht, mit ihrer Körpersprache die Bedürfnisse der Eltern zu kommunizieren und diese für ihre Fürsorge zu "entschädigen".
- Das natürliche Budget von Babies
- Körpersprache als Form der Bedürfniskommunikation
- Ökonomische Analyse der Eltern-Kind-Beziehung
- Die Bedeutung der Interpretation von Körpersprache
- Das Beispiel des Kinderschänders Jürgen Bartsch
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Der Aufsatz stellt die These auf, dass die Eltern-Kind-Beziehung aus einem ökonomischen Blickwinkel betrachtet werden kann und die Nutzung eines natürlichen Budgets für Babies durch die Körpersprache zur Kommunikation und Entschädigung von Fürsorge möglich ist. Die ökonomische Betrachtungsweise von menschlichem Verhalten wird durch das Werk von Garry S. Becker erläutert.
- Das natürliche Budget eines Babies: Der Aufsatz argumentiert, dass Babies mit einem natürlichen Budget ausgestattet sind, das ihnen die Möglichkeit gibt, ihre Bedürfnisse durch Körpersprache zu kommunizieren und die Fürsorge der Eltern zu "entschädigen".
- Körpersprache als natürliche Ressourcen des Kindes: Das Lächeln, Weinen oder Strampeln eines Babys wird als Körpersprache und Ausdruck eines natürlichen Budgets interpretiert, das sie zur Kommunikation ihrer Bedürfnisse einsetzen.
- Die Interpretation der Körpersprache: Die richtige Interpretation der Körpersprache des Babys ist entscheidend für die optimale Entwicklung des Kindes. Fehlinterpretationen können zu negativen Auswirkungen auf das Wohlbefinden führen.
- Die Verwendung des natürlichen Budgets: Die Verwendung des natürlichen Budgets im Kontext der Eltern-Kind-Beziehung wird anhand verschiedener Beispiele illustriert.
Schlüsselwörter
Der Aufsatz konzentriert sich auf die mikroökonomische Analyse der Eltern-Kind-Beziehung, das natürliche Budget von Babies, die Körpersprache als Form der Bedürfniskommunikation und die Interpretation von Körpersprache. Weitere wichtige Themen sind die Folgen von Fehlinterpretationen und die Anwendung ökonomischer Prinzipien auf das Verhalten von Eltern und Kindern. Die Analyse des Beispiels des Kinderschänders Jürgen Bartsch soll die Komplexität und die Bedeutung der richtigen Interpretation von Körpersprache in der Eltern-Kind-Beziehung veranschaulichen.
Häufig gestellte Fragen
Kann man Eltern-Kind-Beziehungen ökonomisch betrachten?
Ja, der Aufsatz wendet mikroökonomische Prinzipien wie die Kosten-Nutzen-Analyse auf die Interaktion zwischen Eltern und Kindern an.
Was versteht man unter dem "natürlichen Budget" eines Babys?
Es bezeichnet die angeborenen Ressourcen eines Kindes (z.B. Lächeln), mit denen es Bezugspersonen für deren Fürsorge "entschädigt" und Nutzen stiftet.
Wie fungiert Körpersprache als ökonomische Ressource?
Durch Lächeln, Weinen oder Strampeln kommuniziert das Baby Bedürfnisse und setzt sein "Budget" ein, um Reaktionen der Umwelt zu steuern.
Welche Rolle spielt Garry S. Becker in diesem Kontext?
Becker begründete die ökonomische Erklärung menschlichen Verhaltens, die als theoretische Basis für diesen unkonventionellen Ansatz dient.
Warum wird der Fall Jürgen Bartsch als Beispiel herangezogen?
Das Beispiel dient dazu, die fatalen Folgen einer Fehlinterpretation kindlicher Körpersprache und gestörter Eltern-Kind-Beziehungen zu verdeutlichen.
- Citar trabajo
- Monika Josefa Stögmayer, Dipl. oec. (Autor), 2007, Einige mikroökonomische Überlegungen zu Eltern-Kind-Beziehungen und deren Auswirkungen am Beispiel des Kinderschänders Jürgen Bartsch, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88478