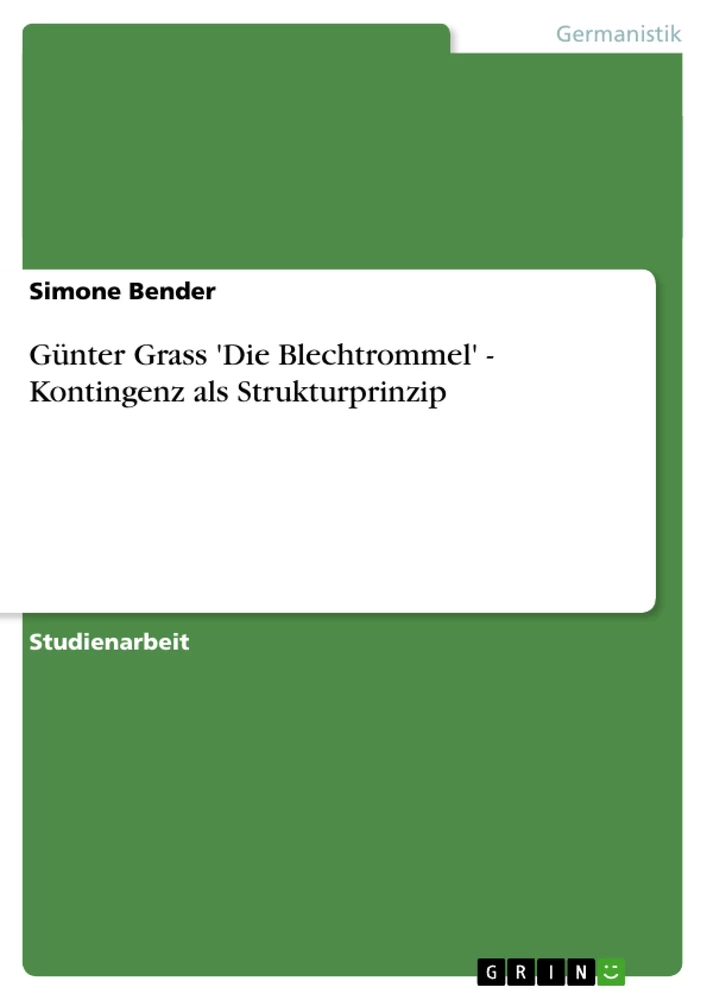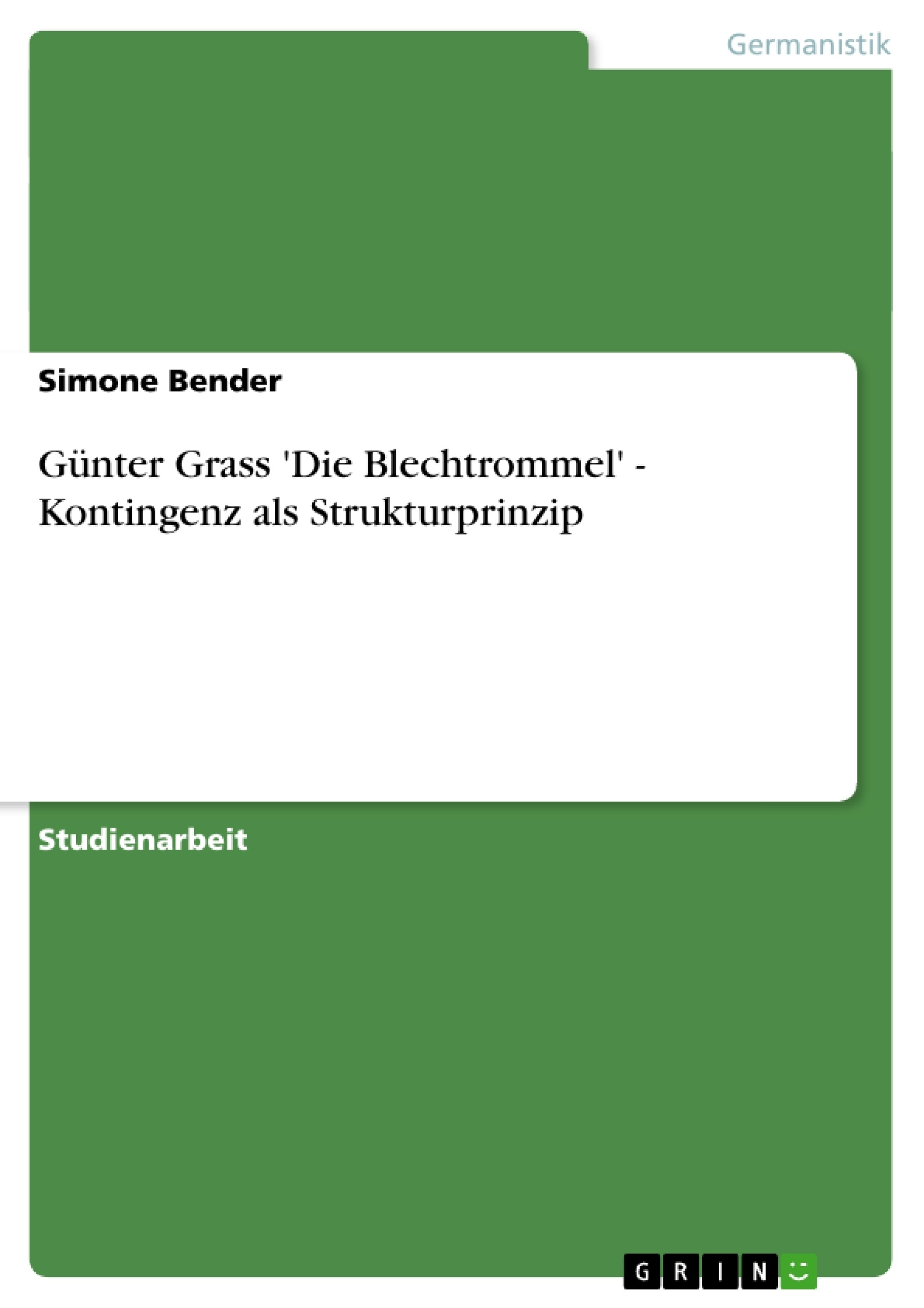So alt wie Die Blechtrommel ist die Debatte um die literaturhistoriographische Einordnung des Romandebüts von Günter Grass aus dem Jahr 1959. In Deutschland ein Skandalerfolg erlangte Die Blechtrommel auch in den USA Berühmtheit und stellte für den jungen Autor den internationalen Durchbruch dar. In Folge der rasch erworbenen Meriten des epischen Erstlingswerkes erschienen in Deutschland zahlreiche Artikel, Aufsätze und Dissertationen zur Blechtrommel. Darüber hinaus betraf die Thematik des Romans direkt den Prozeß der kulturellen Selbstverständigung und Identitätsfindung der jungen Bundesrepublik. Unter dem pragmatistisch – restaurativen Geist der Adenauer – Ära und der Betriebsamkeit der Wirtschaftswunderzeit schwelte der Konflikt der unzureichend aufgearbeiteten NS – Vergangenheit. Die Identitätssuche der Bundesrepublik war von schweren sozialpsychologischen Verwerfungen begleitet. Wenn Identität der Kontinuität bedarf, so war eine unkorrumpierte Traditionslinie kaum auszumachen. Auch konnte im Zeichen der militärischen Niederlage des Deutschen Reiches und der anschließend oberflächlich und auf Geheiß der Siegermächte durchgeführten Entnazifizierungsmaßnahmen kein identitätsstiftender Gründungsmythos der jungen Republik gesehen werden.
In dieser ambivalenten kulturhistorischen Situation formierte sich im September 1947 um den Publizisten Hans Werner Richter die Gruppe 47. Dieser lose Verband von Schriftstellern, dem später Günter Grass beitrat, hatte es sich zur Aufgabe gemacht, die neue Literaturszene der Bundesrepublik zu formieren und sich im literarischen Bereich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Die Politisierung der Literatur – die Diskussion über Verantwortungen und Möglichkeiten im Bereich ästhetischer Kunst – drehte sich wesentlich um die Bereiche persönlicher oder kollektiver Schuld vor einem historischen Horizont, dem selbst jede teleologische Heilserwartung abzusprechen war. Die Historismusdebatte zog den wissenschaftlichen und kulturellen Geschichtsbegriff selbst in den Blickpunkt der Kritik. Der Gang der Geschichte und das persönliche Schicksal des Menschen schienen von nicht kontrollierbaren und irrationalen Faktoren abhängig. Kontinuität war nur noch als Verhängnis sichtbar.
Die epische Dichtkunst hatte so das Verhältnis von individueller Lebenssphäre und der kollektiven Historie, vor dem Hintergrund einer Auseinandersetzung mit der konkreten katastrophischen Vergangenheit, ästhetisch zu bestimmen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kontingenz und Sinn - Kommunikationstheoretische Überlegungen zum modernen Roman
- Oskar - Die narrative Instanz der Blechtrommel
- Oskar als Figur
- Das Trommeln
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit hat zum Ziel, die Kontingenzerfahrung als wesentliches Strukturprinzip der Blechtrommel aufzuzeigen. Die Analyse der Forschungslage zur Blechtrommel zeigt eine große Heterogenität in den Interpretationsergebnissen, die auf methodische Unterschiede zurückzuführen sind.
- Die Kontingenz als Strukturprinzip der Blechtrommel
- Die Herausforderungen der literarhistorischen und gattungsmäßigen Einordnung des Romans
- Die Bedeutung der Erzählperspektive für das Absurde der Lebensgeschichte Oskar Matzeraths
- Die methodischen Implikationen der Kontingenz als Prinzip entdogmatisierter Historiographie
- Die Rolle der Kontextnegation in der Interpretation historischer Dokumente
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung behandelt die literaturhistorische Einordnung der Blechtrommel und ihre Bedeutung für die junge Bundesrepublik.
- Kapitel 2 untersucht das Konzept der Kontingenz und seine Auswirkungen auf die Interpretation des modernen Romans.
- Kapitel 3 konzentriert sich auf Oskar Matzerath als narrative Instanz und die Besonderheiten seiner Perspektive.
- Kapitel 4 analysiert Oskar als Figur und seine Rolle im Roman.
- Kapitel 5 beleuchtet die symbolische Bedeutung des Trommelns in der Geschichte.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter und Fokusthemen dieser Arbeit sind: Kontingenz, Geschichte, Moderne, Roman, Blechtrommel, Oskar Matzerath, Erzählperspektive, Historiographie, Kommunikationstheorie, Sinn, Kontextnegation, Methode.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das zentrale Strukturprinzip in Günter Grass' „Die Blechtrommel“ laut dieser Analyse?
Das zentrale Strukturprinzip der Arbeit ist die „Kontingenz“, also die Erfahrung von Zufälligkeit und der Abwesenheit einer zwingenden Ordnung in der Geschichte.
Welche Bedeutung hatte der Roman für die junge Bundesrepublik?
Der Roman war Teil des Prozesses der kulturellen Selbstverständigung und Identitätsfindung in einer Zeit, in der die NS-Vergangenheit nur unzureichend aufgearbeitet war.
Wer ist die narrative Instanz in der „Blechtrommel“?
Die narrative Instanz ist die Figur Oskar Matzerath, dessen besondere Perspektive das Absurde seiner Lebensgeschichte unterstreicht.
Was war die „Gruppe 47“?
Ein loser Verband von Schriftstellern um Hans Werner Richter, dem auch Günter Grass beitrat. Ziel war es, die neue Literaturszene zu formieren und sich mit der deutschen Vergangenheit auseinanderzusetzen.
Warum ist die literaturhistoriographische Einordnung des Romans schwierig?
Die Forschungslage ist sehr heterogen, was auf unterschiedliche methodische Ansätze und die ambivalente kulturhistorische Situation der Entstehungszeit zurückzuführen ist.
Welche Rolle spielt das Trommeln im Roman?
Das Trommeln wird als symbolische Handlung untersucht, die eng mit Oskars Verweigerungshaltung und seiner Art der Vergangenheitsbewältigung verknüpft ist.
- Quote paper
- Simone Bender (Author), 2007, Günter Grass 'Die Blechtrommel' - Kontingenz als Strukturprinzip, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88643