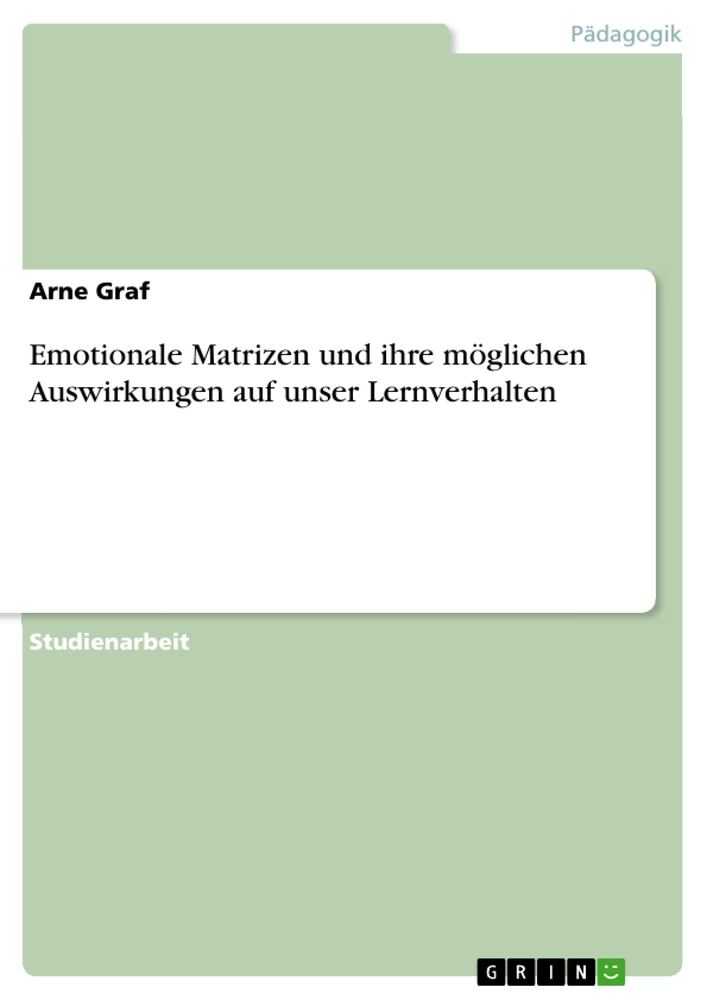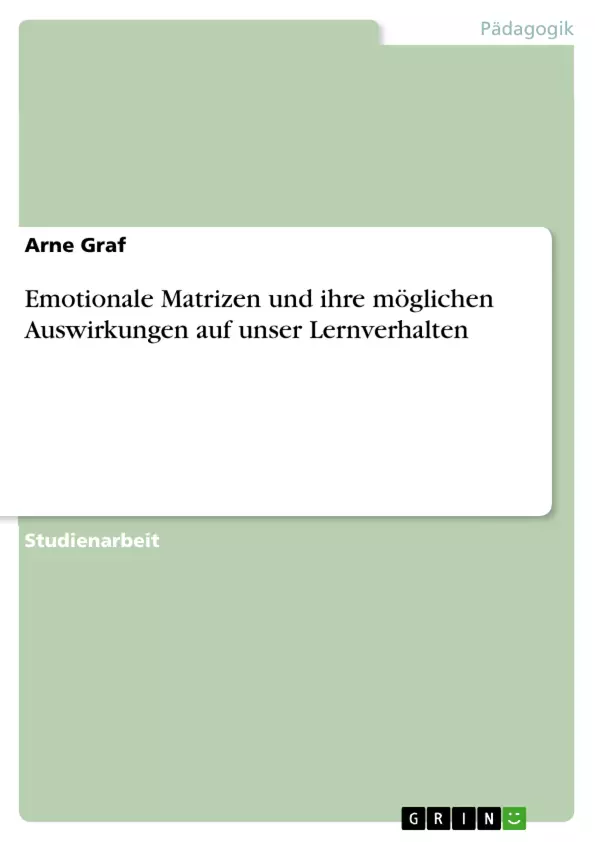Was ist die Wahrheit? Zu dieser Frage gibt es zahlreiche Antworten. Eine Theorie, die diese Frage versucht zu beantworten ist die konstruktivistische Erkenntnistheorie. Unabhängig von den Unterschieden in den konstruktivistischen Lehren, möchte ich in meiner Ausarbeitung zu dem Thema nicht nur auf die rein kognitive Konstruktion einer Realität eingehen, sondern auch aufzeigen, welchen Einfluss Emotionen dabei haben.
Erkenntnisse, wie die eigenen Emotionen sich auf das Lernen auswirken sind noch recht neu und werden vor allem aus neuen Erkenntnissen der Hirnforschung gestützt bzw. es werden die „Verflechtungen mit Wahrnehmung und Denken, wie Verhalten immer genauer aufgedeckt“. Luc Ciompi spricht hierbei auch von einer emotionalen Wende, die der kognitiven Wende in den 70er Jahren folgte.
Und obwohl unsere Emotionen unser Leben be- bzw. mitbestimmen, werden sie in der Bildung nicht berücksichtig. Gefühle wurden lange Zeit in der Neurowissenschaft zusammen mit den Instinkten und Reflexen im Gehirnstamm angesiedelt. Nach alter Auffassung zeichnen sich Menschen durch die überwölbte Großhirnrinde aus, in der man bis heute die höchste Hirnleistung nachgewiesen hat, die Kognition.
Nach Rolf Arnold soll sich die Bildung in Zukunft sogar an Konzepten der Emotionspsychologie und Tiefenpsychologie orientieren. Rolf Arnold geht es nicht nur um das bloße Aneignen vom kognitiv erlernbaren Wissen, sondern auch darum, wie Emotionen unsere Wahrnehmung beeinflussen und unser Realitätserleben für das Subjekt plausibel erscheinen lässt.
Gefordert wird neuerdings, vor allem durch das Wirken der Medien eine Ausrichtung pädagogischen Handelns nicht nur an der empirischen Forschung, sondern auch einem naturwissenschaftlichen Ideal nachzukommen, wie es in der Psychologie ausgeübt wird.
Lehren und Lernen soll plan- und steuerbar gemacht werden. Die Frage ist bloß, warum dies bis dato nicht möglich ist. Die Antwort von Rolf Arnold hierauf ist, dass zur Kognition die Emotion schlichtweg ausgeklammert wird. Dazu zählen „die Emotionen des Menschen, die Entstehung von Emotionen in der individuellen
Entwicklung und ihre Verbindung zum rationalen Denken.“
Welche Auswirkungen haben nun also emotionen auf unsere Wahrnehmung? Und was genau sind Emotionen? Und welche Auswirkungen haben sie auf die Lehr-/Lernsituation?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definitionen
- Denken und Lernen mit Gefühlen
- Wirkung der Gefühle Verhalten aus neurobiologischer Sicht
- Auswirkung der Gefühle auf unser Denken aus theoretischer Sicht
- Hirnbiologische Grundlagen
- Hirnbiologische Grundlagen von Lernen
- Die Konsolidierung der Gedächtnisspur
- Emotionale Matrizen
- Die Rolle der Emotionen bei der Informationsverarbeitung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Einfluss von Emotionen auf das Denken und Lernen. Sie verfolgt das Ziel, die Bedeutung emotionaler Prozesse für die kognitive Konstruktion der Realität aufzuzeigen und zu erklären, wie Emotionen die Wahrnehmung und das Lernen beeinflussen.
- Die Rolle von Emotionen im kognitiven Prozess
- Die Entstehung und Funktion emotionaler Matrizen
- Der Einfluss von Emotionen auf die Informationsverarbeitung und das Lernen
- Die Verbindung von Kognition und Affekt im Hinblick auf Bildung und pädagogisches Handeln
- Die Bedeutung neurobiologischer Erkenntnisse für das Verständnis von Emotionen und Lernen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik der konstruktivistischen Erkenntnistheorie ein und betont die Bedeutung von Emotionen für die kognitive Konstruktion der Realität. Sie diskutiert die neuere Forschung, die die enge Verbindung zwischen Emotionen und Kognition im Gehirn aufzeigt und die traditionelle Fokussierung auf rein kognitive Prozesse in Frage stellt. Die Einleitung stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor: Wie beeinflussen Emotionen unsere Wahrnehmung und unser Lernen?
Definitionen
Dieses Kapitel definiert zentrale Begriffe wie Affekt, Emotion, Gefühl und Stimmung, die für das Verständnis der emotionalen Prozesse relevant sind. Es bezieht sich dabei auf die Arbeiten von Luc Ciompi und zeigt auf, wie diese Begriffe innerhalb des Kontexts von Emotionen und Kognition miteinander verbunden sind.
Denken und Lernen mit Gefühlen
3.1. Wirkung der Gefühle Verhalten aus neurobiologischer Sicht
Dieses Unterkapitel untersucht die neurobiologischen Grundlagen der emotionalen Prozesse und deren Einfluss auf das Verhalten. Es stellt die Erkenntnisse von Joseph LeDoux und Antonio Damasio vor, die belegen, dass Emotionen für zielgerichtetes Denken und Handeln unerlässlich sind.
3.2 Auswirkung der Gefühle auf unser Denken aus theoretischer Sicht
Dieses Unterkapitel befasst sich mit der theoretischen Perspektive auf die Beziehung zwischen Emotionen und Kognition. Es beleuchtet, wie Emotionen die Wahrnehmung, das Lernen und das Denken beeinflussen, und wie sie die subjektive Konstruktion der Realität prägen.
Hirnbiologische Grundlagen
4.1 Hirnbiologische Grundlagen von Lernen
Dieses Unterkapitel erläutert die neuronalen Prozesse, die dem Lernen zugrunde liegen, und wie Emotionen in diese Prozesse involviert sind. Es beleuchtet die Rolle von Neurotransmittern und Gehirnarealen bei der Speicherung von Informationen und der Bildung von Erinnerungen.
4.2 Die Konsolidierung der Gedächtnisspur
Dieses Unterkapitel befasst sich mit der Konsolidierung von Gedächtnisinhalten und der Rolle von Emotionen in diesem Prozess. Es zeigt auf, wie emotionale Erfahrungen die Stabilität und den Abruf von Erinnerungen beeinflussen können.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen Emotionen, Kognition, Lernen, neurobiologische Grundlagen, emotionale Matrizen, konstruktivistische Erkenntnistheorie, Wahrnehmung und Bildung. Sie betrachtet die Wechselwirkungen zwischen Emotionen und Kognition im Hinblick auf die Konstruktion der Realität, die Informationsverarbeitung und das pädagogische Handeln.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Einfluss haben Emotionen auf das Lernen?
Emotionen steuern unsere Wahrnehmung und Informationsverarbeitung. Sie entscheiden maßgeblich darüber, welche Informationen als wichtig erachtet und im Langzeitgedächtnis gespeichert werden.
Was sind „emotionale Matrizen“?
Dies sind tief verwurzelte emotionale Erfahrungsstrukturen, die beeinflussen, wie wir neue Situationen bewerten und wie wir in Lehr- und Lernsituationen reagieren.
Was besagt die konstruktivistische Erkenntnistheorie zum Lernen?
Sie geht davon aus, dass wir unsere Realität subjektiv konstruieren. Emotionen spielen dabei eine zentrale Rolle, da sie die Plausibilität unseres Erlebens stützen.
Wie hängen Kognition und Affekt laut Hirnforschung zusammen?
Moderne Erkenntnisse (z.B. von Damasio) belegen, dass Denken und Gefühle untrennbar miteinander verflochten sind. Ohne emotionale Bewertung ist zielgerichtetes Handeln kaum möglich.
Warum wurden Gefühle in der Pädagogik lange vernachlässigt?
Lange Zeit wurden Gefühle als instinktiv und "nieder" angesehen, während die Kognition in der Großhirnrinde als höchste menschliche Leistung galt. Erst die „emotionale Wende“ änderte diesen Fokus.
- Citar trabajo
- Arne Graf (Autor), 2008, Emotionale Matrizen und ihre möglichen Auswirkungen auf unser Lernverhalten, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88705