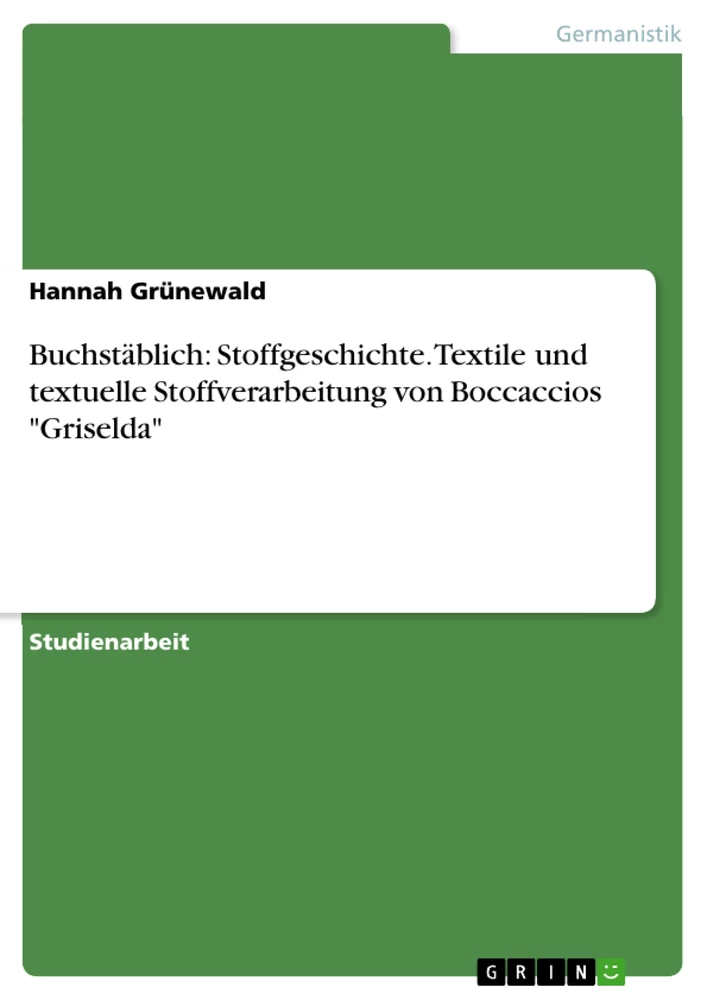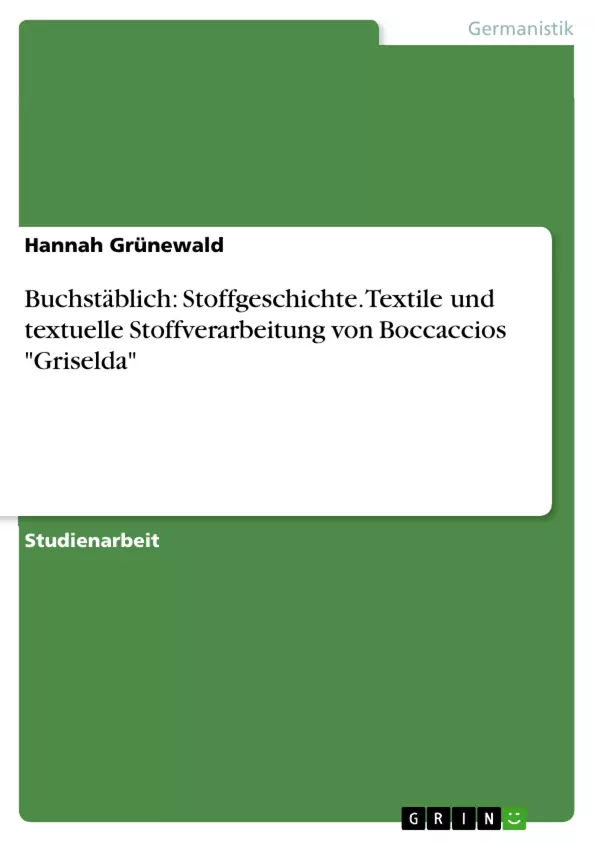Wenn von ,,Stoffgeschichte‘‘ die Rede ist, dann ist damit eine Auseinandersetzung mit historisch tradierten, immer wiederkehrenden und in Variation erscheinenden literarischen Stoffen gemeint, deren Entstehung und Veränderung im Hauptaugenmerk der Forschung zirkuliert. Als Boccaccio zwischen 1348 und 1353 seinen Novellenzyklus "Das Dekameron" auf italienischer Sprache verfasste, der im Jahre 1470 erstmals gedruckt wurde, brachte er den Stoff der geduldigen, duldsamen Griselda erstmals zu Papier.
Die Erzählung der Griselda macht das Thema „Stoff“ in mehreren analytischen Ansätzen fruchtbar; sie ist der, zumindest schriftlich überlieferte, Ursprungsort für alle weiteren Griselda-Variationen des Stoffes. Daneben wird stoffliche Präsenz im wahrsten Sinne thematisch behandelt; der Tausch ihrer bäuerlichen Kleider mit der höfischen Tracht ist textile Stoffverarbeitung, die die Erzähltradition als Motiv immer wieder aufgreift. Textile Tauschgeschäfte sind Anlass einer Auseinandersetzung mit dem Motiv des Kleidertausches der mittelalterlichen Epik, die vor allem in dem literarischen Gegenstand des Geschlechtertauschs auftaucht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitende Bemerkung
- Stoffgeschichte Griselda
- Die Anfänge: Boccaccio und Petrarca
- Deutschsprachige Variationen
- Nachfolgende Adaptionen
- Kleidertausch im Mittelalter
- Kleidertauschszenarien bei Griselda und Grisardis
- Wahl der Ehefrau und Kleidertauschabsichten
- Heiratsantrag, Vermählung und Kleidertausch
- Griseldas Verstoßung und erneuter Kleidertausch
- Kleidertauschszenarien bei Griselda und Grisardis
- Der Stoff des Kleidungstauschs in Variation: Geschlechtertausch
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Vielschichtigkeit des Begriffs „Stoff“ im Kontext der Griselda-Erzählung. Der Fokus liegt auf der Stoffgeschichte der Griselda-Novelle, insbesondere auf mittelalterlichen Variationen, und auf der Bedeutung des Kleidertauschs als Mittel zur Charakterisierung und sozialen Positionierung in mittelalterlichen Texten.
- Die Stoffgeschichte der Griselda-Novelle
- Die Rolle von Boccaccio und Petrarca bei der Verbreitung des Stoffes
- Der Kleidertausch als Investitur in mittelalterlichen Texten
- Die Bedeutung des Kleidertauschs für die Charakterisierung und soziale Positionierung
- Der Kleidertausch im Kontext von Geschlechter- und Statustausch
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitende Bemerkung
Die Arbeit führt in das Thema „Stoffgeschichte“ ein und beschreibt die Bedeutung des Griselda-Stoffes für die Literaturgeschichte. Die Griselda-Erzählung wird als Ursprungspunkt für alle weiteren Griselda-Variationen vorgestellt. Der Kleidertausch in der Erzählung wird als „textile Stoffverarbeitung“ bezeichnet, die auf die Tradition des Kleidertauschs in der mittelalterlichen Epik verweist.
2. Stoffgeschichte der Griselda
Dieses Kapitel beleuchtet die Verbreitung des Griselda-Stoffes im Mittelalter. Es werden die Anfänge des Stoffes bei Boccaccio und Petrarca sowie die frühen deutschen Übersetzungen des Stoffes beleuchtet. Die Rezeption der Griselda-Erzählung wird als „stoffgeschichtliche Traditionslinie“ beschrieben, die bis ins 20. Jahrhundert fortgesetzt wurde.
2.1 Die Anfänge: Boccaccio und Petrarca
Boccaccio und Petrarca werden als die beiden zentralen Figuren der Stoffgeschichte der Griselda-Novelle vorgestellt. Boccaccio lieferte mit seiner Griselda-Novelle den Grundstein für alle weiteren Adaptionen, während Petrarca die Novelle ins Lateinische übersetzte und sie damit einem größeren, länderübergreifenden Publikum zugänglich machte.
2.2 Deutschsprachige Fassungen
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Rezeption des Griselda-Stoffes im deutschen Sprachraum. Die frühen Übersetzungen des Stoffes, die größtenteils von der lateinischen Fassung Petrarcas inspiriert waren, werden vorgestellt. Der Griselda-Stoff wird als erziehungstechnisch wertvoll beschrieben, da die handelnden Figuren sowohl den Adel als auch das Bürgertum repräsentieren.
3. Kleidertausch im Mittelalter
Dieses Kapitel untersucht den Kleidertausch als Motiv in der mittelalterlichen Epik. Es werden verschiedene Kleidertauschszenarien aus der Griselda-Erzählung und anderen mittelalterlichen Texten beleuchtet.
3.1 Kleidertauschszenarien bei Griselda und Grisardis
Dieses Kapitel untersucht die Bedeutung des Kleidertauschs für die Charakterisierung und soziale Positionierung von Griselda und Grisardis. Es wird gezeigt, dass der Kleidertausch in der Regel nicht zu einem dauerhaften Wechsel der charakteristischen Komponente einer literarischen Figur führt, sondern vielmehr der gesellschaftlichen Determinierung und persönlichen Disposition des Handelnden entspricht.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Arbeit sind: Stoffgeschichte, Griselda-Novelle, Boccaccio, Petrarca, Kleidertausch, mittelalterliche Epik, Geschlechtertausch, Statustausch, Investitur, Charakterisierung, soziale Positionierung.
Häufig gestellte Fragen
Wer brachte den Griselda-Stoff erstmals zu Papier?
Giovanni Boccaccio verfasste die Erzählung zwischen 1348 und 1353 als Teil seines Novellenzyklus „Das Dekameron“.
Welche Rolle spielt der Kleidertausch in der Griselda-Erzählung?
Der Tausch ihrer bäuerlichen Kleider gegen höfische Tracht symbolisiert ihre Investitur und ihren sozialen Aufstieg, während die spätere Rückgabe ihre Verstoßung markiert.
Warum ist Petrarcas lateinische Fassung so wichtig?
Petrarca übersetzte Boccaccios Novelle ins Lateinische, wodurch der Stoff europaweit bekannt wurde und als Vorlage für viele deutsche Übersetzungen diente.
Was bedeutet „Stoffgeschichte“ in diesem Kontext?
Es bezeichnet die Untersuchung historisch tradierter literarischer Motive, die über Jahrhunderte hinweg in immer neuen Variationen erscheinen.
Wird in der Arbeit auch der Geschlechtertausch thematisiert?
Ja, die Arbeit untersucht den Kleidertausch als literarisches Motiv, das auch in Szenarien des Geschlechter- und Statustauschs in der mittelalterlichen Epik vorkommt.
- Citation du texte
- Hannah Grünewald (Auteur), 2017, Buchstäblich: Stoffgeschichte. Textile und textuelle Stoffverarbeitung von Boccaccios "Griselda", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/887210