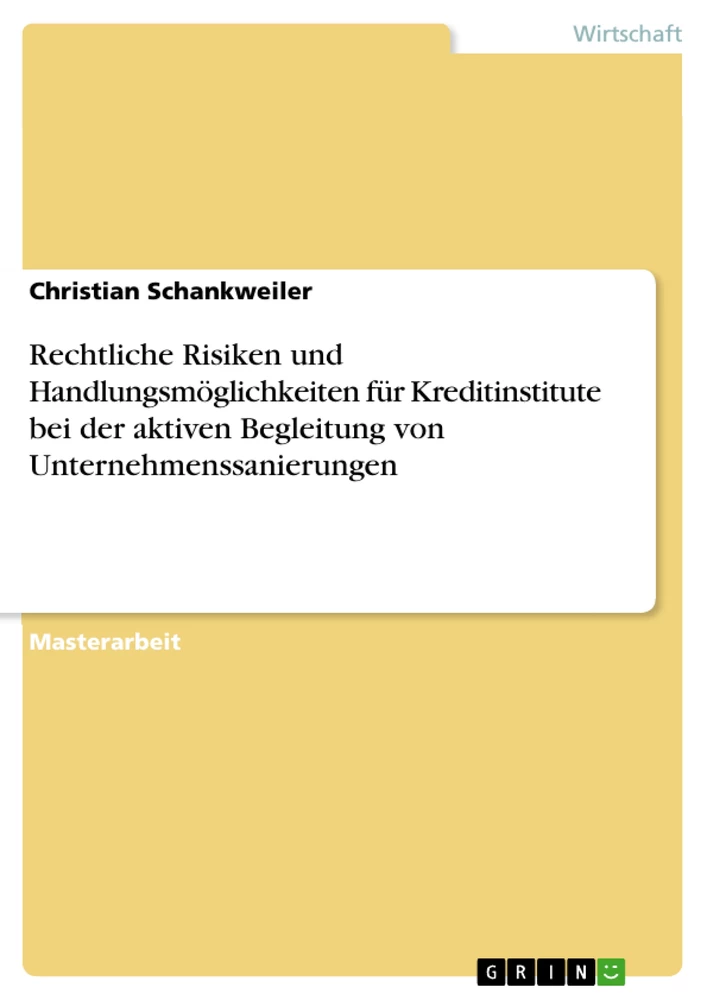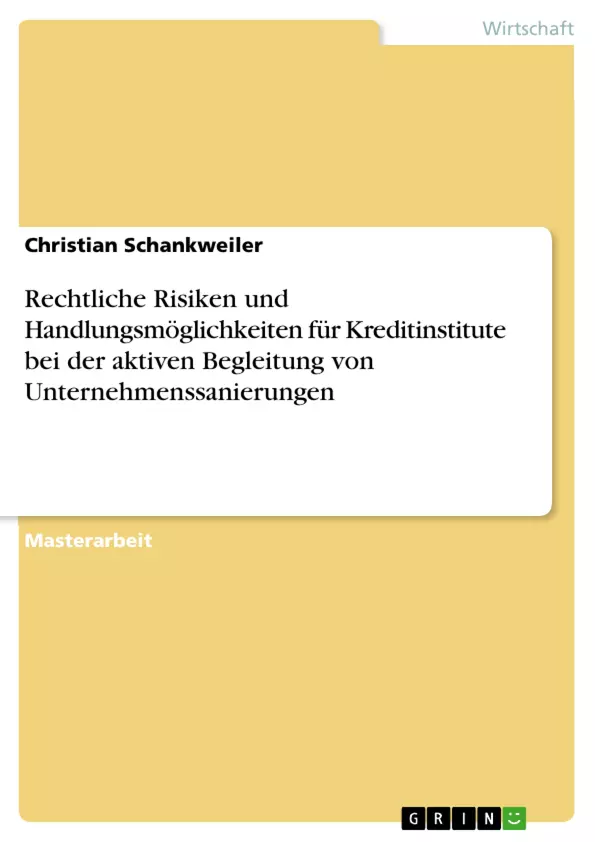Eine Bank, die einem in die Krise geratenen Unternehmen mit Kredit zur Verfügung steht, wird sich zunächst über die vorliegende Krise und ihre eigenen Handlungsmöglichkeiten ein Bild machen. Bei der dann zu treffenden Entscheidung, ob z. B. ein weiterer Kredit zur Verfügung gestellt wird, handelt es sich um eine betriebswirtschaftliche Investitionsentscheidung. Liegt der erwartete Vorteil aus der neuen Finanzierung über dem einzugehenden Risiko, besteht wirtschaftlich betrachtet die Möglichkeit, den Kredit zu vergeben.
Als Vorteile könnten dabei die Rückführung von alten Krediten, die ansonsten möglicherweise gefährdet ist, oder neu zu bestellenden Sicherheiten in die Berechnung einfließen. Dem ist die Höhe des neu zu vergebenden Kredites gegenüber zu stellen. Soweit die wirtschaftlichen Probleme des Schuldnerunternehmens durch die Sanierung behoben werden können, wird sich dabei regelmäßig kein Problem ergeben.
Im Falle des Scheiterns der Sanierung aber liegen die Probleme auf der Hand. Ist es der Bank gelungen, ihr eigenes Kreditrisiko kurz vor dem Zusammenbruch des Unternehmens durch Tilgungen oder neue Sicherheiten zu reduzieren, wird sie sich häufig dem Vorwurf ausgesetzt sehen, sie habe in letzter Minute ihre eigene Position auf Kosten der Gläubiger verbessert. Diesen stehen die zur Kreditrückführung eingesetzten Mittel bzw. die gestellten Sicherheiten nämlich dann nicht mehr zu ihrer eigenen Befriedigung zur Verfügung.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Informationslage nach der gescheiterten Sanierung deutlich komfortabler als zur Zeit der Kreditentscheidung ist. Einer getroffenen Entscheidung wird man später, wenn feststeht, dass die Maßnahme gescheitert ist, deutlich kritischer gegenüberstehen. Eine Überprüfung ex-post wird daher häufig zu dem Vorwurf führen, dass bereits vor Kreditentscheidung hätte klar sein müssen, dass die Sanierung scheitern wird. Die ex-ante-Entscheidung, ob eine Sanierung begleitet werden soll, bereitet dabei hingegen wegen der häufig anzutreffenden unbefriedigenden Informationslage ungleich größere Schwierigkeiten. Dies vor allem auch, weil häufig unter hohem Zeitdruck zu entscheiden ist.
Die dabei entstehenden rechtlichen Risiken und entsprechende Möglichkeiten zur Vermeidung dieser Risiken sind Gegenstand der vorliegenden Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Teil 1: Thema und Abhandlung
- A Problemstellung
- I. Wachsende Anzahl von Sanierungsversuchen
- II. Interessenkollision
- B Ziel und Aufbau der Arbeit
- I. Zielsetzung und Abgrenzung
- II. Gang der Arbeit
- Teil 2: Falldefinition und rechtliche Würdigung
- A Krise und grundsätzliche Handlungsmöglichkeiten für Banken
- I. Das Unternehmen in der Krise
- II. Handlungsalternativen für Kreditinstitute
- III. Gegenstand der Untersuchung
- B Rechtliche Würdigung
- I. Insolvenzanfechtung InsO
- II. Sittenwidriger Sanierungskredit
- III. aa) Objektive Voraussetzung (Naheliegende Benachteiligung)
- III. bb) Subjektive Voraussetzungen
- III. cc) Rechtsfolge
- Teil 3: Ergebnis und Handlungsempfehlung
- A Festgestellte Rechtsrisiken
- B Handlungsempfehlungen
- I. Grundsätzliche Empfehlungen
- II. Umsetzung in der Kreditpraxis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die rechtlichen Risiken und Handlungsmöglichkeiten von Kreditinstituten bei der aktiven Begleitung von Unternehmenssanierungen. Sie beleuchtet die Interessenkollisionen zwischen den Banken und anderen Gläubigern und analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen, insbesondere im Hinblick auf die Insolvenzanfechtung und die Frage sittenwidriger Sanierungskredite.
- Rechtliche Risiken für Banken bei Unternehmenssanierungen
- Insolvenzanfechtung nach dem Insolvenzrecht (InsO)
- Sittenwidrigkeit von Sanierungskrediten nach BGB
- Handlungsalternativen für Kreditinstitute in Krisensituationen
- Entwicklung von Handlungsempfehlungen für die Kreditpraxis
Zusammenfassung der Kapitel
Teil 1: Thema und Abhandlung: Dieser einführende Teil beschreibt die Problemstellung, ausgehend von der wachsenden Anzahl an Unternehmenssanierungen und den damit verbundenen Interessenkonflikten für Kreditinstitute. Er definiert die Zielsetzung der Arbeit und skizziert den methodischen Aufbau.
Teil 2: Falldefinition und rechtliche Würdigung: Dieser zentrale Teil analysiert zunächst die verschiedenen Krisensituationen von Unternehmen und die Handlungsmöglichkeiten der Banken (Stillhalten, Kündigung, Neukreditvergabe). Im Anschluss erfolgt eine detaillierte rechtliche Würdigung der Insolvenzanfechtung nach InsO, differenziert nach kongruenter und inkongruenter Deckung sowie vorsätzlicher Benachteiligung. Es wird eingehend auf die relevanten Tatbestandsmerkmale und Rechtsfolgen eingegangen. Schließlich untersucht der Teil die Problematik sittenwidriger Sanierungskredite unter den Gesichtspunkten von § 138 und § 826 BGB, wobei die objektiven und subjektiven Voraussetzungen detailliert erläutert werden.
Teil 3: Ergebnis und Handlungsempfehlung: Dieser Teil fasst die ermittelten Rechtsrisiken zusammen und leitet daraus konkrete Handlungsempfehlungen für Kreditinstitute ab. Es werden sowohl grundsätzliche Empfehlungen als auch praxisnahe Hinweise zur Gestaltung von Sanierungsgutachten, Kreditprüfung und der Gewährung von Überbrückungskrediten gegeben.
Schlüsselwörter
Unternehmenssanierung, Kreditinstitute, Insolvenzanfechtung, InsO, Sittenwidrigkeit, § 138 BGB, § 826 BGB, Sanierungskredit, Rechtsrisiken, Handlungsempfehlungen, Gläubigerbenachteiligung, Zahlungsunfähigkeit, Kongruente Deckung, Inkongruente Deckung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Rechtliche Risiken und Handlungsmöglichkeiten von Kreditinstituten bei Unternehmenssanierungen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die rechtlichen Risiken und Handlungsmöglichkeiten von Kreditinstituten, wenn sie Unternehmen bei Sanierungen aktiv begleiten. Im Fokus stehen die Interessenkonflikte zwischen Banken und anderen Gläubigern sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen, insbesondere die Insolvenzanfechtung und die Frage sittenwidriger Sanierungskredite.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: rechtliche Risiken für Banken bei Unternehmenssanierungen, Insolvenzanfechtung nach Insolvenzordnung (InsO), Sittenwidrigkeit von Sanierungskrediten nach Bürgerlichem Gesetzbuch (BGB), Handlungsalternativen für Kreditinstitute in Krisensituationen und die Entwicklung von Handlungsempfehlungen für die Kreditpraxis.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in drei Teile: Teil 1 (Thema und Abhandlung) führt in die Problemstellung ein und beschreibt die Zielsetzung. Teil 2 (Falldefinition und rechtliche Würdigung) analysiert Krisensituationen von Unternehmen, die Handlungsmöglichkeiten der Banken und die rechtlichen Aspekte der Insolvenzanfechtung nach InsO sowie sittenwidriger Sanierungskredite nach BGB. Teil 3 (Ergebnis und Handlungsempfehlung) fasst die Rechtsrisiken zusammen und gibt konkrete Handlungsempfehlungen für Kreditinstitute.
Welche rechtlichen Aspekte werden im Detail untersucht?
Die Arbeit untersucht detailliert die Insolvenzanfechtung nach InsO, differenziert nach kongruenter und inkongruenter Deckung sowie vorsätzlicher Benachteiligung. Es wird auf die Tatbestandsmerkmale und Rechtsfolgen eingegangen. Die Problematik sittenwidriger Sanierungskredite wird unter den Gesichtspunkten von § 138 und § 826 BGB analysiert, inklusive der objektiven und subjektiven Voraussetzungen.
Welche Handlungsempfehlungen werden gegeben?
Die Arbeit enthält sowohl grundsätzliche Empfehlungen als auch praxisnahe Hinweise für Kreditinstitute. Diese beziehen sich auf die Gestaltung von Sanierungsgutachten, die Kreditprüfung und die Gewährung von Überbrückungskrediten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Unternehmenssanierung, Kreditinstitute, Insolvenzanfechtung, InsO, Sittenwidrigkeit, § 138 BGB, § 826 BGB, Sanierungskredit, Rechtsrisiken, Handlungsempfehlungen, Gläubigerbenachteiligung, Zahlungsunfähigkeit, Kongruente Deckung, Inkongruente Deckung.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Kreditinstitute, Rechtsanwälte, Unternehmensberater und alle, die sich mit den rechtlichen Aspekten von Unternehmenssanierungen auseinandersetzen.
Wo finde ich weitere Informationen?
(Hier könnten Sie einen Link zu einem vollständigen Dokument oder einer weiterführenden Literatur hinzufügen)
- Citation du texte
- Christian Schankweiler (Auteur), 2008, Rechtliche Risiken und Handlungsmöglichkeiten für Kreditinstitute bei der aktiven Begleitung von Unternehmenssanierungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88738