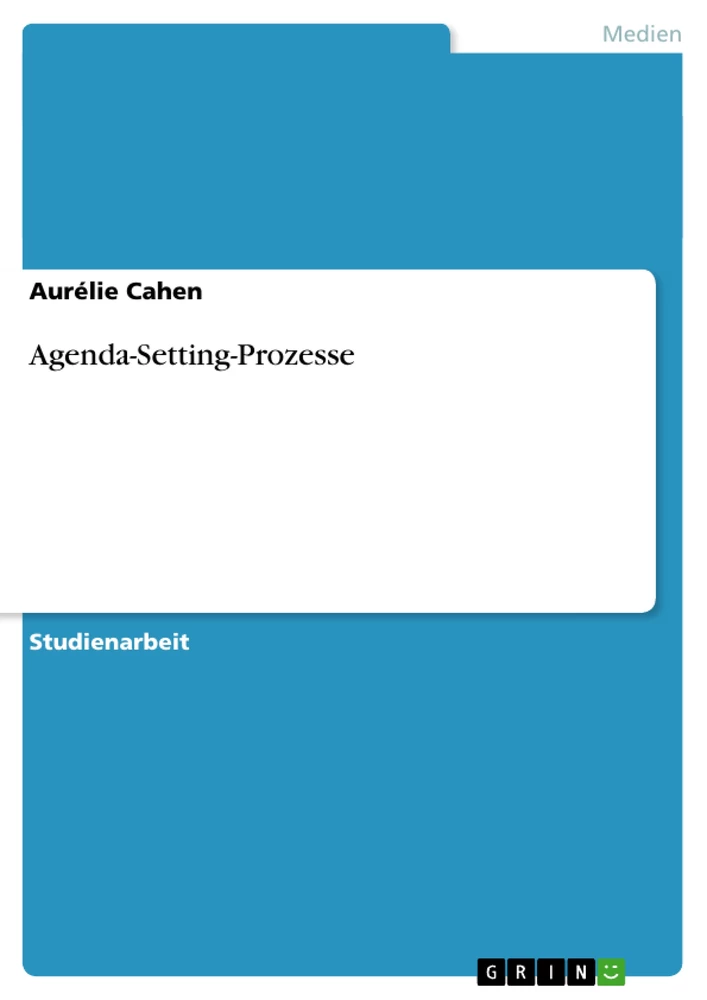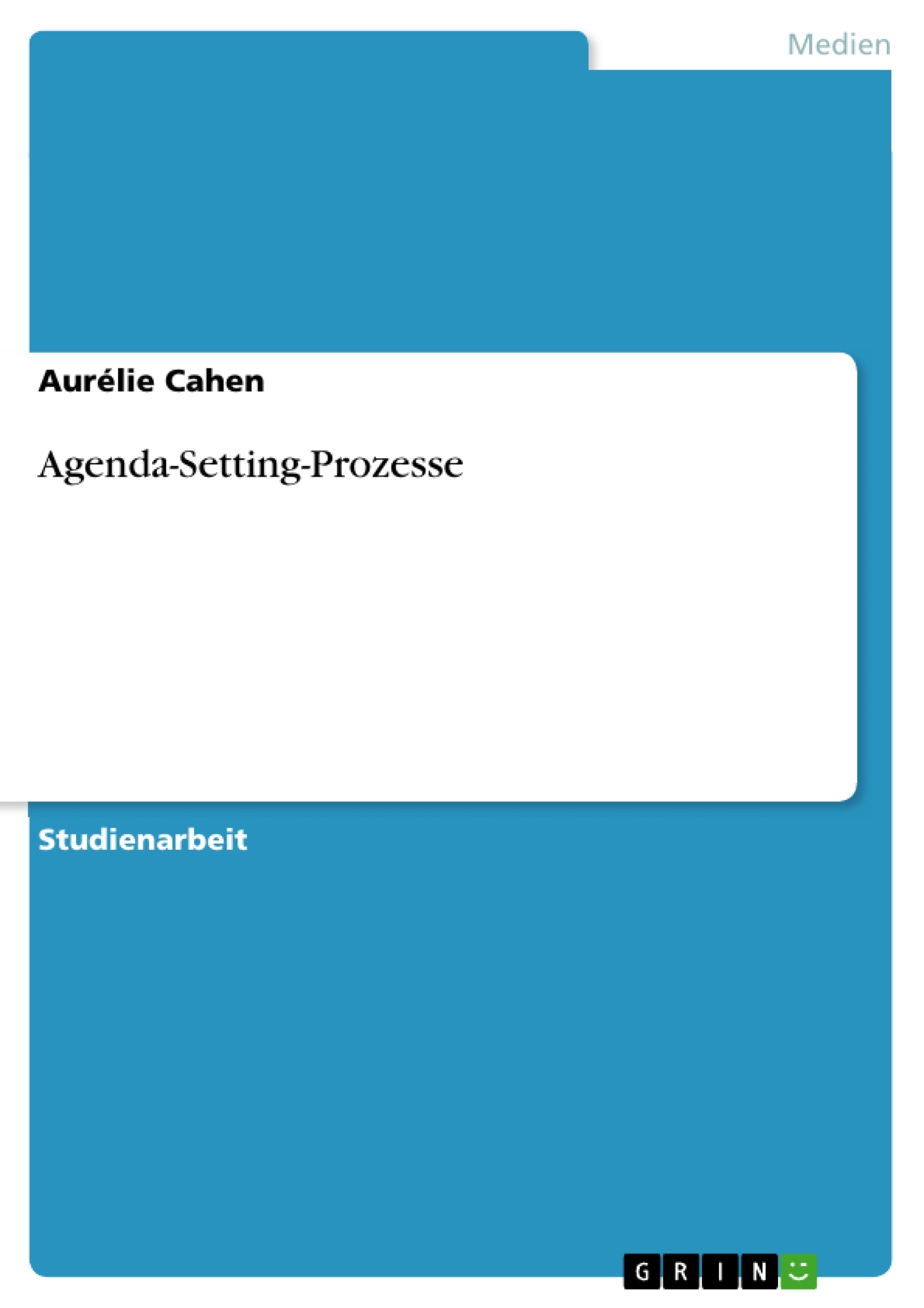Nachdem verschiedene Studien der Nachkriegszeit keinen unmittelbaren Einfluß der Massenmedien auf die Einstellungen oder das Verhalten der Rezipienten nachweisen konnten, herrschte in der Medienwirkungsforschung in den fünfziger und sechziger Jahren die Vorstellung von schwachen bzw. fehlenden Medienwirkungen. Anfang der siebziger Jahre wurde jedoch von verschiedener Seite die Wirkungslosigkeit der Medien in Frage gestellt, da die eigenen Erfahrungen in einer immer stärker von den Medien geprägten Gesellschaft der schwachen bzw. fehlenden Medienwirkungen widersprachen. Ein Ausweg fand sich schließlich in der Vermutung, daß die auf den Nachweis von Einstellungsänderungen fixierte Forschung vielleicht Medieneffekte übersehen hatte. Das Forschungsinteresse verlagerte sich von der Einstellungs- und Verhaltensänderung hin zur Informationsverarbeitung, wobei die sich gleichzeitig vollziehende, kognitive Wende in der psychologischen Forschung von großem Einfluß gewesen sein sollte. Eine der sichtbarsten Neuorientierungen in der Kommunikations-forschung Anfang der siebziger Jahre stellt der Agenda-Setting-Ansatz dar.
Den Begriff "Agenda-Setting" prägten die amerikanischen Wissenschaftler Maxwell E. McCombs und Donald L. Shaw. In ihren 1972 veröffentlichten Aufsatz ,,The Agenda-Setting Function of Mass Media." formulierten sie die Agenda-Setting-Hypothese wie folgt:
"While the mass media may have little influence on the direction or intensity of attitudes, it is hypothesized that the mass media set the agenda for each political campaign, influencing the salience of attitudes toward the political issues."
(Mc Combs/Shaw, 1972, S. 177)
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Agenda-Setting-Forschung
- Die „Chapel Hill\" Studie
- Methode der Agenda-Setting-Forschung
- Ergebnisse der Agenda-Setting-Forschung
- Eine Agenda-Setting-Theorie
- Definition der zentralen Begriffe
- „Themen“
- „Wichtigkeit“
- Agenda-Setting-Prozesse
- Gesellschaftliche Konsequenzen
- Definition der zentralen Begriffe
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Agenda-Setting-Ansatz in der Kommunikationswissenschaft. Sie beleuchtet die Entstehung und Entwicklung dieser Theorie, beginnend mit der bahnbrechenden „Chapel Hill“-Studie. Die Arbeit analysiert die Methodik der Agenda-Setting-Forschung und deren empirische Ergebnisse. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der theoretischen Fundierung des Ansatzes, insbesondere der Definition zentraler Begriffe wie „Themen“ und „Wichtigkeit“, sowie der Entwicklung eines Wirkungsmodells. Abschließend werden gesellschaftliche Konsequenzen der Agenda-Setting-Funktion der Massenmedien diskutiert.
- Die „Chapel Hill“-Studie als Ausgangspunkt der Agenda-Setting-Forschung
- Methoden und Ergebnisse der empirischen Agenda-Setting-Forschung
- Theoretische Fundierung des Agenda-Setting-Ansatzes
- Definition der zentralen Begriffe „Themen“ und „Wichtigkeit“
- Gesellschaftliche Konsequenzen der Agenda-Setting-Funktion der Medien
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung skizziert den Wandel in der Medienwirkungsforschung von der Annahme schwacher Medienwirkungen hin zum Agenda-Setting-Ansatz. Sie führt den Begriff ein und beschreibt die anfängliche Formulierung der Agenda-Setting-Hypothese durch McCombs und Shaw, welche die These aufstellt, dass die Medien zwar keinen direkten Einfluss auf Einstellungen haben, aber die Wichtigkeit von Themen beeinflussen. Die Einleitung hebt die Bedeutung der Arbeit von Eichhorn hervor, der versucht, die empirischen Ergebnisse zu einer Theorie zu verschmelzen. Sie beschreibt den Aufbau der Arbeit, welcher die "Chapel Hill"-Studie, die Methode und Ergebnisse der Agenda-Setting-Forschung sowie die theoretische Fundierung durch Eichhorn umfasst.
Die Agenda-Setting-Forschung: Dieses Kapitel präsentiert die „Chapel Hill“-Studie von McCombs und Shaw als ersten empirischen Beleg für die Agenda-Setting-Hypothese. Die Studie, die während eines US-amerikanischen Präsidentschaftswahlkampfes durchgeführt wurde, kombinierte Befragungen von Wählern mit einer Inhaltsanalyse von Massenmedien. Durch den Vergleich der „Publikumsagenda“ (wichtige Themen für Wähler) und der „Medienagenda“ (Berichterstattung der Medien) konnte ein Zusammenhang zwischen der Berichterstattung und der öffentlichen Wahrnehmung der Wichtigkeit von Themen nachgewiesen werden. Das Kapitel beschreibt detailliert die Methodik der Studie und diskutiert die Ergebnisse, die die Grundlage für die weitere Agenda-Setting-Forschung bildeten. Es stellt die Verbindung zwischen der empirischen Untersuchung und der daraus resultierenden Theoriebildung her.
Eine Agenda-Setting-Theorie: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Versuch, den Agenda-Setting-Ansatz theoretisch zu fundieren, hauptsächlich basierend auf der Arbeit von Eichhorn. Es geht detailliert auf die Definition der zentralen Begriffe „Themen“ und „Wichtigkeit“ ein und zeigt, wie diese Konzepte im Kontext der kognitiven Psychologie verstanden werden können. Das Kapitel entwickelt ein Wirkungsmodell der Agenda-Setting-Prozesse, das die Interaktion zwischen Medien, Individuen und der Gesellschaft beschreibt. Die Erörterung der gesellschaftlichen Konsequenzen der Agenda-Setting-Funktion der Massenmedien schließt dieses Kapitel ab und verdeutlicht den Einfluss der Medien auf die öffentliche Meinungsbildung und die politische Agenda.
Schlüsselwörter
Agenda-Setting, Massenmedien, Medienwirkung, „Chapel Hill“-Studie, McCombs & Shaw, Themensetzung, öffentliche Meinung, Wichtigkeit, kognitive Psychologie, gesellschaftliche Konsequenzen, Medienagenda, Publikumsagenda, Informationsverarbeitung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Agenda-Setting
Was ist der Gegenstand des Textes?
Der Text bietet eine umfassende Übersicht über den Agenda-Setting-Ansatz in der Kommunikationswissenschaft. Er behandelt die Entstehung, Entwicklung und theoretische Fundierung dieser Theorie, beginnend mit der "Chapel Hill"-Studie. Der Fokus liegt auf der Methodik der Agenda-Setting-Forschung, ihren empirischen Ergebnissen und den gesellschaftlichen Konsequenzen der Medienagenda.
Welche Studien und Theorien werden im Text behandelt?
Der Text konzentriert sich hauptsächlich auf die "Chapel Hill"-Studie von McCombs und Shaw als Ausgangspunkt der Agenda-Setting-Forschung. Diese Studie wird detailliert beschrieben, inklusive Methodik und Ergebnissen. Darüber hinaus wird die theoretische Arbeit von Eichhorn zur Fundierung des Agenda-Setting-Ansatzes behandelt, insbesondere seine Definition zentraler Begriffe wie "Themen" und "Wichtigkeit" und die Entwicklung eines Wirkungsmodells.
Welche zentralen Begriffe werden definiert?
Der Text definiert zentrale Begriffe des Agenda-Setting-Ansatzes, darunter "Themen" und "Wichtigkeit". Diese Definitionen werden im Kontext der kognitiven Psychologie erläutert und in das Wirkungsmodell integriert.
Welche Methoden werden in der Agenda-Setting-Forschung verwendet?
Der Text beschreibt die Methodik der "Chapel Hill"-Studie, die eine Kombination aus Befragungen von Wählern und Inhaltsanalysen von Massenmedien umfasste. Diese Methode ermöglicht den Vergleich der "Publikumsagenda" und der "Medienagenda", um Zusammenhänge zwischen Medienberichterstattung und öffentlicher Meinungsbildung aufzuzeigen.
Welche Ergebnisse liefert die Agenda-Setting-Forschung?
Die "Chapel Hill"-Studie und die darauf aufbauende Forschung zeigen einen Zusammenhang zwischen der Berichterstattung der Massenmedien und der Wahrnehmung der Wichtigkeit von Themen in der Öffentlichkeit. Die Medien beeinflussen also nicht direkt Einstellungen, sondern die Themen, die als wichtig erachtet werden.
Welche gesellschaftlichen Konsequenzen werden diskutiert?
Der Text diskutiert die gesellschaftlichen Konsequenzen der Agenda-Setting-Funktion der Massenmedien, insbesondere ihren Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung und die politische Agenda. Die Medien spielen eine entscheidende Rolle bei der Auswahl und Gewichtung von Themen, die die öffentliche Debatte prägen.
Wie ist der Text aufgebaut?
Der Text gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Agenda-Setting-Forschung (mit Fokus auf der "Chapel Hill"-Studie), ein Kapitel zur theoretischen Fundierung des Agenda-Setting-Ansatzes und einen Schluss. Er enthält außerdem ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Für wen ist dieser Text gedacht?
Der Text richtet sich an Leser, die sich mit dem Agenda-Setting-Ansatz in der Kommunikationswissenschaft auseinandersetzen möchten. Er eignet sich für Studierende, Wissenschaftler und alle Interessierten, die ein vertieftes Verständnis dieses wichtigen Forschungsgebiets erwerben wollen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter umfassen: Agenda-Setting, Massenmedien, Medienwirkung, „Chapel Hill“-Studie, McCombs & Shaw, Themensetzung, öffentliche Meinung, Wichtigkeit, kognitive Psychologie, gesellschaftliche Konsequenzen, Medienagenda, Publikumsagenda, Informationsverarbeitung.
- Quote paper
- Aurélie Cahen (Author), 2002, Agenda-Setting-Prozesse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/8877