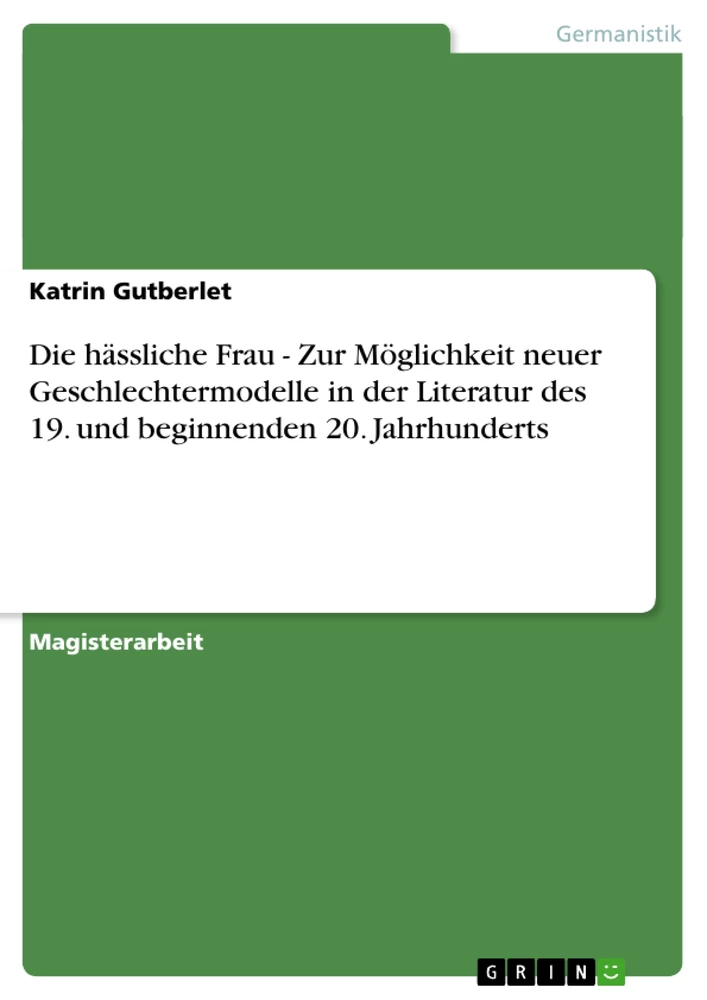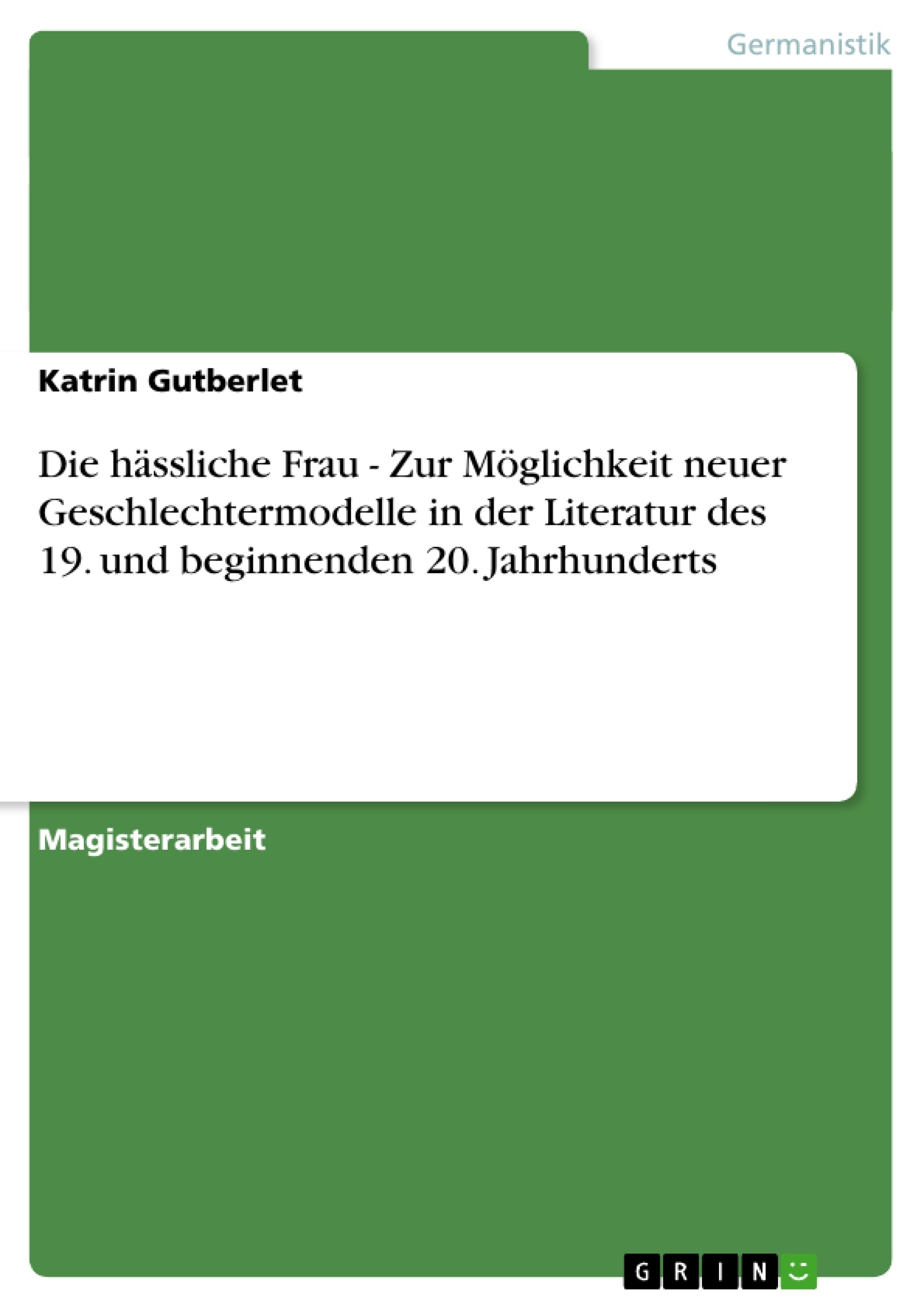„Die schöne Frau existiert nicht. Sie ist ein Produkt der männlichen Phantasie.
Mit diesen Worten beginnt Nicolaus Sombart seinen Beitrag über die schöne Frau und den männlichen Blick in der bildenden Kunst. Auch die hässliche Frau in der Literatur des 19. Jahrhunderts existiert nicht, sondern ist das Produkt einer Denkrichtung, die sich von der Zeit der idealisierten Klassik abwendet und ein Plädoyer für eine realistische Darstellung beinhaltet. Das Motiv der hässlichen Frau wird sowohl von männlichen als auch weiblichen Autoren aufgegriffen. Die ausgewählten Beispiele dieser Arbeit stammen alle aus der Feder von Männern, die einen Blick auf die hässliche Frau werfen.
Die Idee zu dieser Arbeit entstand während der Beschäftigung mit Adalbert Stifters Novelle Brigitta. Die gleichnamige Protagonistin war die erste als hässlich beschriebene Hauptfigur, der ich bis dahin begegnet war. Auf der Suche nach weiteren hässlichen Frauenfiguren fanden sich mehr Beispiele als erwartet, einige davon in der Trivialliteratur. Der größte Teil dieser Werke stammt aus dem 19. und beginnenden 20. Jahrhundert, was nicht zuletzt mit einer veränderten Einstellung über die Aufgabe von Literatur zusammenhängt.
Das Nachdenken über die Funktion der hässlichen Frau führte zu der Frage, mit welchen normativen Vorstellungen dieses Motiv bricht. Das weitere Vorgehen galt der Forschung nach dem Ursprung des Ausdrucks ‚das schöne Geschlecht‘. Dieser Weg führte mich in ein mir vollkommen neues Gebiet: die Wissenschaft der Philosophie, genauer der Ästhetik. Der Philosoph Edmund Burke stellte sich als Urheber dieses Begriffs heraus, der im 18. Jahrhundert die diskursive Einheit aus Schönheit, Weiblichkeit und männlichem Begehren prägte. Diese etablierte sich über das Jahrhundert hinaus auch in medizinischen oder naturwissenschaftlichen Themenfeldern.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- HINTERGRUND
- ZUR FORSCHUNG
- POETOLOGISCHE VERFAHREN
- schön / Schönheit
- hässlich / Hässlichkeit
- Resümee und Ausblick
- EXKURS: ÄSTHETIK – DAS SCHÖNE, DAS ERHABENE, DAS HÄSSLICHE
- BIBLIOGRAPHIE
- SCHÖNHEIT - WEIBLICHKEIT – BEGEHREN
- HÄSSLICHKEIT – MÄNNLICHKEIT – BEGEHREN
- HÄSSLICHE FRAUEN IN DER LITERATUR DES 19. (UND BEGINNENDEN 20.) JAHRHUNDERTS
- BRIGITTA
- Schönheit und Hässlichkeit
- Leidenschaft und Zähmung
- Versöhnung
- Resümee
- VICTOIRE
- Schönheit und Hässlichkeit
- Fontane und Rosenkranz
- Cross Dressing
- Resümee
- DUNJA
- Hässlichkeit
- Phantasma
- MARTHA
- Hysterie
- Tod
- RESÜMEE
- SCHLUSS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Motiv der hässlichen Frau in der Literatur des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. Sie untersucht, wie die Darstellung von Hässlichkeit die etablierten Geschlechterrollen in Frage stellt und welche neuen Möglichkeiten für die Konstruktion von weiblicher Identität eröffnet werden.
- Die Darstellung von Hässlichkeit in der Literatur
- Die Verbindung von Schönheit, Weiblichkeit und männlichem Begehren
- Der Bruch mit traditionellen Geschlechterrollen
- Die Entstehung neuer Geschlechtermodelle
- Die Analyse von ausgewählten literarischen Texten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit gliedert sich in zwei Teile. Im ersten Teil wird zunächst die Forschungsliteratur zum Motiv der hässlichen Frau beleuchtet. Dabei wird die Schwierigkeit, Schönheit und Hässlichkeit literarisch darzustellen, aufgezeigt. Es folgt eine Klärung der Begriffe „schön / Schönheit“ und „hässlich / Hässlichkeit“. Ein Exkurs behandelt die Entwicklung der Ästhetik als Wissenschaft und deren begriffliche Kategorien. Anschließend wird die Entstehung des Begriffs „das schöne Geschlecht“ anhand von Edmund Burkes „A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful“ untersucht. Der erste Teil endet mit einem Ausblick auf den zweiten Teil, der sich mit den literarischen Texten befasst.
Im zweiten Teil der Arbeit werden vier Texte behandelt, deren Hauptfiguren hässlich sind: Adalbert Stifters Novelle „Brigitta“, Theodor Fontanes „Schach von Wuthenow“, Thomas Manns „Gerächt“ und Ferdinand von Saars „Sappho“. Die Analyse dieser Texte untersucht, wie die Hässlichkeit der Frauen dargestellt wird und wie die traditionelle Verbindung von Schönheit, Weiblichkeit und Begehren aufgebrochen wird. Dabei werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den frühen Texten (Stifter, Fontane) und den späteren Texten (Mann, Saar) herausgearbeitet. Es zeigt sich, dass die frühen Texte die Möglichkeit einer neuen Geschlechterkonstruktion und damit eine Identität der Protagonistinnen außerhalb der bestehenden Normen implizieren, während die späteren Texte eher eine problematische Darstellung weiblicher Hässlichkeit bieten.
Schlüsselwörter
Hässliche Frau, Geschlechterrollen, Literatur, 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, Schönheit, Hässlichkeit, Ästhetik, Edmund Burke, Brigitta, Schach von Wuthenow, Gerächt, Sappho, weibliche Identität, neue Geschlechtermodelle.
- Citation du texte
- Katrin Gutberlet (Auteur), 2007, Die hässliche Frau - Zur Möglichkeit neuer Geschlechtermodelle in der Literatur des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88834