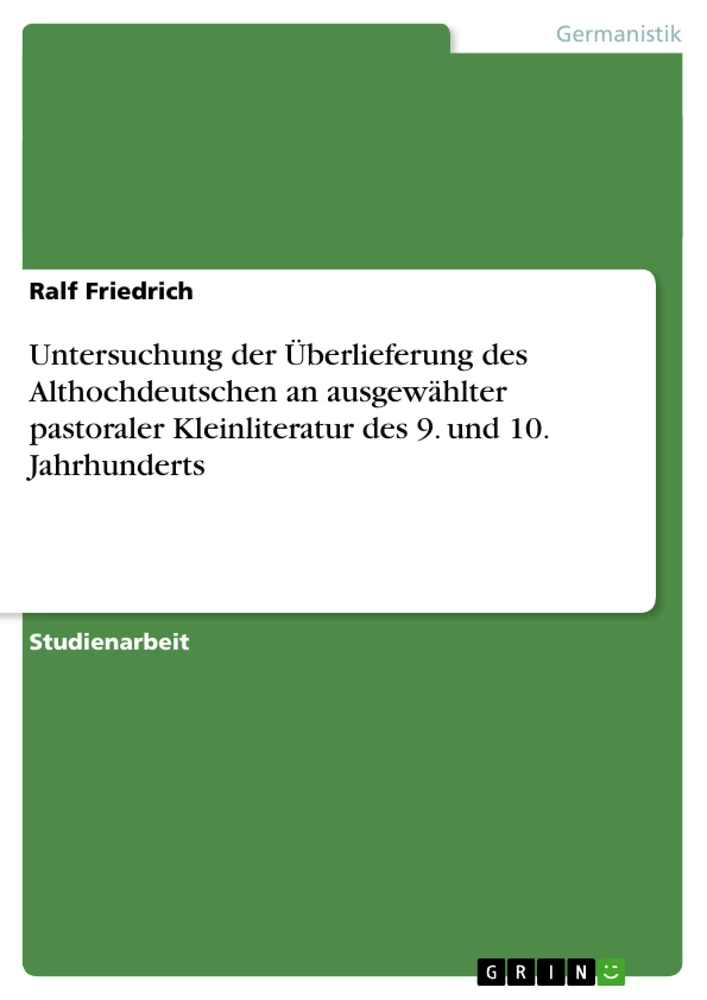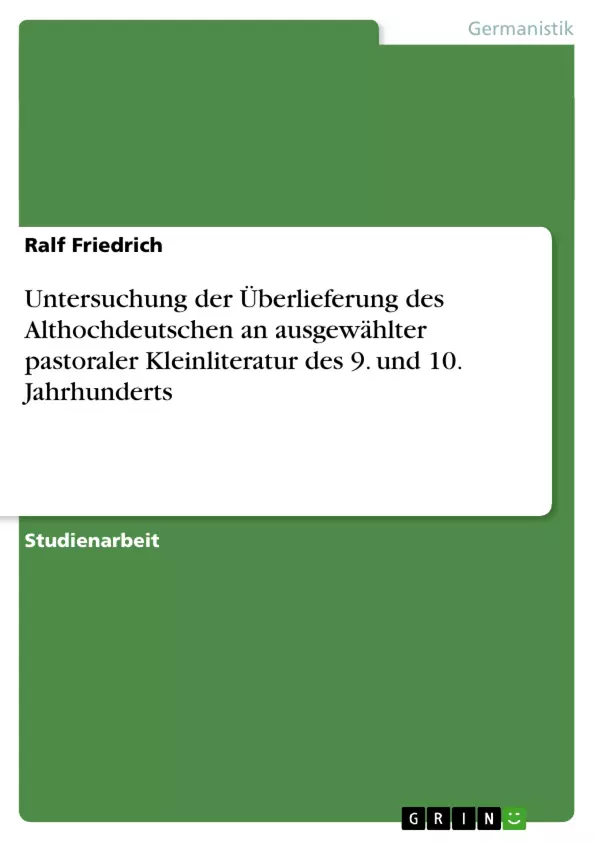1. Einleitung
Die deutsche Sprache, wie wir sie heute kennen und nutzen, war nicht immer von den Merkmalen geprägt, die sie heute charakterisieren. Sie weist eine fast 1500 Jahre alte Geschichte auf, die mit der Ausgliederung aus dem Germanischen beginnt und sich über viele Etappen weiterentwickelt hat. Besonders das Morphologische und Phonologische sind dabei betroffen. Doch auch, wenn diese Bereiche einzeln voneinander betrachtbar sind, bedeutet das nicht, dass eine Isolation vorgenommen werden kann. Eine Veränderung der Phonologie kann auf einer Veränderung der Morphologie beruhen oder jene hervorbringen. Ein Beispiel dafür ist der Laut- und Schriftwandel, der von der Rune 'Thorn' zum heutigen 'd' bekannt ist .1
Die Feststellung, dass Sprache nichts Statisches ist, sondern immer einer Veränderung unterzogen wird, kommt besonders in einem Zitat Hermann Pauls zum Ausdruck, der die Sprache und die Entwicklung unmittelbar miteinander in Verbindung bringt: “Es ist eingewendet, dass es noch eine andere wissenschaftliche Betrachtung der Sprache gäbe, als die geschichtliche. Ich muss das in Abrede stellen. Was man für eine nichtgeschichtliche und doch wissenschaftliche Betrachtung der Sprache erklärt, ist im Grunde nichts als eine unvollkommene geschichtliche, unvollkommen teils duch Schuld des Betrachters, teils durch Schuld des Beobachtungsmaterials. Sobald man über das bloße Konstatieren von Einzelheiten hinausgeht, sobald man versucht, den Zusammenhang zu erfassen, die Erscheinungen zu begreifen, so betritt man auch geschichtlichen Boden, wenn auch vielleicht ohne sich klar darüber zu sein.”2
1 Vgl. Meineke, Eckhard / Schwerdt, Judith: Einführung in das Althochdeutsche. Paderborn 2001, S. 237.
2 Paul, Hermann: Prinzipien der Sprachgeschichte, 8. Auflage. Tübingen 1968, S. 20.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Überlieferung des Althochdeutschen durch die Christianisierung Mitteleuropas
- Das karolingische Reich
- Missionierung und klösterliche Bildungsstätten
- Latein und Volkssprachen
- Rahmenbedingungen für die althochdeutsche Überlieferung
- Pastorale Kleinliteratur
- Paternoster und Credo
- Taufgelöbnisse
- Katechismus
- Gebete
- Beichten
- Predigt
- Priestereid
- Schluss
- Literatur
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Überlieferung des Althochdeutschen im Kontext der Christianisierung Mitteleuropas und betrachtet ausgewählte pastorale Kleinliteratur des 9. und 10. Jahrhunderts. Ziel ist es, die Bedeutung der Christianisierung für die Entstehung und Weitergabe des Althochdeutschen aufzuzeigen und den Einfluss der Kirche auf die Entwicklung der deutschen Sprache zu untersuchen.
- Das karolingische Reich als politischer und kultureller Rahmen für die Christianisierung
- Die Rolle der Missionierung und klösterlichen Bildungsstätten in der Verbreitung des Christentums und der Weitergabe von Wissen
- Der Sprachwandel vom Lateinischen zum Althochdeutschen und die Entstehung einer volkssprachlichen Literatur
- Die Verwendung pastoraler Kleinliteratur als Werkzeug zur religiösen Einheit und zur Übermittlung von christlichen Inhalten an die Bevölkerung
- Die Bedeutung der Überlieferung des Althochdeutschen für die Entwicklung der deutschen Sprache.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und beleuchtet die Entwicklung der deutschen Sprache und ihre Bedeutung für die vorliegende Arbeit. Das zweite Kapitel widmet sich der Überlieferung des Althochdeutschen im Kontext der Christianisierung Mitteleuropas und beleuchtet das karolingische Reich als politischen und kulturellen Rahmen für die Missionierung. Die Rolle der Missionierung und klösterlichen Bildungsstätten sowie der Sprachwandel vom Lateinischen zum Althochdeutschen werden erörtert. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der pastoralen Kleinliteratur und zeigt auf, welche Mittel der Klerus nutzte, um die Bevölkerung unter einer Religion zu einen. Die einzelnen Kapitel untersuchen die verschiedenen Genres der pastoralen Kleinliteratur, wie zum Beispiel das Paternoster, das Credo und die Gebete, und beleuchten ihre Bedeutung für die Übermittlung von christlichen Inhalten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt zentrale Themen wie die Geschichte der deutschen Sprache, die Christianisierung Mitteleuropas, das karolingische Reich, die Missionierung, die klösterliche Bildung, die Entstehung der althochdeutschen Literatur, pastorale Kleinliteratur und die Bedeutung der Überlieferung für die Entwicklung der deutschen Sprache. Die Arbeit untersucht die Wechselwirkungen zwischen Sprache, Religion und Kultur im frühen Mittelalter.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Einfluss hatte die Christianisierung auf die deutsche Sprache?
Die Christianisierung war der Hauptmotor für die schriftliche Überlieferung des Althochdeutschen, da kirchliche Inhalte für die Bevölkerung in die Volkssprache übersetzt werden mussten.
Was versteht man unter pastoraler Kleinliteratur?
Dazu zählen kurze religiöse Texte wie das Vaterunser (Paternoster), das Glaubensbekenntnis (Credo), Taufgelöbnisse, Gebete und Beichten in althochdeutscher Sprache.
Warum wurde vom Lateinischen ins Althochdeutsche übersetzt?
Um die christliche Lehre im karolingischen Reich effektiv zu verbreiten, musste der Klerus sicherstellen, dass auch die ungebildete Bevölkerung die grundlegenden religiösen Texte verstand.
Welche Rolle spielten die Klöster im 9. und 10. Jahrhundert?
Klöster waren die zentralen Bildungsstätten und Skriptorien, in denen Wissen bewahrt und die ersten althochdeutschen Texte niedergeschrieben wurden.
Was ist der „Priestereid“ im Kontext dieser Arbeit?
Es ist eines der untersuchten Beispiele für pastorale Texte, die zeigen, wie Amtshandlungen und religiöse Verpflichtungen sprachlich im Althochdeutschen fixiert wurden.
- Quote paper
- Ralf Friedrich (Author), 2007, Untersuchung der Überlieferung des Althochdeutschen an ausgewählter pastoraler Kleinliteratur des 9. und 10. Jahrhunderts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88836