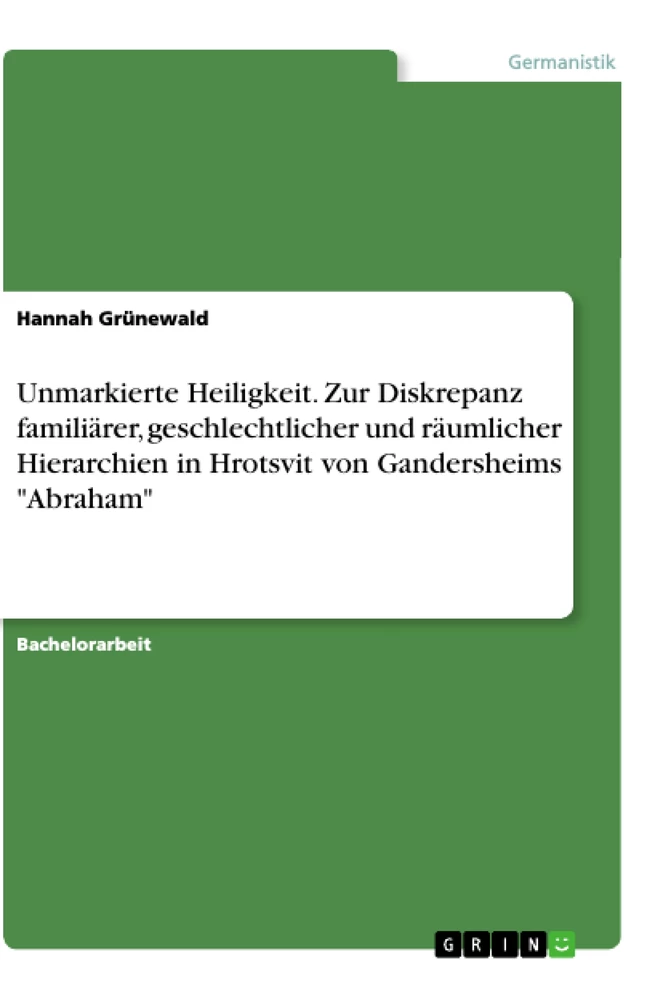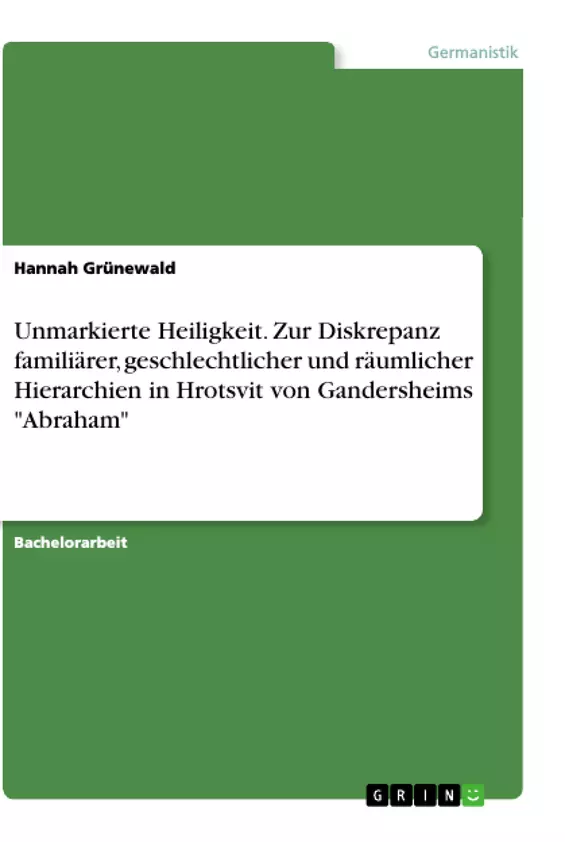Keuschheit und Sexualität, Religiosität und Missbrauch – das, was augenscheinlich wie ein Paradoxon daherkommt, ist in Wirklichkeit nicht nur ein allgegenwärtiges Thema in christlichen Zirkeln, sondern scheint, unabhängig von jedweder zeitlichen Disposition, Beständigkeit zu haben.
In Anbetracht der Tatsache, dass die Kanonissin und Schriftstellerin Hrotsvit von Gandersheim bereits im zehnten Jahrhundert in ihrem Drama Abraham weibliche Körper im Spannungsfeld von Religion und Erwartung, Missbrauch und Prostitution beleuchtet hat, lässt den Schluss zu, dass die Problematik so alt ist wie das religiöse Miteinander selbst. Ganz ähnlich wie in der Dokumentation, macht Hrotsvit in ihrem Werk auf literarische Weise deutlich, dass dem weiblichen Körper in kirchlichen Institutionen kaum Autonomie zukommt, dass Regeln eindeutig und Realitäten vieldeutig sind und dass ein Befreiungsmechanismus der Opfer nur durch große Vertrauensinvestitionen in Gott und den Glauben ihrerseits bewältigt werden kann. Die Sanktionierung der Täter ist hier wie da sekundär und zwingt gläubige Betroffene nicht nur die Misshandlung des Körpers zu verkraften, sondern das Vertrauen zu Gott zu erneuern.
Das Drama Abraham ist auf diverse Weisen zu untersuchen, da hier auch ein Diskurs zu Heiligkeit möglich ist, der die in Abhängigkeit von Hierarchien und vermeintlich etablierten gesellschaftlichen Strukturen analysierbar macht. Die vorliegende Arbeit möchte genau diesen Ansatz verfolgen und nach einer kurzen historischen Kontextualisierung, im ersten analytischen Schritt die Figurenkonstellation im Allgemeinen und damit das Verhältnis der weiblichen Protagonistin Maria zu ihren männlichen Antagonisten untersuchen. Dabei werden neben den impliziten Heiligkeitskonzeptionen, vor allem die kommunikativen Modi sowie narratologischen Besonderheiten untersucht, die wiederum die Vermutung bestätigen, dass es sich bei Marias Vergewaltiger um ihren Ziehvater Abraham handelt. In einem zweiten interpretatorischen Schritt wird die zentrale Fragestellung exponiert. Hier widmet sich die Arbeit der Frage nach der Diskrepanz der gezeigten familiären, geschlechtlichen, sowie raumtheoretischen Hierarchie, die durch einschlägige Literatur und Theorien belegt wird. Sowohl Analyse als auch Interpretation sollen die These veranschaulichen, die betont, dass entgegen geläufiger Erwartungen, das Heilige immer dort aufzufinden ist, wo es nicht erwartet, ja geradezu gesellschaftlich ausgeschlossen wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historische Kontextualisierung
- Gandersheim
- Leben, Wirken und Werke der Hrotsvit von Gandersheim
- Primärtextanalyse: Figurenkonstellation
- Effrem
- Abraham
- Brautvermittlung: Abraham der Oheim
- Tat und Täter
- Traum und Vorahnung
- Bekehrung im Bordell
- Interpretation: Unmarkierte Heiligkeit
- Heiligkeit
- Markiertheit und Hierarchie
- Unmarkierte Heiligkeit: Familie
- Unmarkierte Heiligkeit: Geschlecht
- Unmarkierte Heiligkeit: Räume
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert Hrotsvits von Gandersheims Drama Abraham im Hinblick auf die darin dargestellte Problematik von Heiligkeit und deren Abhängigkeit von familiären, geschlechtlichen und räumlichen Hierarchien. Der Fokus liegt dabei auf der Figur der Maria und ihrer Rolle im Spannungsfeld von religiösen Erwartungen und gesellschaftlichen Normen.
- Konzeptionen von Heiligkeit in der mittelalterlichen Gesellschaft
- Die Darstellung weiblicher Figuren im Werk Hrotsvits
- Das Verhältnis von Familie, Geschlecht und Raum in Bezug auf Heiligkeit
- Die Rolle von Traum und Vorahnung in der Erzählung
- Die Problematik von Missbrauch und Gewalt im Kontext religiöser Institutionen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die zentrale Problematik des Dramas Abraham vor und führt in die Thematik von Heiligkeit und Missbrauch ein. Das zweite Kapitel widmet sich der historischen Kontextualisierung, indem es Gandersheim als Ort des Geschehens und Leben und Werk Hrotsvits beleuchtet.
Kapitel 3 untersucht die Figurenkonstellation des Dramas. Dabei werden die Charaktere Effrem und Abraham im Hinblick auf ihre soziale Funktion und ihre Rolle in Bezug auf die Heiligkeitskonzeptionen analysiert. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf Abrahams Rolle als Oheim und Täter sowie auf Marias Bekehrung im Bordell.
Das vierte Kapitel interpretiert die Heiligkeit im Kontext des Dramas und analysiert deren Abhängigkeit von familiären, geschlechtlichen und räumlichen Hierarchien. Dabei wird die unmarkierte Heiligkeit der Maria als Gegenentwurf zu den etablierten gesellschaftlichen Strukturen betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Heiligkeit, Missbrauch, Geschlecht, Familie, Raum, Hrotsvit von Gandersheim, Abraham, Maria, mittelalterliche Gesellschaft, religiöse Institutionen, Traum und Vorahnung.
- Citation du texte
- Bachelor of Arts Hannah Grünewald (Auteur), 2019, Unmarkierte Heiligkeit. Zur Diskrepanz familiärer, geschlechtlicher und räumlicher Hierarchien in Hrotsvit von Gandersheims "Abraham", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/888631