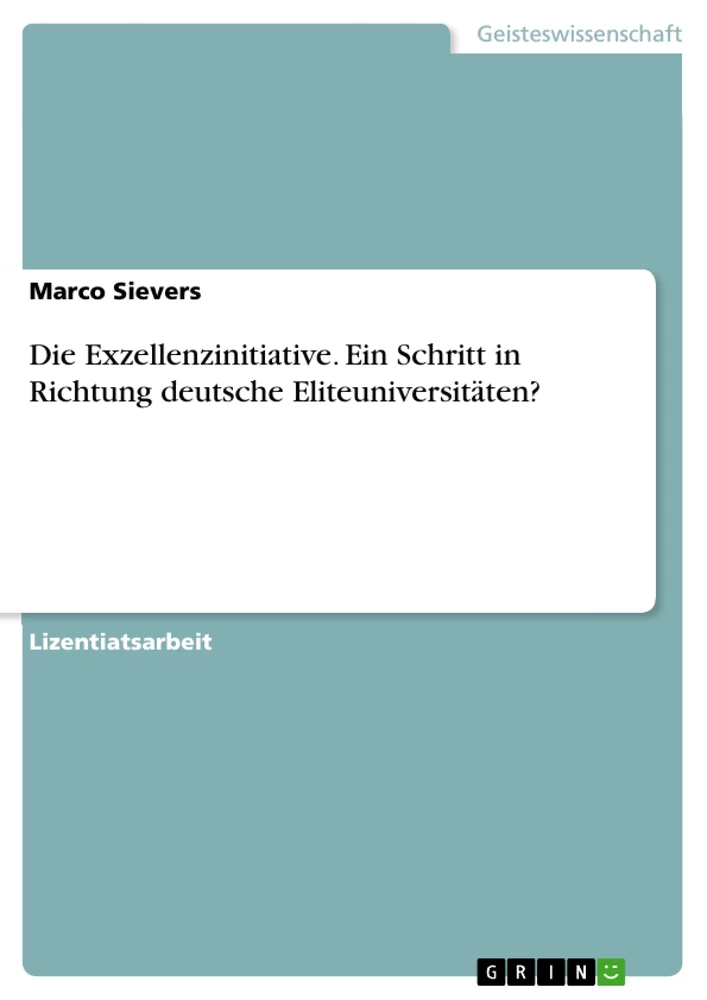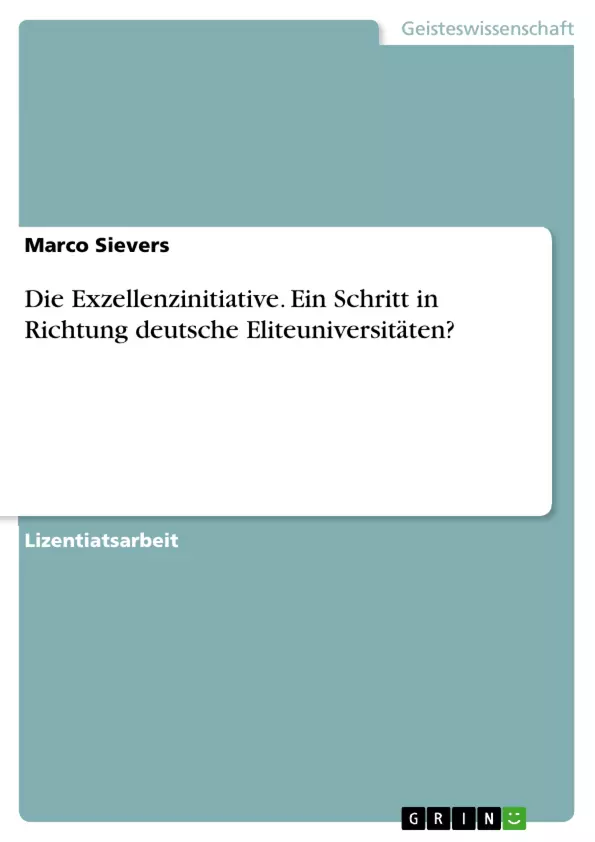Die von der Bundesregierung 2005 ins Leben gerufene Exzellenzinitiative sorgte nicht nur für kontroverse Diskussionen in der Wissenschafts- und Hochschulpolitik, sondern führte auch zu einer Renaissance des bis dato tot geglaubten Elitebegriffes im gesamtgesellschaftlichen Diskurs. Im Interesse der soziologischen Elitenforschung stellt sich indes die Frage, welche Auswirkungen die Förderung von Spitzenuniversitäten auf die bundesdeutschen Eliten haben wird.
Da sich die Bedeutung und das Ausmaß der Exzellenzinitiative erst im gesamtgesellschaftlichen und im historischen Kontext richtig verstehen lässt, wird die vorliegende Ausarbeitung zunächst den Stellenwert des Bildungssystems für das Elitenprofil einer Gesellschaft erörtern und darlegen, dass es derzeit noch keine Eliteuniversitäten in Deutschland gibt. Im Anschluss wird die Debatte um die Spitzenförderung, als der aktuelle Schauplatz des gesamtgesellschaftlichen Elitendiskurses, historisch verortet. Daran schließt sich eine genaue Darstellung der eigentlichen Exzellenzinitiative an, die deren Hintergründe beleuchtet und Kritikpunkte vorstellt. Abschließend sollen unter der Fragestellung, ob die Exzellenzinitiative ein Schritt zu deutschen Eliteuniversitäten ist, anhand von Thesen mögliche Auswirkungen der Initiative auf die Elitenstruktur der Bundesrepublik Deutschland angedacht werden.
Diese betreffen eine Annäherung der Spitzenuniversitäten an angloamerikanische und britische Vorbilder, eine zukünftige Hierarchisierung der Arbeitsmarktchancen, und mögliche Auswirkungen auf die Homogenität und Kohäsion der bundesrepublikanischen Eliten. Außerdem wird die Frage erörtert, ob die Einführung persönlichkeitsbezogener Zulassungskriterien eine Abkehr von meritokratischen Maßstäben und ein Einfallstor für eine neue Werteelite darstellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Die Bedeutung des Bildungssystems für das Elitenprofil einer Gesellschaft
- Die Nichtexistenz deutscher Elitebildungseinrichtungen
- Die Debatte um Spitzenuniversitäten als Schauplatz des gesellschaftlichen Elitediskurses
- Die historische Entwicklung des Elitendiskurses seit 1945 – Von der Bildungselite über die Massenuniversität bis zu den Spitzenuniversitäten.
- Die Problematik des Elitenbegriffes in der Nachkriegszeit
- Die Tabuisierung des Elitenbegriffes infolge von Bildungsexpansion und Studentenrevolution.
- Renaissance des Elitendiskurses in der Berliner Republik
- Die Exzellenzinitiative von Bund und Ländern
- Hochschulpolitischer Hintergrund – „Unterfinanzierte Massenuniversitäten“ und ,,katastrophale Studienbedingungen“.
- Orientierung an angloamerikanischen und britischen Vorbildern.
- Das Förderungsverfahren
- Hochschulpolitische Kritik and der Exzellenzinitiative..
- Dominanz des Mathäusprinzips....
- Benachteiligung der Geistes- und Sozialwissenschaften.
- Aufkommen einer akademische Zwei-Klassen-Gesellschaft und Verschärfung der sozialen Selektivität...
- Verfehlte Investitionspolitik.
- Die Exzellenzinitiative - Ein Schritt zu deutschen Eliteuniversitäten?
- Annäherung deutscher Spitzenhochschulen an angloamerikanische und britische Eliteinstitutionen.
- Hierarchisierung der Arbeitsmarktchancen....
- Steigerung der Homogenität und Stärkung der Kohäsion deutscher Eliten
- Persönlichkeitsbezogene Zulassungskriterien – Abkehr von meritokratischen Maßstäben und Einfallstor für eine neue Werteelite?.
- Zusammenfassung und Ausblick.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Exzellenzinitiative von Bund und Ländern und deren potenziellen Auswirkungen auf die deutsche Elitenstruktur. Sie untersucht, ob die Förderung von Spitzenuniversitäten zu einer Etablierung von Eliteuniversitäten in Deutschland führt und welche Folgen dies für die gesellschaftliche Zusammensetzung der Eliten hätte.
- Die Bedeutung des Bildungssystems für die Herausbildung und Reproduktion von Eliten in Deutschland
- Die historische Entwicklung des Elitendiskurses und die Debatte um Eliteuniversitäten in Deutschland
- Die Exzellenzinitiative als Fördermaßnahme für Spitzenuniversitäten und deren politischer Kontext
- Potenzielle Auswirkungen der Exzellenzinitiative auf die Elitenstruktur, wie z.B. die Annäherung an angloamerikanische Modelle, die Hierarchisierung von Arbeitsmarktchancen und die Homogenität der Eliten
- Die Frage der Persönlichkeitsbezogenen Zulassungskriterien und deren Einfluss auf die meritokratischen Maßstäbe
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Exzellenzinitiative als Ausgangspunkt für die Analyse des Elitenbegriffes in Deutschland dar. Sie argumentiert, dass die Initiative eine Renaissance des Elitenbegriffs im gesellschaftlichen Diskurs ausgelöst hat.
Der Hauptteil beginnt mit einer Erörterung der Bedeutung des Bildungssystems für das Elitenprofil einer Gesellschaft. Dabei wird betont, dass Hochschulen eine zentrale Rolle für den Zugang zu gesellschaftlichen Spitzenpositionen spielen. Der Abschnitt beleuchtet auch die Rolle von Pierre Bourdieu und seine These der Reproduktion sozialer Hierarchien durch das Bildungssystem.
Anschließend wird die Nichtexistenz von expliziten Elitebildungseinrichtungen in Deutschland untersucht. Es wird festgestellt, dass es zwar renommierte Universitäten gibt, deren Besuch jedoch nicht automatisch zu einer Privilegierung im Karriereweg führt.
Weiterhin wird die Debatte um Spitzenuniversitäten als Schauplatz des gesellschaftlichen Elitediskurses seit den späten 1990er Jahren analysiert. Die Diskussion um Eliteuniversitäten wird in Verbindung mit den Ergebnissen der PISA-Studien, welche dem deutschen Bildungssystem schlechte Noten ausstellten, gesehen.
In einem weiteren Abschnitt wird die historische Entwicklung des Elitendiskurses seit 1945 beleuchtet, angefangen von der Bildungselite über die Massenuniversität bis hin zur Idee der Spitzenuniversitäten.
Schließlich wird die Exzellenzinitiative selbst genauer betrachtet, wobei deren Hintergründe und Kritikpunkte, wie die Dominanz des Mathäusprinzips, die Benachteiligung der Geistes- und Sozialwissenschaften, die Entstehung einer akademischen Zwei-Klassen-Gesellschaft und verfehlte Investitionspolitik, beleuchtet werden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der Exzellenzinitiative und deren potenziellen Auswirkungen auf die deutsche Elitenstruktur. Die wichtigsten Schlüsselwörter sind somit: Exzellenzinitiative, Eliteuniversitäten, Bildungssystem, Elitenforschung, Elitendiskurs, Hochschulpolitik, Meritokratie, Sozialstruktur, Homogenität, Kohäsion, Persönlichkeitsbezogene Zulassungskriterien, Angloamerikanische Modelle, Arbeitsmarktchancen, PISA-Studien.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der deutschen Exzellenzinitiative?
Die 2005 ins Leben gerufene Initiative soll die Spitzenforschung an deutschen Universitäten fördern und die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Hochschulstandorts Deutschland stärken.
Gibt es in Deutschland echte Eliteuniversitäten?
Die Arbeit legt dar, dass es historisch keine expliziten Elitebildungseinrichtungen wie in den USA oder England gab, die Exzellenzinitiative jedoch ein Schritt in diese Richtung sein könnte.
Was wird an der Exzellenzinitiative kritisiert?
Kritikpunkte sind die Dominanz des "Matthäus-Prinzips" (wer hat, dem wird gegeben), die Benachteiligung der Geisteswissenschaften und die Entstehung einer akademischen Zwei-Klassen-Gesellschaft.
Wie beeinflusst die Initiative die soziale Selektivität?
Es wird diskutiert, ob durch persönlichkeitsbezogene Zulassungskriterien und die Hierarchisierung der Hochschulen die soziale Selektion zunimmt und meritokratische Maßstäbe aufgeweicht werden.
Welche Auswirkungen hat die Förderung auf den Arbeitsmarkt?
Die Arbeit stellt die These auf, dass der Abschluss an einer "Exzellenzuniversität" zukünftig zu einer Hierarchisierung der Arbeitsmarktchancen führen könnte, ähnlich wie bei angloamerikanischen Vorbildern.
- Arbeit zitieren
- Dipl.Jurist Marco Sievers (Autor:in), 2008, Die Exzellenzinitiative. Ein Schritt in Richtung deutsche Eliteuniversitäten?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88868