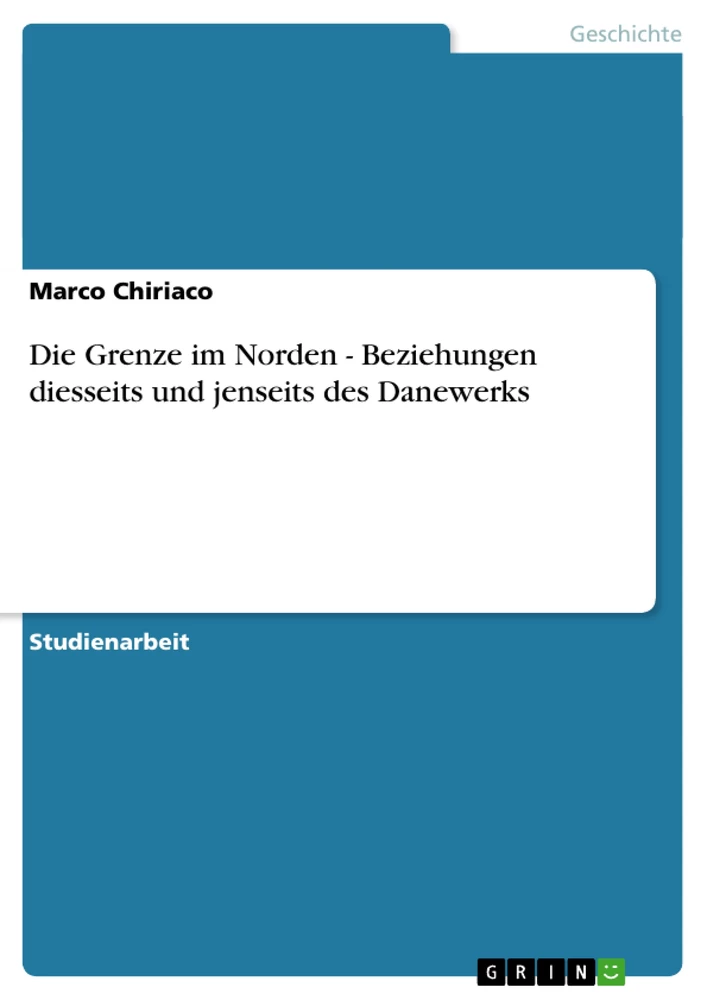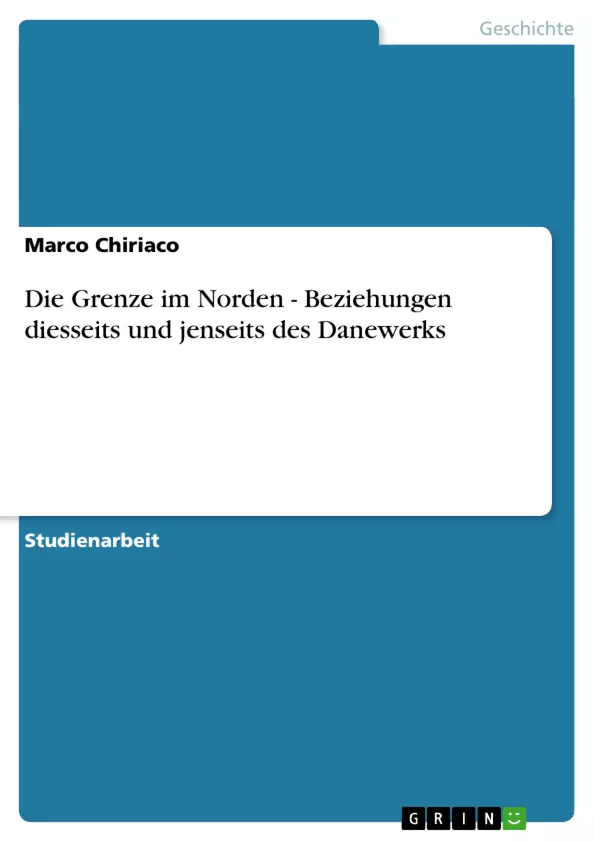Seit seiner Errichtung, spätestens jedoch seit dem siebten Jahrhundert nach Christus spielte das Danewerk eine besondere Rolle im Kontaktbereich der Franken einerseits und den Dänen andererseits. Nicht von den Franken wurde dieses Bollwerk errichtet, wie man etwa meinen könnte, um den heidnischen Völkern des Nordens eine Grenze aufzuweisen, sondern von den Menschen im Norden, um eine Grenze nach Süden zu ziehen.
Warum diese Grenze eingerichtet worden ist und was ihr Zweck sein sollte – mit dieser Frage möchte ich mich in meiner Arbeit nur peripher auseinander setzen. Vielmehr möchte ich versuchen, das Danewerk und den es umgebenden geographischen Raum dahingehend zu betrachten, inwiefern Kontakte zwischen Dänen und Franken erfolgten und welche Auswirkungen diese für das Zusammenleben hatten. Dazu werde ich punktuell die Aspekte bewaffneter Konflikt, Handel und Religion betrachten; diese in erster Linie aus der Sicht der Franken, für das neunte und zehnte Jahrhundert und immer unter Einbeziehung exemplarischer Quellen, insbesondere Adam von Bremen, Thiedmar von Merseburg und die fränkischen Reichsannalen. Archäologische Quellen werden, sofern sie von Bedeutung sind bzw. die einzigen Quellen darstellen berücksichtigt.
Die zentrale Fragestellung lautet also: Wie sind die Verhältnisse an der Kontaktzone zwischen Dänen und Franken und war die Grenze im Norden wirklich als solche zu verstehen oder bot sie vielmehr die Möglichkeit der friedlichen Kommunikation und des Handels – für die Herrschenden ebenso wie für die Masse der Bevölkerung?
Als These möchte ich formulieren: Das Grenzgebiet zwischen Franken und Dänen bildete einen Konfliktbereich, insbesondere begründet im Interessenskonflikt der Herrschenden – dort trafen, wie kaum woanders, ideologische, politische und religiöse Weltanschauungen aufeinander, wie sie unterschiedlicher kaum sein konnten. Trotz all dieser Differenzen fand jedoch Kommunikation statt; diese zeigt sich insbesondere im Handel, da dieser, soweit er beiden Parteien dient, Grenzen überwinden kann.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Die Protagonisten: Franken, Friesen und Dänen
- a. Franken
- b. Friesen
- c. Dänen
- III. Das Danewerk – historisch und archäologisch
- a. Die Erwähnung in den fränkischen Reichsannalen
- b. Die archäologische Sicht: Baugeschichte und Datierung
- IV. Grenzfälle: Bewaffnete Auseinandersetzungen
- a. Die Jahre 808 bis 811: Die Errichtung eines Walles, der Überfall auf die Friesen und die Reaktion Karls des Großen
- b. Die Jahre 840 bis 891: Der Aufstand der Dänen und die Niederwerfung durch König Arnulf
- c. Die Jahre 934 bis 983: Gewinn und Verlust der Oberherrschaft über das Eider-Schlei-Gebiet
- V. Heiden und Christen: Eine Glaubensfrage
- VI. Waren, Wege und Kaufleute: Handel im Norden
- a. Zu Wasser und zu Lande: Handelswege
- b. Kontaktnachweise anhand von Münzfunden
- c. Handelsplätze und Handelswaren
- VII. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Kontakte zwischen Franken und Dänen im Grenzgebiet des Danewerks im 9. und 10. Jahrhundert. Sie geht der Frage nach, inwieweit die Grenze zwischen beiden Völkern tatsächlich eine trennende Wirkung hatte oder ob sie auch Raum für friedliche Interaktion bot. Dabei werden bewaffnete Konflikte, Handelsbeziehungen und religiöse Unterschiede als zentrale Aspekte betrachtet.
- Das Danewerk als Grenze und Kontaktzone
- Beziehungen zwischen Franken und Dänen: Konflikt und Kooperation
- Der Einfluss von Religion (Heidentum und Christentum) auf die Beziehungen
- Handel als verbindendes Element über die Grenze hinweg
- Die Rolle der Quellen (Adam von Bremen, Thiedmar von Merseburg, fränkische Reichsannalen) und der Archäologie
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung skizziert die zentrale Fragestellung der Arbeit: Wie gestalteten sich die Beziehungen zwischen Franken und Dänen an der Grenze des Danewerks? War diese Grenze eine trennende Barriere oder ermöglichte sie auch Austausch und Handel? Die Arbeit konzentriert sich auf die Betrachtung bewaffneter Konflikte, Handelsbeziehungen und religiöser Unterschiede im 9. und 10. Jahrhundert, unter Einbezug spezifischer Quellen und archäologischer Befunde, um zu ergründen, wie die Grenze von beiden Seiten wahrgenommen und genutzt wurde.
II. Die Protagonisten: Franken, Friesen und Dänen: Dieses Kapitel beschreibt die historischen Hintergründe der drei beteiligten Akteure: Franken, Friesen und Dänen. Es beleuchtet die komplexe Frühgeschichte der Franken, ihren Aufstieg unter den Karolingern und die Bedeutung der Christianisierung. Die Beschreibung der Friesen betont ihre geographische Lage und die Eroberung durch die Franken. Schließlich wird die Herkunft und Geschichte der Dänen im 6. Jahrhundert und danach behandelt, unter Hinweis auf Unsicherheiten bezüglich ihrer Abstammung.
III. Das Danewerk – historisch und archäologisch: Dieses Kapitel analysiert das Danewerk aus historischer und archäologischer Perspektive. Es untersucht die Erwähnung des Danewerks in den fränkischen Reichsannalen und präsentiert archäologische Erkenntnisse zu seiner Baugeschichte und Datierung. Die Analyse bietet Einblicke in die Funktion des Danewerks als Verteidigungsanlage und seine Bedeutung für das Verständnis der Beziehungen zwischen Franken und Dänen.
IV. Grenzfälle: Bewaffnete Auseinandersetzungen: Dieses Kapitel untersucht bewaffnete Konflikte zwischen Franken und Dänen im 9. und 10. Jahrhundert. Es analysiert verschiedene Episoden, darunter die Errichtung des Danewerks, die Kämpfe unter Karl dem Großen, den Aufstand der Dänen unter König Arnulf und die wechselnde Oberherrschaft über das Eider-Schlei-Gebiet. Diese Ereignisse beleuchten die dynamische Natur der Grenze und die wechselseitigen Machtverhältnisse.
V. Heiden und Christen: Eine Glaubensfrage: Dieses Kapitel befasst sich mit den religiösen Aspekten der Beziehungen zwischen Franken und Dänen. Es untersucht den Einfluss des Christentums im fränkischen Reich und das Heidentum der Dänen und die möglichen Auswirkungen dieser religiösen Unterschiede auf die Beziehungen zwischen den beiden Gruppen. Die Interaktion und der mögliche Konflikt zwischen den verschiedenen Glaubensvorstellungen werden beleuchtet.
VI. Waren, Wege und Kaufleute: Handel im Norden: Dieses Kapitel untersucht den Handel zwischen Franken und Dänen. Es analysiert Handelswege, Münzfunde als Indikatoren für Kontakte und wichtige Handelsplätze und -güter. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse, inwieweit der Handel trotz der politischen und religiösen Spannungen als Brücke zwischen den beiden Gruppen diente und zur Überwindung der Grenze beitrug.
Schlüsselwörter
Danewerk, Franken, Dänen, Friesen, Karl der Große, Grenzgebiet, bewaffnete Konflikte, Handel, Religion, Christentum, Heidentum, Reichsannalen, Adam von Bremen, Thiedmar von Merseburg, Archäologie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Kontakte zwischen Franken und Dänen am Danewerk im 9. und 10. Jahrhundert
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht die Beziehungen zwischen Franken und Dänen im Grenzgebiet des Danewerks im 9. und 10. Jahrhundert. Der Fokus liegt darauf, wie die Grenze zwischen beiden Völkern wahrgenommen wurde – als trennende Barriere oder als Raum für Interaktion. Bewaffnete Konflikte, Handelsbeziehungen und religiöse Unterschiede werden als zentrale Aspekte betrachtet.
Welche Akteure werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit den Franken, den Dänen und den Friesen. Es werden deren historische Hintergründe, ihre jeweiligen Entwicklungen und die komplexen Beziehungen untereinander beleuchtet.
Welche Rolle spielt das Danewerk?
Das Danewerk wird sowohl historisch (durch die Erwähnung in fränkischen Reichsannalen) als auch archäologisch (Baugeschichte und Datierung) analysiert. Seine Funktion als Verteidigungsanlage und seine Bedeutung für die Beziehungen zwischen Franken und Dänen stehen im Mittelpunkt.
Welche Konflikte werden beschrieben?
Die Arbeit analysiert verschiedene bewaffnete Konflikte zwischen Franken und Dänen, beispielsweise die Errichtung des Danewerks, Kämpfe unter Karl dem Großen, den Aufstand der Dänen unter König Arnulf und die wechselnde Oberherrschaft über das Eider-Schlei-Gebiet. Diese Ereignisse verdeutlichen die dynamischen Machtverhältnisse an der Grenze.
Wie wird der Aspekt der Religion behandelt?
Das Kapitel "Heiden und Christen: Eine Glaubensfrage" untersucht den Einfluss des Christentums im fränkischen Reich und das Heidentum der Dänen. Die möglichen Auswirkungen dieser religiösen Unterschiede auf die Beziehungen zwischen den Gruppen werden beleuchtet.
Welche Rolle spielt der Handel?
Der Handel zwischen Franken und Dänen wird anhand von Handelswegen, Münzfunden und wichtigen Handelsplätzen und -gütern analysiert. Es wird untersucht, inwieweit der Handel trotz politischer und religiöser Spannungen als verbindendes Element diente.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf verschiedene Quellen, darunter die fränkischen Reichsannalen, die Berichte von Adam von Bremen und Thiedmar von Merseburg sowie archäologische Befunde. Die Rolle und der Umgang mit diesen Quellen werden erläutert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Die Protagonisten, Das Danewerk, Grenzfälle (bewaffnete Auseinandersetzungen), Heiden und Christen, Waren, Wege und Kaufleute und Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Beziehungen zwischen Franken und Dänen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Danewerk, Franken, Dänen, Friesen, Karl der Große, Grenzgebiet, bewaffnete Konflikte, Handel, Religion, Christentum, Heidentum, Reichsannalen, Adam von Bremen, Thiedmar von Merseburg, Archäologie.
Wo finde ich die Kapitelzusammenfassungen?
Die Arbeit enthält detaillierte Zusammenfassungen jedes einzelnen Kapitels, die die zentralen Inhalte und Argumentationslinien jedes Abschnitts darlegen.
- Citation du texte
- Marco Chiriaco (Auteur), 2007, Die Grenze im Norden - Beziehungen diesseits und jenseits des Danewerks, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88887