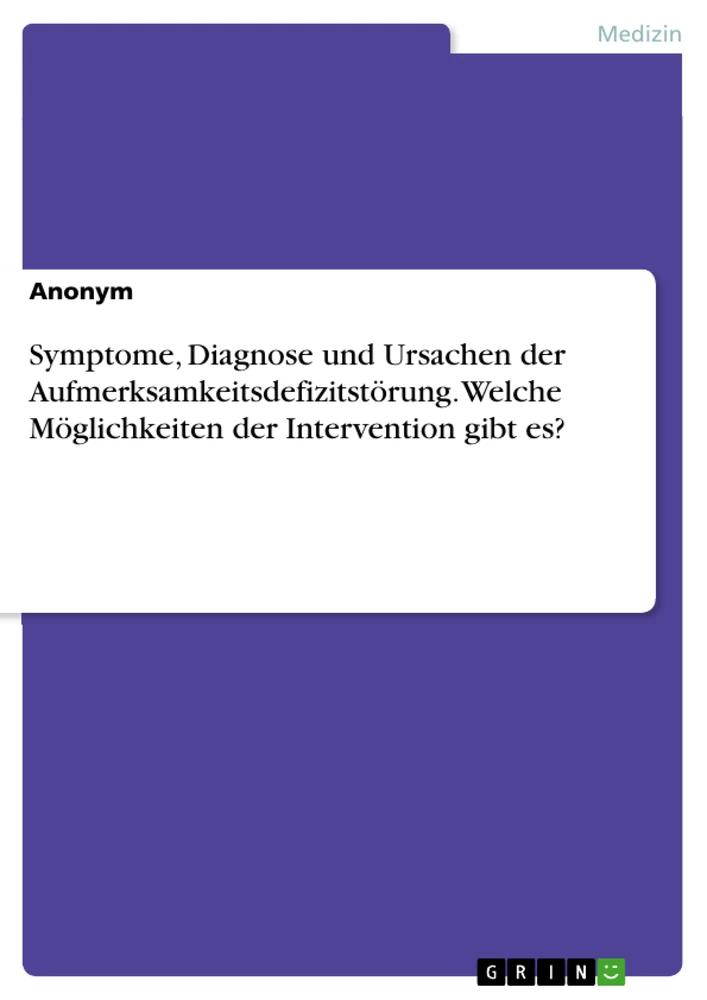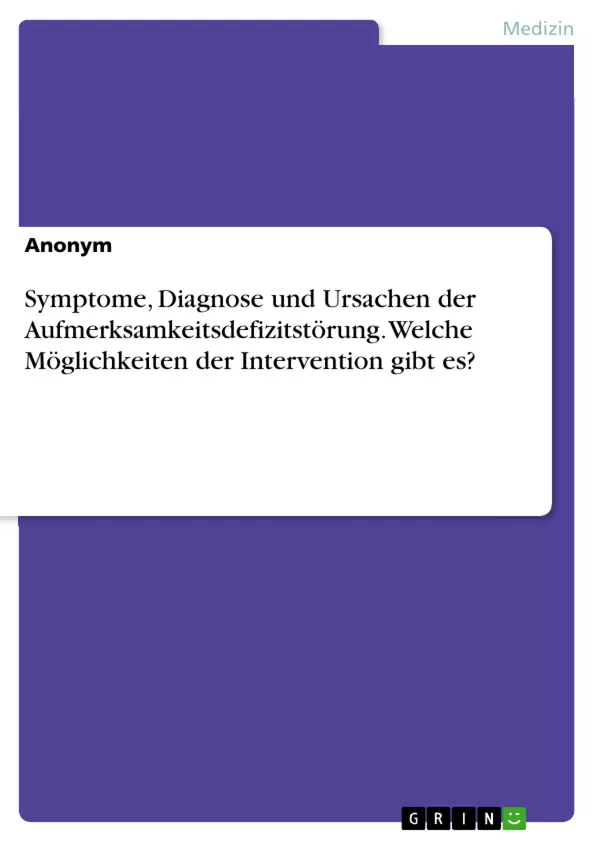In dieser Arbeit geht es um die Aufmerksamkeitsdefizitstörung. Zuerst wird ihr Erscheinungsbild erläutert, gefolgt von der Festlegung einer Diagnose und den potentiellen Ursachen der Störung. Diese werden im vierten Kapitel diskutiert und der aktuelle Forschungsstand dargelegt. Zuletzt werden Interventionsmöglichkeiten vorgestellt sowie ein Fazit aus den gewonnenen Erkenntnissen gezogen. Dieses beinhaltet, welche Interventionsmöglichkeiten für Pädagog/innen in Frage kommen.
Auch wenn ADS-Kinder häufig Lernschwierigkeiten haben, sind sie doch von durchschnittlicher und auch häufig überdurchschnittlicher Intelligenz- wenn sie mit viel Geduld gefördert werden, können sie diese entwickeln und sogar akademisch tätig werden. Andererseits gibt es leider auch genügend Beispiele von Menschen, die nicht gelernt haben, ihre Impulsivität und ihr Verhalten zu kontrollieren und eine Biographie mit vielen Brüchen aufweisen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Erscheinungsbild
- Diagnose/Ursachen
- Welche Ursachen werden diskutiert? Forschungsstand
- Interventionsmöglichkeiten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS), ihren Erscheinungsformen, Ursachen und Interventionsmöglichkeiten. Sie basiert auf Beobachtungen aus einem Praxissemester an einer Stuttgarter Schule.
- Symptome und Erscheinungsbild von ADHS und ADS
- Diskussion der Ursachen von ADHS, inklusive genetischer Faktoren und Umwelteinflüsse
- Die Rolle der Medikation (Ritalin) bei der Behandlung von ADHS
- Pädagogische Herausforderungen im Umgang mit ADHS-Kindern
- Die Langzeitperspektive von ADHS und deren Auswirkungen auf das Leben Betroffener
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die persönlichen Beobachtungen der Autorin während eines Praxissemesters an einer Stuttgarter Schule. Der Fokus liegt auf zwei Schülerinnen, Corinna und dem Bruder von L., die beide von ADHS betroffen sind und unterschiedliche Behandlungsverläufe und Reaktionen aufweisen. Dieser Abschnitt dient als einleitende Fallstudie und illustriert die Komplexität und Bandbreite der ADHS-Symptomatik. Die Erfahrung mit diesen Kindern motiviert die Autorin zu einer tiefergehenden Auseinandersetzung mit dem Thema.
Erscheinungsbild: Dieses Kapitel beschreibt detailliert das Erscheinungsbild von ADHS und ADS. Es werden die Schwierigkeiten bei der Konzentration, Impulsivität und motorische Unruhe bei ADHS-Kindern hervorgehoben. Der Unterschied zwischen ADS ("Träumer") und ADHS wird erläutert, wobei der Fokus auf den Konzentrationsstörungen und der abweichenden Informationsverarbeitung liegt. Das Kapitel betont auch, dass trotz der Lernschwierigkeiten viele Betroffene überdurchschnittliche Intelligenz besitzen, wenn sie angemessen gefördert werden. Die verschiedenen Manifestationen der Störung und die damit verbundenen Herausforderungen im schulischen und sozialen Kontext werden ausführlich dargestellt.
Diagnose/Ursachen: Dieses Kapitel beleuchtet die diagnostischen Aspekte und die diskutierten Ursachen von ADHS. Genetische Faktoren, die Rolle von pränatalen Einflüssen (Rauchen, Alkohol, Drogenkonsum) und die komplexe Interaktion verschiedener Faktoren werden besprochen. Die Autorin erwähnt die frühere Annahme einer Hirnfunktionsstörung, die heute einer differenzierteren Betrachtungsweise gewichen ist, die die Denkstrukturen von ADS-Betroffenen miteinbezieht. Der Abschnitt diskutiert auch den Zusammenhang zwischen ADHS und familiären Beziehungen, insbesondere die Beziehung zum Vater. Abschließend werden die Häufigkeit der Störung und die Geschlechterverteilung angesprochen. Die Ausführungen beleuchten sowohl die medizinischen als auch die sozio-familiären Aspekte der ADHS-Ätiologie.
Schlüsselwörter
Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS), Aufmerksamkeitsdefizitstörung (ADS), Ritalin, Medikation, Konzentrationsschwierigkeiten, Impulsivität, Hyperaktivität, Diagnose, Ursachen, genetische Faktoren, Umwelteinflüsse, Pädagogik, soziale Integration, Lernschwierigkeiten, Intelligenz, Familienbeziehungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich umfassend mit der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS), ihren Erscheinungsformen, Ursachen und Interventionsmöglichkeiten. Sie basiert auf Beobachtungen aus einem Praxissemester an einer Stuttgarter Schule und beinhaltet eine Einleitung, Kapitel zu Erscheinungsbild, Diagnose/Ursachen, Interventionsmöglichkeiten, sowie eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Symptome und Erscheinungsbild von ADHS und ADS, diskutiert die Ursachen von ADHS (genetische Faktoren und Umwelteinflüsse), beleuchtet die Rolle der Medikation (Ritalin), geht auf pädagogische Herausforderungen im Umgang mit ADHS-Kindern ein und betrachtet die Langzeitperspektive von ADHS und deren Auswirkungen auf das Leben Betroffener.
Wie wird das Erscheinungsbild von ADHS beschrieben?
Das Kapitel "Erscheinungsbild" beschreibt detailliert die Schwierigkeiten bei der Konzentration, Impulsivität und motorische Unruhe bei ADHS-Kindern. Der Unterschied zwischen ADS und ADHS wird erläutert, mit Fokus auf Konzentrationsstörungen und abweichender Informationsverarbeitung. Es wird betont, dass viele Betroffene trotz Lernschwierigkeiten überdurchschnittliche Intelligenz besitzen, bei angemessener Förderung.
Welche Ursachen für ADHS werden diskutiert?
Das Kapitel "Diagnose/Ursachen" beleuchtet genetische Faktoren, pränatale Einflüsse (Rauchen, Alkohol, Drogenkonsum) und die komplexe Interaktion verschiedener Faktoren. Es wird die frühere Annahme einer Hirnfunktionsstörung erwähnt und die heutige differenziertere Betrachtungsweise, die Denkstrukturen von ADS-Betroffenen miteinbezieht, erläutert. Der Zusammenhang zwischen ADHS und familiären Beziehungen, insbesondere der Beziehung zum Vater, wird ebenfalls diskutiert.
Welche Interventionsmöglichkeiten werden angesprochen?
Die Arbeit erwähnt die Rolle der Medikation (Ritalin) bei der Behandlung von ADHS und geht auf pädagogische Herausforderungen im Umgang mit ADHS-Kindern ein. Konkrete Interventionsmöglichkeiten werden jedoch nicht detailliert beschrieben. Der Fokus liegt auf der Beschreibung der Störung und ihren Ursachen.
Welche Rolle spielt die Medikation (Ritalin)?
Die Rolle der Medikation, insbesondere von Ritalin, bei der Behandlung von ADHS wird als ein wichtiger Aspekt der Interventionsmöglichkeiten erwähnt. Jedoch wird die Medikation nicht im Detail behandelt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Schlüsselwörter umfassen: Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS), Aufmerksamkeitsdefizitstörung (ADS), Ritalin, Medikation, Konzentrationsschwierigkeiten, Impulsivität, Hyperaktivität, Diagnose, Ursachen, genetische Faktoren, Umwelteinflüsse, Pädagogik, soziale Integration, Lernschwierigkeiten, Intelligenz, Familienbeziehungen.
Auf welchen Beobachtungen basiert die Arbeit?
Die Arbeit basiert auf den persönlichen Beobachtungen der Autorin während eines Praxissemesters an einer Stuttgarter Schule, wobei der Fokus auf zwei Schülerinnen liegt, die von ADHS betroffen sind und unterschiedliche Behandlungsverläufe und Reaktionen aufweisen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Symptome, Diagnose und Ursachen der Aufmerksamkeitsdefizitstörung. Welche Möglichkeiten der Intervention gibt es?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/889287