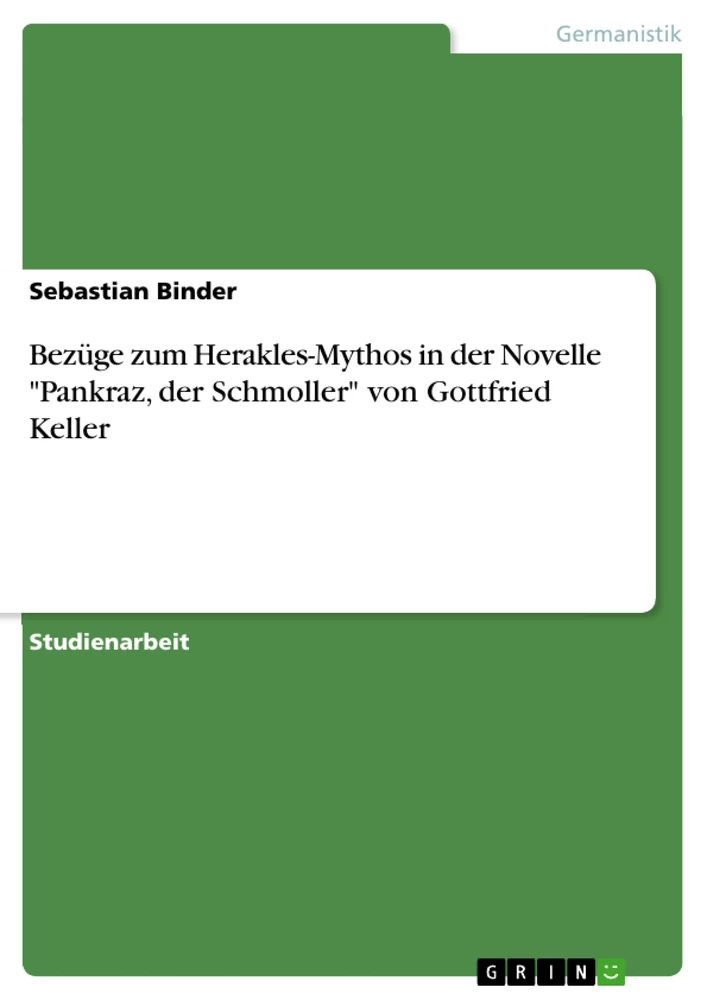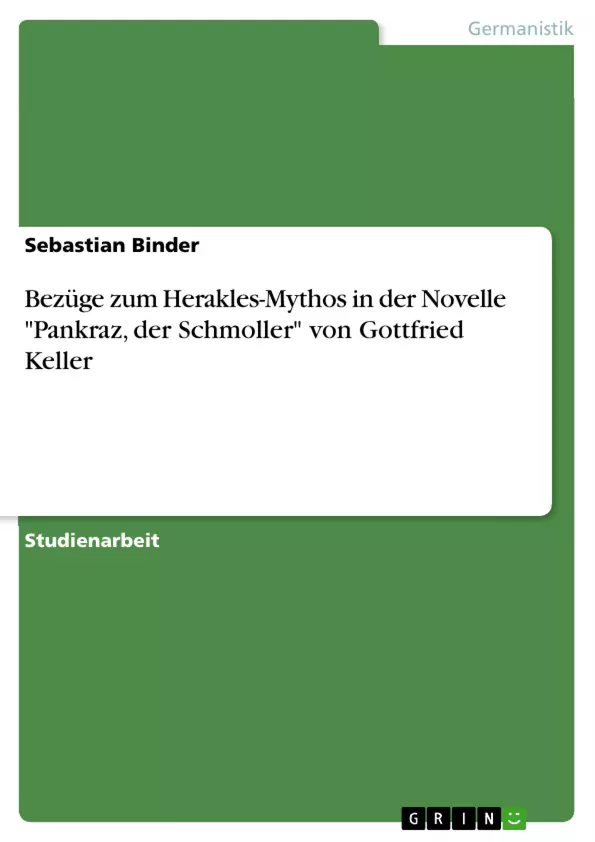Wie sehen die verschiedenen Anspielungen auf den Heraklesmythos in Gottfried Kellers "Pankraz, der Schmoller" konkret aus und welche Funktion hat der Einbezug einer solchen literarischen Vorlage in Kellers Novelle?
Dafür sollen die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Herakles und Pankraz in vergleichender Perspektive herausgearbeitet werden, um zu klären, inwiefern die Figur als Ebenbild oder als Parodie von Herakles gezeichnet wird. Anschließend werden die Ergebnisse zusammengefasst, bevor ein abschließender Blick auf die Funktion der Heraklesbezüge in Kellers Werk erfolgt.
Inhaltsverzeichnis
- Pankraz‘ Heimatort Seldwyla als ein Ort der Moderne und Mythologie.
- Bezüge zum Heraklesmythos in Gottfried Kellers Novelle Pankraz, der Schmoller
- Pankraz und die Jagd auf den Löwen.
- Verweichlichung Pankrazʻ unter Lydia...
- ,Pankraz, ein, Allesbeherrscher' im wörtlichen Sinn?.
- Zur Funktion der Heraklesbezüge in Pankraz, der Schmoller.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Bezüge zum Heraklesmythos in Gottfried Kellers Novelle „Pankraz, der Schmoller“. Im Fokus stehen die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Figuren Herakles und Pankraz, um die Frage zu klären, inwiefern Pankraz als Ebenbild oder als Parodie des griechischen Helden gezeichnet wird. Die Arbeit untersucht die Funktion der Heraklesbezüge in der Novelle und beleuchtet, inwiefern sie die literarischen und gesellschaftlichen Kontexte des 19. Jahrhunderts widerspiegeln.
- Die Darstellung von Seldwyla als Ort der Moderne und des Wandels vom mittelalterlichen Ideal zur kapitalistischen Gesellschaft
- Die Parallelen zwischen Pankraz und Herakles im Hinblick auf den Löwenkampf
- Die Rolle von Lydia als verführerische Sirene und ihre Auswirkungen auf Pankraz
- Die Ambivalenz der Figur Pankraz: Hero oder Antiheld?
- Die literarische Funktion der Heraklesbezüge in Gottfried Kellers Werk
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel analysiert Seldwyla als Ort der Moderne und beleuchtet, wie Keller die traditionellen Werte der dörflichen Gemeinschaft mit den aufkommenden ökonomischen und gesellschaftlichen Veränderungen des 19. Jahrhunderts konfrontiert. In diesem Kontext werden die Bezüge zur antiken Mythologie und ihre Bedeutung im Werk Kellers erörtert.
Das zweite Kapitel untersucht die Parallelen zwischen Pankraz und Herakles im Hinblick auf den Löwenkampf. Hier werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Figuren sowie die literarische Funktion des Löwenkampfes in der Novelle analysiert.
Das dritte Kapitel widmet sich dem Einfluss der verführerischen Lydia auf Pankraz und untersucht, inwiefern sie als Sirenenfigur und als Repräsentantin der Verweichlichung wirkt. Die Auswirkungen von Lydias Einfluss auf Pankrazs Entwicklung und seine Rolle als Held werden in diesem Kapitel betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Mythologie und Moderne, Heraklesmythos, Gottfried Keller, „Pankraz, der Schmoller“, Löwenkampf, Sirenenfigur, Verweichlichung, Heldendichtung, literarische Funktion, Gesellschaft des 19. Jahrhunderts.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt der Herakles-Mythos in Kellers Novelle?
Der Mythos dient als literarische Vorlage, auf die durch Anspielungen und Parallelen Bezug genommen wird, um die Figur des Pankraz zu charakterisieren.
Ist Pankraz ein Ebenbild oder eine Parodie von Herakles?
Die Arbeit untersucht genau diese Ambivalenz – ob Pankraz als moderner Held oder als ironische Brechung des antiken Vorbilds zu verstehen ist.
Was symbolisiert der Löwenkampf in "Pankraz, der Schmoller"?
Der Kampf gegen den Löwen ist eine direkte Parallele zu den Taten des Herakles und markiert einen Wendepunkt in Pankraz' Entwicklung.
Wer ist Lydia und welche mythologische Funktion hat sie?
Lydia wird als Sirenenfigur interpretiert, die Pankraz verführt und zu einer gewissen "Verweichlichung" führt, was wiederum im Kontrast zum heroischen Ideal steht.
Was sagt Seldwyla über die Gesellschaft des 19. Jahrhunderts aus?
Seldwyla wird als Ort dargestellt, der sich im Wandel von traditionellen mittelalterlichen Werten hin zu einer modernen, kapitalistischen Gesellschaft befindet.
Warum nutzt Gottfried Keller mythologische Bezüge in einer realistischen Novelle?
Die Bezüge dienen dazu, zeitlose menschliche Probleme und gesellschaftliche Entwicklungen der Moderne vor dem Hintergrund klassischer Ideale zu reflektieren.
- Quote paper
- Sebastian Binder (Author), 2017, Bezüge zum Herakles-Mythos in der Novelle "Pankraz, der Schmoller" von Gottfried Keller, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/889296