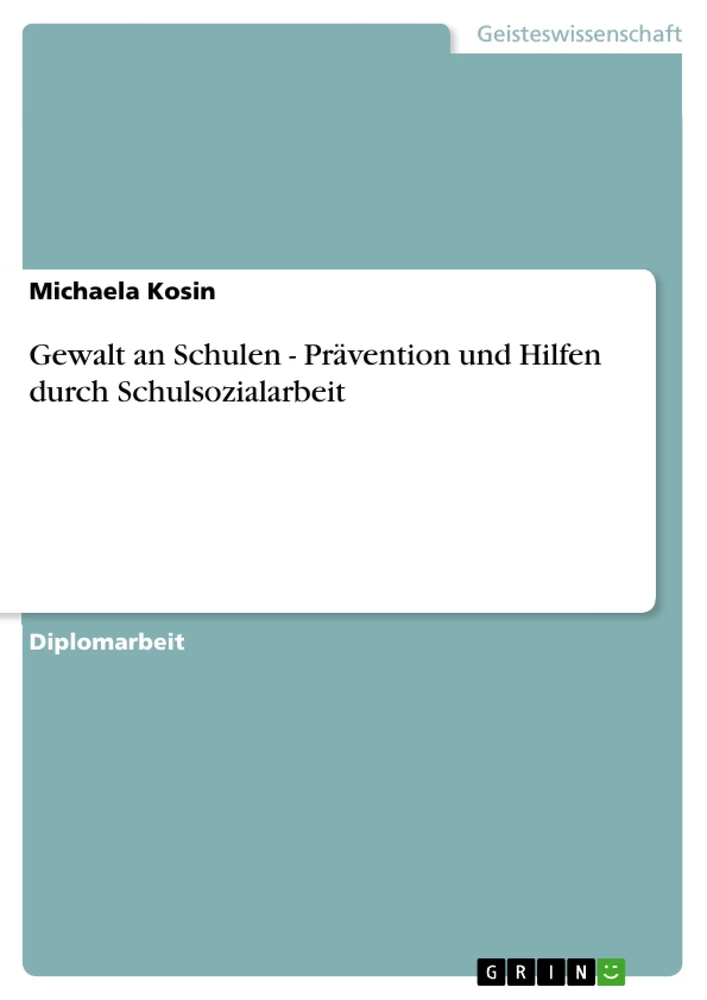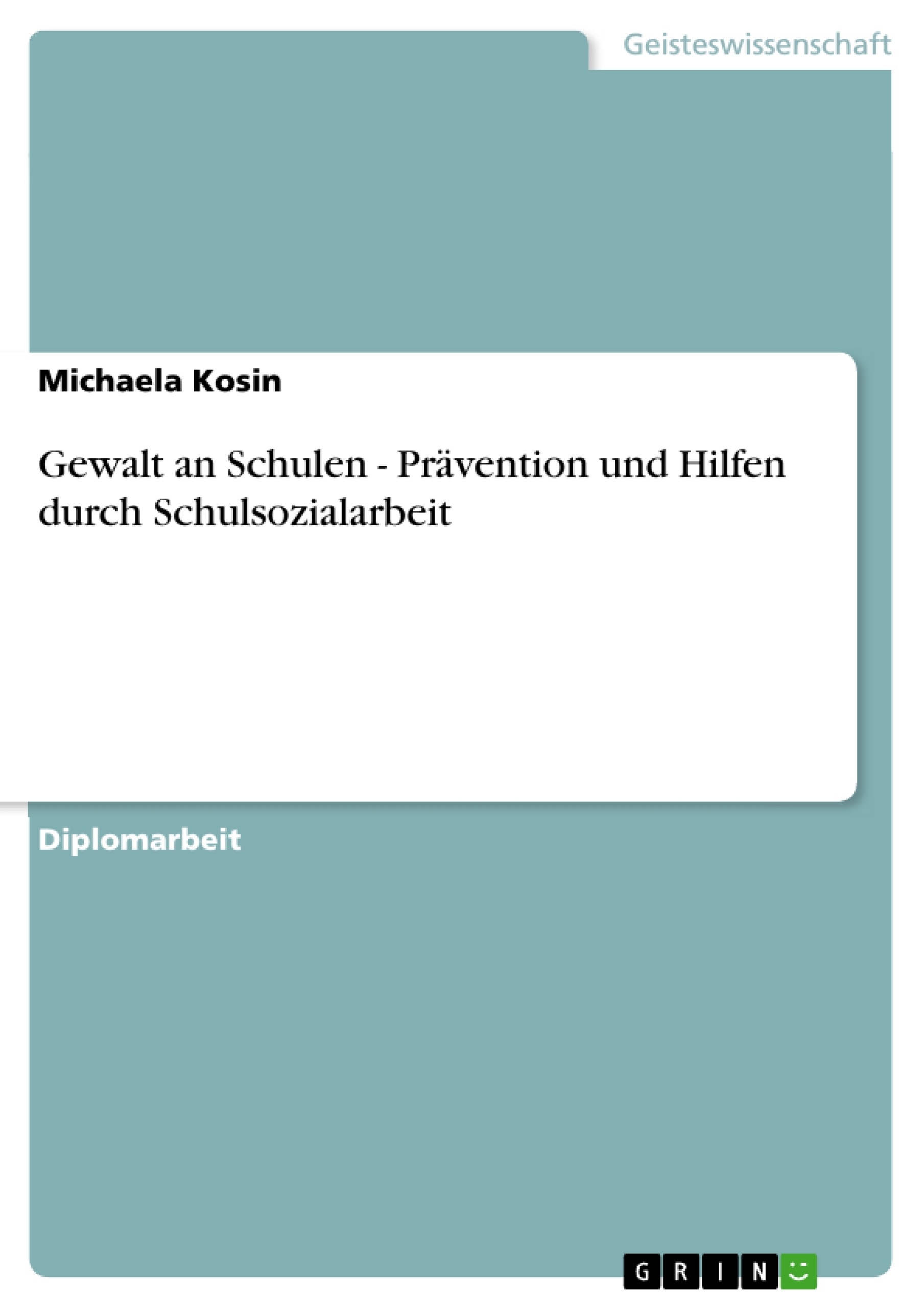Mit Beginn der 90er Jahre wurde der Fokus der Öffentlichkeit und der Medien verstärkt auf das Thema „Gewalt in der Schule“ gerichtet. Die Medien berichteten über Gewalt unter Jugendlichen und Kindern, die auf den Schulhöfen an der Tagesordnung seien. Schulhöfe und Schulwege seien ein gefährliches Pflaster und die Bewaffnung der Kinder und Jugendlichen nähme zu.
Diesen Thesen standen laut Tillmann aber wenig seriöse Forschungen gegenüber. Dies änderte sich als ab ca. 1993 zahlreiche Forschungen dazu angestellt wurden. Die Debatte um Gewalt in der Schule löste einen Forschungsboom aus und die Bundesregierung führte eine Gewaltkommission ein. Dies führte zu einer Belebung der Diskussion um die Erklärungsansätze für Gewalt und Aggression.
Schubarth beschreibt Gewalt nicht als Problem von Kindern und Jugendlichen, sondern als „gesamtgesellschaftlich zu verantwortendes Problem.“ Er nennt Gewalt eine „soziale Krankheit“, die ein Signal für ungelöste soziale Probleme und Konflikte sei, mit der Kinder und Jugendliche auf Problemlagen reagieren.
Doch wie bei anderen sozialen Problemen so gibt es auch für die öffentlich geführte Gewaltdiskussion keine „objektiven“ Maßstäbe, auch sie unterliegt nicht zuletzt den Deutungen auf der Grundlage vorherrschender Wertmassstäbe, die uns sagen, wann etwas wirklich „besorgniserregend“ ist....
Inhaltsverzeichnis
- 1. Gewalt an Schulen - Einführung in die Problematik
- 1.1 Definitionsansätze zum Gewaltbegriff
- 1.2 Schule und Gewalt
- 1.3 Einflüsse bei der Entstehung von Gewalt bei Kindern und Jugendlichen im schulischen Umfeld
- 1.3.1 Leistungsgesellschaft
- 1.3.2 Desintegration in der Gesellschaft
- 1.3.3 Familie
- 1.3.4 Strukturelle Einflüsse der Schule
- 1.3.5 Medien
- 1.3.6 Peer-group und Cliquen
- 2. Schulsozialarbeit
- 2.1 Definitionsansätze
- 2.2 Rechtliche Grundlagen
- 2.3 Aufgaben und Ziele der Schulsozialarbeit
- 2.3.1 Aufgabenbereiche
- 2.3.2 Ziele
- 2.3.3 Zielgruppen
- 2.4 Träger der Schulsozialarbeit
- 2.5 Modelle der Kooperation zwischen Schulsozialarbeit und Schule
- 2.5.1 Integrations- und Subordinationsmodell
- 2.5.2 Distanzmodell
- 2.5.3 Kooperationsmodell
- 3. Schulsozialarbeit und Prävention
- 3.1 Definition Prävention
- 3.1.1 Primäre Prävention
- 3.1.2 Sekundäre Prävention
- 3.1.3 Tertiäre Prävention
- 3.2 Gewaltprävention
- 4. Arbeitsweisen der Schulsozialarbeit bei Gewalt in Schulen
- 4.1 Beratung
- 4.2 Einzelfallhilfen
- 4.3 Soziale Gruppenarbeit
- 4.4 Gemeinwesenarbeit
- 5. Projektbeispiele
- 5.1 „Faustlos“- Curriculum zur Gewaltprävention in Grundschulen
- 5.2 Das Interventionsprogramm für Schulen von Olweus
- 5.3 Streitschlichter Programme in Schulen
- 6. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit der Problematik von Gewalt an Schulen und den Möglichkeiten der Schulsozialarbeit zur Prävention und Hilfe. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Schulsozialarbeit dazu beitragen kann, Gewalt an Schulen zu reduzieren und ein friedliches Miteinander zu fördern. Die Arbeit untersucht verschiedene Definitionsansätze von Gewalt, analysiert die Ursachen von Gewalt in der Schule und beleuchtet die Rolle der Schulsozialarbeit im Kontext von Prävention und Intervention. Die Arbeit zeigt verschiedene Modelle der Kooperation zwischen Schulsozialarbeit und Schule auf und stellt zudem konkrete Projektbeispiele vor.
- Definition von Gewalt und ihre Erscheinungsformen an Schulen
- Ursachen von Gewalt im schulischen Umfeld
- Rolle und Aufgaben der Schulsozialarbeit bei der Gewaltprävention
- Modelle der Kooperation zwischen Schulsozialarbeit und Schule
- Praxisbeispiele von Gewaltpräventionsprojekten
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik „Gewalt an Schulen“ ein und definiert den Begriff „Gewalt“ aus verschiedenen Perspektiven. Es werden die verschiedenen Faktoren beleuchtet, die zu Gewalt in der Schule führen können. Hierbei werden die Einflüsse von Leistungsgesellschaft, Desintegration, Familie, Medien und Peer-Groups auf die Entstehung von Gewalt bei Kindern und Jugendlichen analysiert.
Kapitel 2 befasst sich mit der Schulsozialarbeit und ihren Aufgaben und Zielen. Die Arbeit geht auf die rechtlichen Grundlagen der Schulsozialarbeit ein und stellt verschiedene Kooperationsmodelle zwischen Schulsozialarbeit und Schule vor.
Kapitel 3 beleuchtet die Rolle der Schulsozialarbeit in der Prävention von Gewalt. Es werden die verschiedenen Formen der Prävention (primäre, sekundäre, tertiäre) erläutert und es wird die Bedeutung der Gewaltprävention in der Schulsozialarbeit herausgestellt.
Kapitel 4 stellt verschiedene Arbeitsweisen der Schulsozialarbeit bei Gewalt in Schulen vor. Es werden die Methoden der Beratung, der Einzelfallhilfe, der sozialen Gruppenarbeit und der Gemeinwesenarbeit erläutert.
Kapitel 5 präsentiert verschiedene Projektbeispiele, die die Praxis der Gewaltprävention in Schulen veranschaulichen. Es werden die Programme „Faustlos“, das Interventionsprogramm von Olweus und Streitschlichter Programme vorgestellt.
Schlüsselwörter
Schulsozialarbeit, Gewaltprävention, Gewalt an Schulen, Kinder und Jugendliche, Familien, Schule, Medien, Peer-Groups, Kooperationsmodelle, Projektbeispiele, Interventionsprogramme, Präventionsarbeit
- Quote paper
- Michaela Kosin (Author), 2004, Gewalt an Schulen - Prävention und Hilfen durch Schulsozialarbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/89024