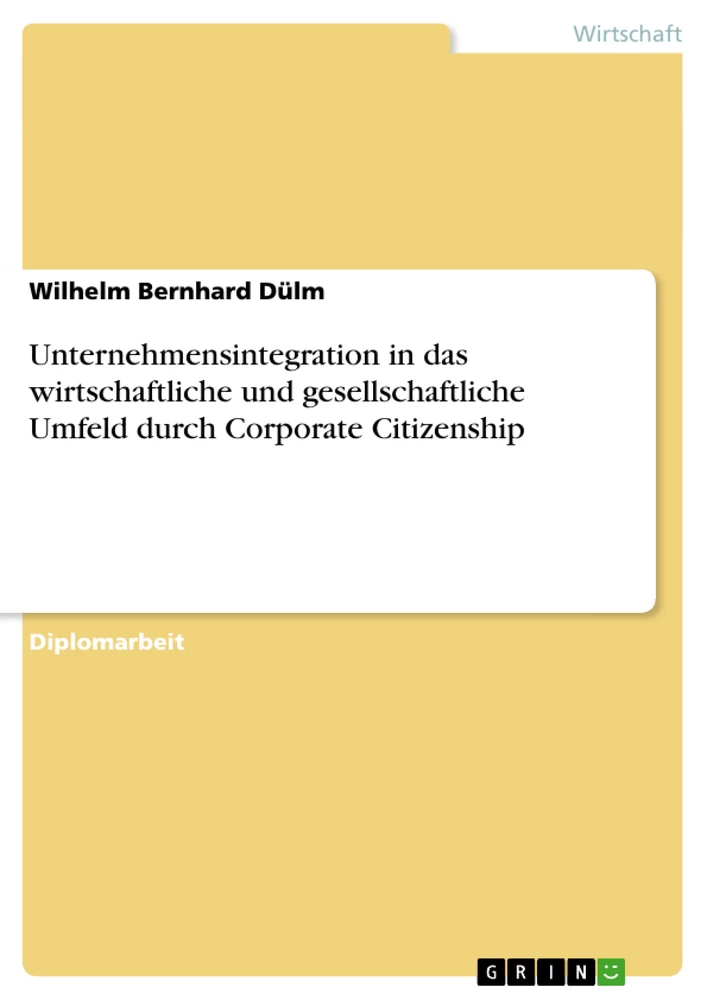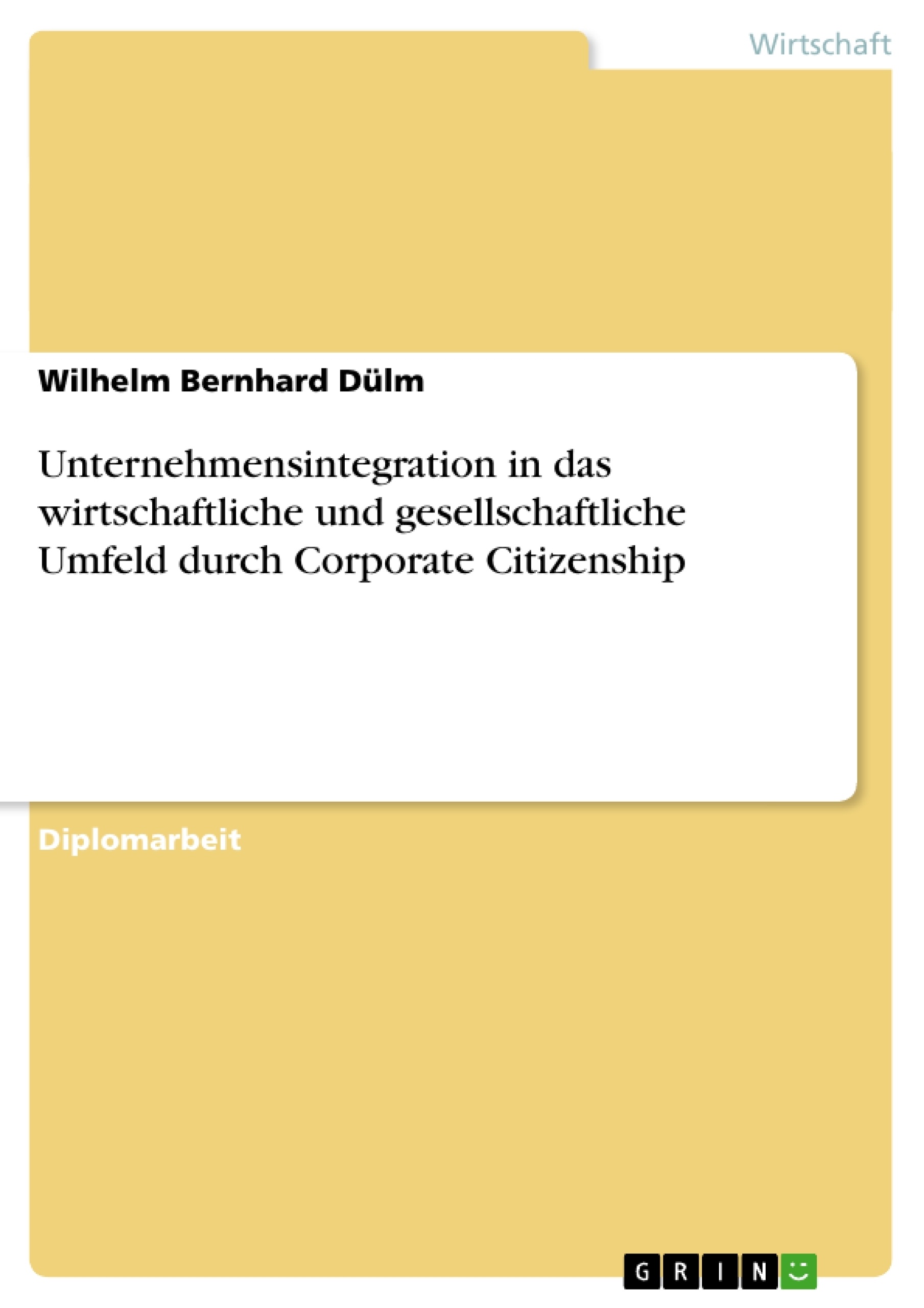Ethische und moralische Aspekte innerhalb der Betriebswirtschaftslehre bilden für mich ein Themengebiet, welches mein Interesse an der Themenstellung geweckt hat, auf welchem Weg es möglich ist, sich als Unternehmen bzw. Organisation in das wirtschaftliche und gesellschaftliche Umfeld zu integrieren. Zum einen wollte ich herausfinden, ob sich Ethik und Moral mit Wirtschaft in Einklang bringen lassen und zum anderen welche Ansätze es für Integrationskonzepte in das wirtschaftliche und gesellschaftliche Umfeld gibt.
Dabei bin ich bei meiner Literaturrecherche auf interessante Themen gestoßen, welche ich in diese Arbeit integrieren konnte. Mein besonderer Dank gilt meiner Partnerin Doreen, die mich bei meinen Recherchen tatkräftig unterstützte.
Die vorliegende Arbeit befasst sich ausführlich mit der Thematik der Unternehmensintegration in das wirtschaftliche und gesellschaftliche Umfeld durch Corporate Citizenship.
Nach einer Problemdefinition wird im Grundlagenteil auf die Begriffe „Ethik“ und schließlich auf „Moral“ eingegangen. Da Corporate Citizenship eng mit diesem Begriffspaar verbunden ist, wird auf die Begriffe Wirtschafts- bzw. Unternehmensethik explizit eingegangen. An-schließend erfolgt eine Abgrenzung zwischen Ethik und Wirtschaft, d.h. es soll der Fragestel-lung nachgegangen werden, inwieweit Ethik und Wirtschaft miteinander vereinbar sind. Da unter dem Begriff Corporate Citizenship im Prinzip verantwortungsvolles Handeln verstanden wird, wird, nach einer vorherigen Definition des „Wirtschaftsbürgers“ allgemein, auf den Begriff der „Verantwortung“ eingegangen, wobei hier die Ansätze von HOMANN/BLOME/DRESS, PETER ULRICH und von STEINMANN/LÖHR besondere Erwähnung finden.
Im Anschluss daran wird auf das Konzept des Corporate Citizenship näher eingegangen, wobei zunächst der Begriff des Corporate Citizenship definiert und anhand des sog. „Drei- Ebenen-Modell“ näher erläutert wird. Schließlich wird die geschichtliche Entwicklung des Corporate Citizenship geschildert. Hieran schließt sich eine Differenzierung der in der Literatur häufig synonym verwendeten Begriffe „Corporate Citizenship“ und „Corporate Social Responsibility“ an und führt zu den Aufgabenfeldern, Gründen und Motivation bzw. Nutzen und Erfolgsfaktoren von Corporate Citizenship.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- 1. Vorwort
- 2. Einleitung
- 2.1. Aufbau der Arbeit
- 2.2. Problemstellung
- 3. Grundlagen
- 3.1. Einführung
- 3.1.1. Der Begriff Ethik
- 3.1.2. Kurzdarstellung Wirtschaftsethik
- 3.1.3. Kurzdarstellung Unternehmensethik
- 3.2. Der Begriff „Moral“
- 3.3. Ethik vs. Wirtschaft
- 3.4. Begriff des Wirtschaftsbürgers und die Unternehmung als „guter Bürger“
- 3.5. „Verantwortung“ in der Gesellschaft
- 3.6. Bedeutung von Verantwortung
- 3.6.1. Der Ansatz von HOMANN/BLOME-DREES
- 3.6.2. Der Ansatz von ULRICH
- 3.6.3. Der Ansatz von STEINMANN/LÖHR
- 3.6.4. Kritische Würdigung
- 3.1. Einführung
- 4. Konzept des Corporate Citizenship
- 4.1. Der Begriff Corporate Citizenship
- 4.2. Drei Ebenen-Modell des Corporate Citizenship
- 4.3. Die Entstehung von Corporate Citizenship
- 4.4. Corporate Citizenship und Corporate Social Responsibility
- 4.5. Aufgabenfelder, Gründe und Motive für Corporate Citizenship
- 4.6. Nutzen bzw. Erfolgsfaktoren für Unternehmen durch Corporate Citizenship
- 5. Anforderungen bzw. Integrationsmöglichkeiten von Corporate Citizenship
- 5.1. Handlungsfelder von Corporate Citizenship
- 5.2. Gesellschaftlich formulierte Rollenanforderungen
- 5.3. Rechtliche Anforderungen
- 5.3.1. Steuerrechtliche Betrachtung
- 5.3.2. Weitere Rechtsgebiete
- 5.4. Sanktionspotenzial der gesellschaftlichen Anspruchsgruppen
- 5.5. Moralisches Handeln: Gewinnprinzip als Legitimation
- 5.6. Unternehmenskultur und Integration
- 5.6.1. Begriff Unternehmenskultur
- 5.6.2. Unternehmensleitbild als Grundlage für erfolgreich Implementierung
- 5.6.3. Integration von Corporate Citizenship in die Unternehmenskultur
- 5.6.4. Integrationsmodell bzw. -prozess von Corporate Citizenship
- 5.7. Die Kosten bzw. Controlling von Corporate Citizenship
- 6. Integrationskonzepte für Corporate Citizenship
- 6.1. Corporate Citizenship-Mix
- 6.1.1. Corporate Giving
- 6.1.2. Social Sponsoring
- 6.1.3. Cause Related Marketing (CRM)
- 6.1.4. Corporate Foundations
- 6.1.5. Corporate Volunteering (Nachbarschaftshilfe der Wirtschaft)
- 6.1.6. Social Commissioning
- 6.1.7. Community Joint-Venture bzw. Public Private Partnership
- 6.1.8. Social Lobbying
- 6.1.9. Venture Philanthropy
- 6.2. Kritik am Corporate Citizenship-Mix
- 6.3. Corporate Citizenship-Mix und Marketing-Mix
- 6.3.1. Systematische Einordnung des Corporate Citizenship in die Systematik des Marketing
- 6.3.2. Kurzdarstellung des Marketing-Mix
- 6.3.3. Differenzierung zum Marketing-Mix
- 6.3.4. Kritische Würdigung
- 6.1. Corporate Citizenship-Mix
- 7. Nachhaltigkeitsberichterstattung
- 7.1.1. Einführung
- 7.1.2. Begriff
- 7.2. Leitlinien und Vorgaben für die Nachhaltigkeitsberichterstattung
- 7.3. Zielgruppen, Leser und Kommunikationswege der Nachhaltigkeitsberichterstattung
- 7.4. Kritische Würdigung
- 8. Firmen-Praxisbeispiele für erfolgreiche Unternehmensintegration durch Corporate Citizenship
- 8.1: BASF-Gruppe
- 8.2. Würth-Gruppe
- 8.3. HOCHTIEF
- 9. Schlussbetrachtung
- 10. Quellen- und Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit der Integration von Unternehmen in das wirtschaftliche und gesellschaftliche Umfeld durch Corporate Citizenship. Sie analysiert den Begriff Corporate Citizenship und seine Bedeutung für Unternehmen. Ziel ist es, die verschiedenen Facetten des Corporate Citizenship zu beleuchten, seine Integrationsmöglichkeiten in die Unternehmenskultur aufzuzeigen und relevante Praxisbeispiele vorzustellen.
- Der Begriff Corporate Citizenship und seine Bedeutung für Unternehmen
- Die Integration von Corporate Citizenship in die Unternehmenskultur
- Die verschiedenen Facetten von Corporate Citizenship
- Die Rolle von Corporate Citizenship in der Nachhaltigkeitsberichterstattung
- Praxisbeispiele für erfolgreiche Unternehmensintegration durch Corporate Citizenship
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: In diesem Kapitel wird der Begriff Corporate Citizenship definiert und seine Bedeutung für Unternehmen erläutert. Es wird ein Drei-Ebenen-Modell des Corporate Citizenship vorgestellt und die Entstehung des Begriffs beleuchtet.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel befasst sich mit den Anforderungen und Integrationsmöglichkeiten von Corporate Citizenship. Es werden die Handlungsfelder des Corporate Citizenship, gesellschaftliche Rollenanforderungen und rechtliche Rahmenbedingungen analysiert.
- Kapitel 3: In diesem Kapitel werden verschiedene Integrationskonzepte für Corporate Citizenship vorgestellt, wie z.B. Corporate Giving, Social Sponsoring und Cause Related Marketing. Die Kritik am Corporate Citizenship-Mix und die Einordnung in den Marketing-Mix werden beleuchtet.
- Kapitel 4: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung als Instrument zur Kommunikation von Corporate Citizenship. Es werden Leitlinien und Vorgaben für die Berichterstattung sowie deren Zielgruppen und Kommunikationswege betrachtet.
- Kapitel 5: In diesem Kapitel werden Praxisbeispiele für erfolgreiche Unternehmensintegration durch Corporate Citizenship vorgestellt, wie z.B. die BASF-Gruppe, die Würth-Gruppe und HOCHTIEF.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themenfeldern der Unternehmensethik, insbesondere mit dem Begriff Corporate Citizenship. Die wichtigsten Themen sind: Unternehmensethik, Corporate Social Responsibility, Nachhaltigkeitsberichterstattung, Stakeholder-Engagement, Integration von Corporate Citizenship in die Unternehmenskultur, Praxisbeispiele für erfolgreiche Unternehmensintegration durch Corporate Citizenship.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Corporate Citizenship (CC) und Corporate Social Responsibility (CSR)?
Während CSR die gesamte gesellschaftliche Verantwortung eines Unternehmens umfasst, bezieht sich CC speziell auf das bürgerschaftliche Engagement eines Unternehmens in seinem lokalen oder gesellschaftlichen Umfeld, oft über das Kerngeschäft hinaus.
Wie lässt sich Corporate Citizenship in die Unternehmenskultur integrieren?
Die Integration erfolgt durch die Verankerung im Unternehmensleitbild, die Unterstützung durch das Management und die Einbeziehung der Mitarbeiter, beispielsweise durch Corporate Volunteering.
Was versteht man unter dem "Corporate Citizenship-Mix"?
Dies ist eine Kombination verschiedener Instrumente wie Corporate Giving (Spenden), Social Sponsoring, Cause Related Marketing und Corporate Foundations (Stiftungen).
Welchen Nutzen haben Unternehmen von Corporate Citizenship?
Zu den Vorteilen zählen eine verbesserte Reputation, eine stärkere Mitarbeiterbindung, eine höhere Akzeptanz im sozialen Umfeld und langfristige Wettbewerbsvorteile durch ein stabiles gesellschaftliches Netz.
Welche rechtlichen Aspekte sind bei Corporate Citizenship relevant?
Besonders wichtig sind steuerrechtliche Regelungen für Spenden und Sponsoring sowie Haftungsfragen bei ehrenamtlichem Engagement der Mitarbeiter (Corporate Volunteering).
Welche Rolle spielt die Nachhaltigkeitsberichterstattung?
Sie dient als Kommunikationsinstrument, um Stakeholder über die sozialen und ökologischen Aktivitäten des Unternehmens transparent zu informieren und Vertrauen aufzubauen.
- Quote paper
- Wilhelm Bernhard Dülm (Author), 2008, Unternehmensintegration in das wirtschaftliche und gesellschaftliche Umfeld durch Corporate Citizenship, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/89034