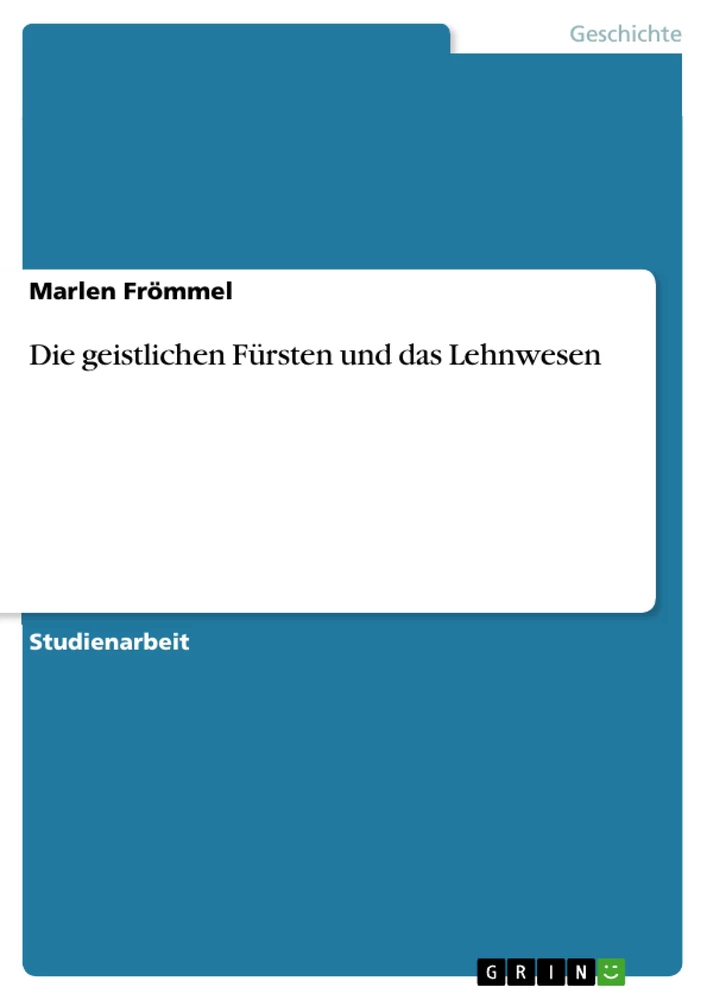„Unter Lehnswesen versteht man die Gesamtheit der rechtlichen Bestimmungen für das Verhältnis zwischen Lehnsherr und Vasall und deren Auswirkungen auf die staatlichen und gesellschaftlichen Strukturen.“ Im Hinblick auf die Wechselbeziehung des Königs/Kaisers als Lehnsherrn und den Reichsbischöfen sowie Reichsäbten als seinen Vasallen unterlagen die das Lehnswesen prägenden rechtlichen Bestimmungen im 11. und 12. Jahrhundert besonderen Wandlungen.
Das 11. Jahrhundert war dadurch gekennzeichnet, dass der König, aufgrund seiner sakralen Legitimation durch die Weihe bei der Krönung, die Herrschaft über die Reichskirche und somit auch über die Bischöfe und Äbte ausübte. So hatte Heinrich III. an die Kirchenpolitik Heinrichs II. angeknüpft, und mit Hilfe des Reichskirchensystems eine fast uneingeschränkte Herrschaft über die Reichskirche erlangt. Dabei hatte er „die Bischöfe und Äbte, die ihre Würden seiner Gunst verdankten, […] nicht nur als Diener der Kirche, sondern auch als Reichsbeamte betrachtet“ . Neben dem Lehnsband war in dieser Zeit also auch die Einheit von regnum und sacerdotium die Basis für die Beziehung des Reichsoberhauptes zu den Mitgliedern des zweiten Heerschildes und umgekehrt.
Durch die Kirchenreform, insbesondere durch den Investiturstreit, wurde diese Einheit jedoch zerstört, so dass am Ausgang des 12. Jahrhunderts allein das Lehnsband das Verhältnis des Königs zu den geistlichen Reichsfürsten bestimmte. „Als Markstein auf dem Weg zu dieser Feudalisierung der Reichskirchenverfassung gilt das Wormser Konkordat von 1122, das dem Königtum anstelle der im Investiturstreit verloren gegangenen sakralen Legitimation der Bischofserhebung durch Ring und Stab für die ihm verbliebenen weltlichen Herrschaftsrechte ein Leiheverhältnis zugestand“. Um diese zu stärken bzw. zu stabilisieren, musste das Lehnrecht auch seine Verankerung in der Reichsverfassung finden.
In dieser Arbeit sollen die Determinanten, die die jeweilige Stellung der geistlichen Fürsten im Lehnswesen bestimmten, untersucht werden, sowie die sich daraus ergebenden Folgen für das Verhältnis von König und geistlichen Reichsfürsten. Im Einzelnen bilden daher das Reichskirchensystem, der Investiturstreit und das Wormser Konkordat den groben Rahmen für die Analyse der Stellung der Inhaber des zweiten Heerschildes im Lehnswesen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der König und die Reichskirche mit ihren geistlichen Fürsten
- Der rechtliche Rahmen: das ottonisch-salische Reichskirchensystem
- Das Verhältnis zwischen Bischof und König
- Die königliche Investitur der Bischöfe und die Bedeutung für ihr Verhältnis
- Kirchenrechtliche Beurteilung: Erwachen der Kritik
- Der Erzbischof von Köln: Anno II. (1056-1075)
- Der Investiturstreit: Gregor VII. und Heinrich IV. (1073-1085)
- Reichstag in Worms: Der Brief des Episkopats an den Papst
- Der Fortgang des Investiturstreites unter Gregor VII.
- Der Erzbischof von Köln: Friedrich I. (1100-1131)
- Auf dem Weg zum Wormser Konkordat
- Die Zwidderstellung der Bischöfe in den Jahren 1111 und 1119
- Das „Privileg“ von Ponte Mammolo
- Der Einigungsversuch in Mouzon
- Der Erzbischof von Mainz: Adalbert (1111-1137)
- Die Zwidderstellung der Bischöfe in den Jahren 1111 und 1119
- Das Wormser Konkordat
- Vorgeschichte: Die Lösung in Frankreich und England
- Inhalt
- Bedeutung für das Verhältnis von Papst- und Kaisertum
- Die lehnrechtliche Deutung: Bischöfe als Reichsfürsten im Lehnswesen
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Stellung geistlicher Fürsten im Lehnswesen des 11. und 12. Jahrhunderts und deren Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen König und geistlichen Reichsfürsten. Die Analyse konzentriert sich auf die Entwicklung des Verhältnisses von Königtum und Reichskirche, die durch das ottonisch-salische Reichskirchensystem, den Investiturstreit und das Wormser Konkordat geprägt wurde.
- Das ottonisch-salische Reichskirchensystem und seine Auswirkungen auf die Beziehung zwischen König und Bischöfen.
- Der Investiturstreit und seine Bedeutung für die Veränderung der Machtverhältnisse zwischen Papsttum, Königtum und geistlichen Fürsten.
- Die Rolle des Lehnswesens in der Gestaltung des Verhältnisses zwischen König und geistlichen Reichsfürsten.
- Die Entwicklung des Verhältnisses von regnum und sacerdotium im 11. und 12. Jahrhundert.
- Das Wormser Konkordat als Wendepunkt in der Beziehung zwischen Kaiser und Papst und dessen Auswirkungen auf das Lehnswesen.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung definiert den Begriff des Lehnswesens und skizziert die Veränderungen im Verhältnis zwischen König/Kaiser und geistlichen Fürsten im 11. und 12. Jahrhundert. Sie hebt die Bedeutung des ottonisch-salischen Reichskirchensystems, des Investiturstreits und des Wormser Konkordats für die Analyse hervor und benennt die Forschungsfrage nach den Determinanten der Stellung geistlicher Fürsten im Lehnswesen und den daraus resultierenden Folgen für das Verhältnis von König und geistlichen Reichsfürsten.
Der König und die Reichskirche mit ihren geistlichen Fürsten: Dieses Kapitel beschreibt die enge Verflechtung weltlicher und kirchlicher Gewalten im 11. Jahrhundert. Es analysiert das ottonisch-salische Reichskirchensystem als Instrument zur Sicherung der königlichen Machtbasis und die Rolle der Bischöfe als Berater und Herrschaftsträger. Das Kapitel beleuchtet auch die königliche Einflussnahme auf die Bischofswahl und die Grenzen dieser Einflussnahme aufgrund von adligen Interessen und kanonischen Wahlprinzipien. Die Bedeutung der Hofkapelle als Schaltstelle zwischen Königtum und Episkopat wird ebenfalls hervorgehoben.
Der Investiturstreit: Gregor VII. und Heinrich IV. (1073-1085): Dieses Kapitel behandelt den Investiturstreit als zentralen Konflikt zwischen Papst und Kaiser um die Besetzung von kirchlichen Ämtern. Es analysiert die verschiedenen Phasen des Streits und die Rolle wichtiger Persönlichkeiten wie Gregor VII. und Heinrich IV. Der Konflikt wird im Kontext der Verschiebung der Machtverhältnisse zwischen Königtum und Papsttum sowie der Auswirkungen auf das Lehnswesen betrachtet.
Auf dem Weg zum Wormser Konkordat: Dieses Kapitel beschreibt die Versuche einer Einigung zwischen Papsttum und Kaisertum vor dem Wormser Konkordat. Es beleuchtet die schwierige Position der Bischöfe und die Bedeutung von Versuchen zur Einigung wie dem „Privileg“ von Ponte Mammolo und dem Einigungsversuch in Mouzon. Das Kapitel analysiert auch die Rolle von wichtigen Persönlichkeiten wie Adalbert von Mainz.
Das Wormser Konkordat: Dieses Kapitel analysiert das Wormser Konkordat von 1122 als Kompromiss zwischen Papst und Kaiser. Es untersucht die Vorgeschichte des Konkordats, insbesondere die Lösungen in Frankreich und England. Der Inhalt des Konkordats wird erläutert, und seine Bedeutung für das Verhältnis von Papst- und Kaisertum wird eingehend diskutiert.
Die lehnrechtliche Deutung: Bischöfe als Reichsfürsten im Lehnswesen: Dieses Kapitel widmet sich der lehnrechtlichen Betrachtung der Bischöfe als Reichsfürsten. Es analysiert die Auswirkungen der Veränderungen im Verhältnis zwischen König und Kirche auf das Lehnswesen und umgekehrt.
Schlüsselwörter
Reichskirche, Investiturstreit, Wormser Konkordat, Lehnswesen, geistliche Fürsten, König, Kaiser, Papst, regnum, sacerdotium, ottonisch-salisches Reichskirchensystem, Bischofswahl, Hofkapelle.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Die Stellung geistlicher Fürsten im Lehnswesen des 11. und 12. Jahrhunderts
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Stellung geistlicher Fürsten im Lehnswesen des 11. und 12. Jahrhunderts und deren Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen König und geistlichen Reichsfürsten. Der Fokus liegt auf der Entwicklung des Verhältnisses von Königtum und Reichskirche, geprägt durch das ottonisch-salische Reichskirchensystem, den Investiturstreit und das Wormser Konkordat.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt das ottonisch-salische Reichskirchensystem und seine Auswirkungen auf die Beziehung zwischen König und Bischöfen; den Investiturstreit und seine Bedeutung für die Veränderung der Machtverhältnisse zwischen Papsttum, Königtum und geistlichen Fürsten; die Rolle des Lehnswesens in der Gestaltung des Verhältnisses zwischen König und geistlichen Reichsfürsten; die Entwicklung des Verhältnisses von regnum und sacerdotium im 11. und 12. Jahrhundert; und das Wormser Konkordat als Wendepunkt in der Beziehung zwischen Kaiser und Papst und dessen Auswirkungen auf das Lehnswesen.
Welche Zeitperiode wird untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf das 11. und 12. Jahrhundert.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Reichskirche, Investiturstreit, Wormser Konkordat, Lehnswesen, geistliche Fürsten, König, Kaiser, Papst, regnum, sacerdotium, ottonisch-salisches Reichskirchensystem, Bischofswahl und Hofkapelle.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, Kapitel über den König und die Reichskirche, den Investiturstreit, den Weg zum Wormser Konkordat, das Wormser Konkordat selbst, die lehnrechtliche Deutung der Bischöfe als Reichsfürsten und ein Resümee. Jedes Kapitel beinhaltet eine Zusammenfassung.
Was ist das ottonisch-salische Reichskirchensystem?
Das ottonisch-salische Reichskirchensystem beschreibt die enge Verflechtung weltlicher und kirchlicher Gewalten im 11. Jahrhundert. Es diente der Sicherung der königlichen Machtbasis, wobei Bischöfe als Berater und Herrschaftsträger fungierten. Die königliche Einflussnahme auf die Bischofswahl war jedoch begrenzt durch adlige Interessen und kanonische Wahlprinzipien.
Was war der Investiturstreit?
Der Investiturstreit war ein zentraler Konflikt zwischen Papst und Kaiser um die Besetzung kirchlicher Ämter. Er wird im Kontext der Verschiebung der Machtverhältnisse zwischen Königtum und Papsttum sowie der Auswirkungen auf das Lehnswesen betrachtet.
Was ist das Wormser Konkordat?
Das Wormser Konkordat von 1122 war ein Kompromiss zwischen Papst und Kaiser, der die Vorgeschichte in Frankreich und England aufgreift. Es wird erläutert, wie der Inhalt des Konkordats das Verhältnis von Papst- und Kaisertum beeinflusste.
Welche Rolle spielten die Bischöfe im Lehnswesen?
Die Bischöfe wurden als Reichsfürsten im Lehnswesen betrachtet. Die Arbeit analysiert die Auswirkungen der Veränderungen im Verhältnis zwischen König und Kirche auf das Lehnswesen und umgekehrt.
Welche Forschungsfrage wird gestellt?
Die Arbeit untersucht die Determinanten der Stellung geistlicher Fürsten im Lehnswesen und die daraus resultierenden Folgen für das Verhältnis von König und geistlichen Reichsfürsten.
- Citation du texte
- Marlen Frömmel (Auteur), 2006, Die geistlichen Fürsten und das Lehnwesen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/89086