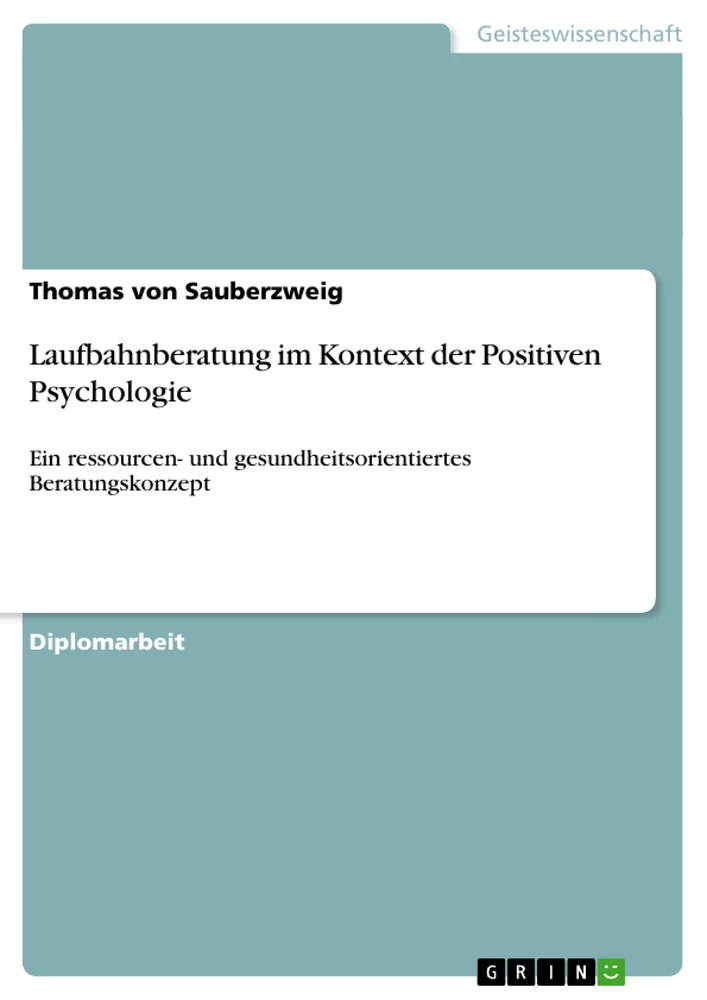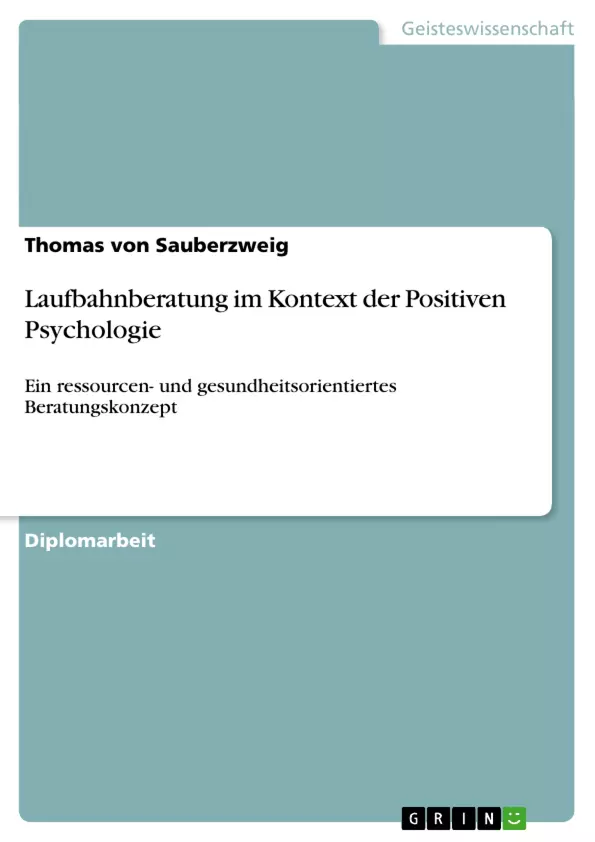Die vorliegende Arbeit geht der Frage nach, wie Kunden im Beratungsprozess dynamisiert, d.h. gestärkt und zu self-efficacy angeleitet werden können. Es geht um die Verstärkung und Erweiterung von autonomer Gestaltungsfähigkeit, von Selbstregulationskompetenz und positiver Kontrollüberzeugungen. Ziel ist die Formulierung eines Beratungskonzeptes auf Grundlage ressourcen- und gesundheitsorientierter Ansätze.
Mittels Literaturrecherche wurden die wesentlichen Grundlagen des Themas erarbeitet. Philosophische Grundsätze, Aspekte der Entwicklungs- und Persönlichkeitspsychologie sowie ausgewählte Themenfelder wie Identität, Coping und Motivation sind Vorspann eines vertieften Einblicks in die Gesundheitspsychologie und in die Positiven Psychologie. Anschliessend folgen zentrale Theorien und Grundhaltungen wie auch Modelle zu Beratung.
In einem ersten Konzeptfenster werden die Beratungsgestaltung und ein Handlungsmodell erarbeitet. Dieser werden durch Qualitätskriterien ergänzt, welche als Extrakt in einem Ethikkodex festgehalten sind. Im zweiten Konzeptfenster wird eine anwendungsorientierte Konzeptverdichtung formuliert, welche sich aus dem abgebildeten ‚Positiven Beratungsmodell’ ergibt.
Die Hypothesen der Entwicklungsförderung, einer dynamisierenden Handlungsfähigkeit und der Stärkung von Wohlbefinden des Kunden können theoriegeleitete untermauert werden.
Erste Ergebnisse im Einsatz des Positiven Beratungskonzeptes zeigen Erfolge in der self-efficacy der Kunden und weisen auf eine Stärkung und Nachhaltigkeit in (laufbahnspezifischen) Autonomiebestrebungen hin. Hier wäre eine empirische Überprüfung einer konsequenten Beratung auf Basis der Positiven Psychologie ein nächster interessanter Schritt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1.1. Formulierung der Fragestellung und der Hypothesen
- Theoriefenster I
- 2. Philosophischer Grundsatz
- 3. Psychologische Ansätze
- 3.1. Entwicklungspsychologie / Ausgewählte Aspekte
- 3.2. Persönlichkeitspsychologie / Ausgewählte Aspekte
- 3.2.1. Identität, Selbst, Selbstkonzept und Selbstwert
- 3.2.2. Coping und Coping-Konzepte
- 3.2.3. Motivation und Willen
- 4. Gesundheitspsychologie
- 4.1. Definition und Abriss
- 4.2. Einflussfaktoren von Gesundheit und Krankheit
- 4.3. Stress aus Sicht der Salutogenese
- 4.4. Salutogenese, Kohärenz und Resilienzforschung
- 4.5. Ressourcen
- 4.6. Ressourcenmodelle
- 4.7. GRR's, generalized resistance reccources
- 5. Die Positive Psychologie
- 5.1. Definition und Theorie
- 5.2. Wissenschaftliche Perspektive / Stand der Forschung
- 5.3. Charakterstärken und Tugenden
- 5.4. Stärken, Signaturstärken und Stärkenprofile
- 5.5. Flow
- Theoriefenster II
- 6. Theorien und Haltungen zu Beratung
- 6.1. Menschenbild
- 6.2. Konstruktivismus
- 6.3. Persönlichkeitstheorien
- 6.4. Personenzentrierter, nicht direktiver Ansatz / person-centered counseling
- 6.5. Systemisch-konstruktivistischer Ansatz
- 6.6. Der lösungs- und ressourcenorientierte Ansatz
- 7. Theorien und Modelle der Beratung
- 7.1. Definitionen
- 7.2. Arbeit und Berufs-Laufbahn
- 7.3. Laufbahn - Beratung
- 7.4. Berufswahltheorien und -konzepte
- 7.5. Theorien und Modelle zu Entscheidung und Handlung
- 6. Theorien und Haltungen zu Beratung
- Konzeptfenster I
- 8. Beratungsgestaltung
- 8.1. Handlungsraum und Setting
- 8.2. Beziehungsgestaltung
- 8.2.1. Vertrauen
- 8.2.2. Gespräch
- 8.2.3. Rollenklärung und Determinanten
- 8.2.4. Klient, Kunde oder Kooperationspartner
- 8.3. Beratervariablen
- 9. Handlungsmodell
- 9.1. Auftragsklärung
- 9.1.1. Prozessgestaltung
- 9.1.2. Zielerarbeitung, Zieldefinition
- 9.2. Handlungsansätze der Positiven Psychologie
- 9.2.1. Stärkung der Eigenverantwortung
- 9.2.2. Ressourcenaufbau
- 9.2.3. Kompetenzentwicklung
- 9.3. Identitätssäulen / Stadien bewusster Veränderung
- 9.4. Zum Handeln anleiten
- 9.5. Lösungsvision
- 9.6. Instrumente
- 9.6.1. Diagnostik
- 9.6.2. Methodenvielfalt und Methodenflexibilität
- 9.6.3. Instrumentenpool (Spieltrieb, Visualisierung, etc.)
- 9.1. Auftragsklärung
- 10. Qualitätskriterien
- 10.1. Definition Evaluation und Qualitätssicherung
- 10.2. Qualitätsebenen
- 10.3. Qualitätsstandards / Das Berner Beratungsmodell
- 10.4. Ethikkodex
- 8. Beratungsgestaltung
- Konzeptfenster II
- 11. Konzeptverdichtung
- 12. Konzept Positives Beratungsmodell
- 13. Diskussion
- 13.1. Beantwortung der Fragestellung
- 13.2. Bezugnahme zu den Hypothesen
- 13.3. Diskussion der Ergebnisse und Bezugnahme zum theoretischen Teil
- 13.4. Weiterführende Fragen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Möglichkeiten der positiven Psychologie in der Beratung. Sie analysiert die Entstehung der positiven Psychologie, ihre wichtigsten Konzepte und Methoden und zeigt, wie sie im Beratungssetting zum Einsatz gebracht werden kann.
- Die Integration der positiven Psychologie in die Beratungspraxis
- Die Bedeutung von Ressourcen und Stärken für die Bewältigung von Herausforderungen
- Die Anwendung von Methoden und Instrumenten der positiven Psychologie im Beratungssetting
- Die Entwicklung eines positiven Beratungsmodells
- Die Rolle von Werten und Zielen in der Beratung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein, stellt die Fragestellung und die Hypothesen vor und bietet eine grundlegende Orientierung im Kontext der Beratung und der Bedeutung der positiven Psychologie. Das erste Theoriefenster widmet sich den theoretischen Grundlagen der Arbeit. Es beleuchtet philosophische Grundprinzipien, relevante Ansätze aus der Entwicklungspsychologie und der Persönlichkeitspsychologie, sowie die Gesundheitspsychologie und ihre zentralen Konzepte.
Das zweite Theoriefenster fokussiert auf Theorien und Haltungen zu Beratung, wobei es unterschiedliche Ansätze wie den konstruktivistischen, den personenzentrierten und den systemisch-konstruktivistischen Ansatz beleuchtet. Es werden auch Theorien und Modelle der Beratung im Allgemeinen vorgestellt, inklusive Definitionen, der Bedeutung von Arbeit und Berufslaufbahn, sowie verschiedener Berufswahltheorien und Konzepte.
Das Konzeptfenster I befasst sich mit der Beratungsgestaltung und dem Handlungsmodell. Hier geht es um den Handlungsraum, die Beziehungsgestaltung, Beratervariablen, die Auftragsklärung, Handlungsansätze der positiven Psychologie, die Identitätssäulen und den Umgang mit Ressourcen. Der Abschluss dieses Teils widmet sich Qualitätskriterien, Definitionen von Evaluation und Qualitätssicherung, Qualitätsstandards und dem Ethikkodex.
Schlüsselwörter
Positive Psychologie, Beratung, Ressourcenorientierung, Stärkenbasierte Beratung, Lösungsorientierung, Gesundheitspsychologie, Salutogenese, Resilienz, Berufswahl, Lebensqualität, Lebensziele, Selbstentwicklung
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Laufbahnberatung auf Basis der Positiven Psychologie?
Ziel ist die Stärkung der autonomen Gestaltungsfähigkeit, der Selbstregulationskompetenz und der Self-Efficacy (Selbstwirksamkeit) des Kunden durch ressourcen- und gesundheitsorientierte Ansätze.
Welche Rolle spielt die Salutogenese in der Beratung?
Die Salutogenese fokussiert auf Faktoren, die Gesundheit erhalten und fördern, statt nur Krankheiten zu betrachten. Konzepte wie Kohärenzgefühl und Resilienz sind hierbei zentral.
Was versteht man unter "Signaturstärken"?
Signaturstärken sind individuelle Charakterstärken, die für eine Person besonders kennzeichnend sind. Ihre Identifikation und Nutzung im Berufsleben fördert das Wohlbefinden und den Erfolg.
Wie unterscheidet sich der personenzentrierte vom systemischen Beratungsansatz?
Der personenzentrierte Ansatz stellt das Individuum und seine Selbstentfaltung in den Mittelpunkt, während der systemisch-konstruktivistische Ansatz den Menschen in seinem sozialen Kontext und seinen Beziehungssystemen betrachtet.
Was beinhaltet ein "Positives Beratungsmodell"?
Es integriert Methoden wie Ressourcenaufbau, Stärkenanalyse und Lösungsvisionen, um Kunden zu dynamisieren und nachhaltig in ihren Autonomiebestrebungen zu unterstützen.
Warum ist "Flow" in der Laufbahnberatung wichtig?
Flow beschreibt den Zustand des völligen Aufgehens in einer Tätigkeit. In der Beratung hilft das Konzept dabei, Berufsfelder zu finden, die optimalen Herausforderungen und persönliche Erfüllung bieten.
- Citation du texte
- Thomas von Sauberzweig (Auteur), 2007, Laufbahnberatung im Kontext der Positiven Psychologie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/89147