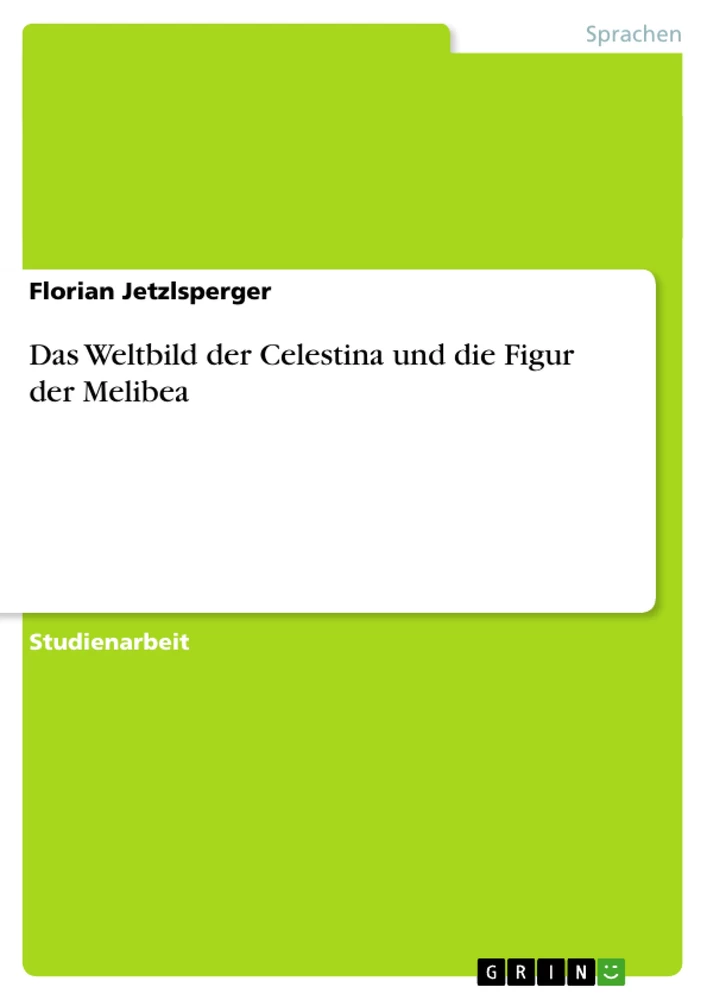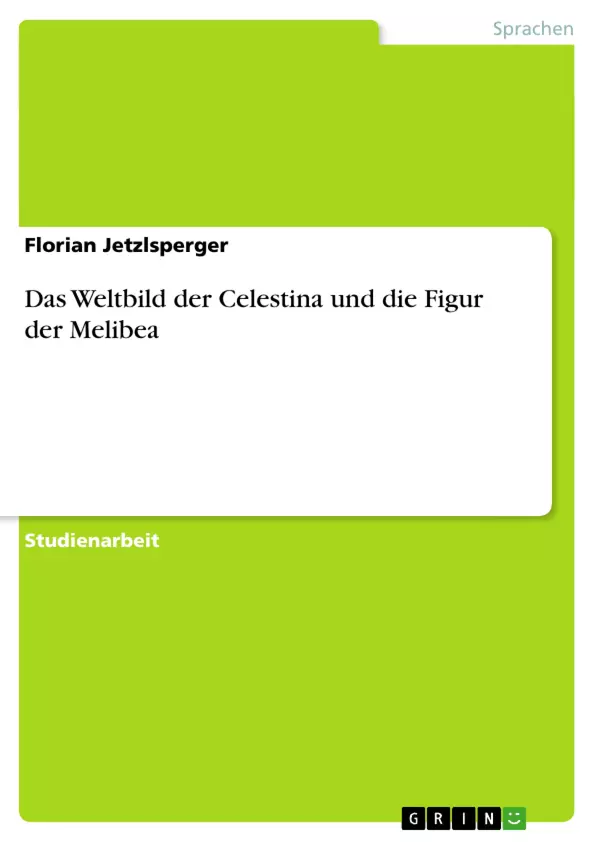Fernando de Rojas' Werk "La Celestina" (1499) wird meist als Ausdruck eines überaus negativen Weltbildes des 15./16. Jahrhunderts verstanden. Diese Arbeit soll den Pessimismus des Werkes aufzeigen. Rojas zeigt mit "La Celestina" zunächst die zur Zeit gängigen Verurteilungen des "amor loco", der körperlichen Liebe und die Konsequenzen aus einer solchen verirrten Liebe anhand der Liebenden Calisto und Melibea auf. Neben dieser traditionellen Degradierung bestimmter Beziehungsformen degradiert Rojas überdies aber auch eigentlich positive Werte wie Freundschaft, etc.. Die einzige Person, die diesem negativen, bzw. stereotypen Weltbild des 15. Jahrhunderts nicht entspricht ist Melibea - die Geliebte von Calisto. Sie scheint die einzige Protagonistin innerhalb der Geschichte zu sein, die aus ihrem Handeln Konsequenzen zieht und zumindest ihr Ende selbst aund außerhalb der gängigen Konventionen bestimmen kann - wenn auch durch Selbstmord. Diese Arbeit stellt nicht nur die gesellschaftlichen Konventionen der Zeit Fernando de Rojas dar, sondern zeigt auch dessen Kritik derer und den Interpretationsversuch einer Loslösung dieser verderblichen Normen auf.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitende Fragestellung
- Das negative Weltbild der „Celestina“
- Bezug Rojas auf Petrarca
- Das Wirken der Fortuna
- Degradierung positiver Werte (Liebe, Freundschaft, Loyalität)
- Klage Pleberios
- Die Figur der Melibea als positives Gegengewicht
- Die Liebe zu Calisto
- Erfüllung der Sehnsüchte/Erhalt des Ehrgefühls Melibeas
- Entwicklung von Unabhängigkeit/Freiheit
- Der Selbstmord als Manifestation von Liebe und Einsicht
- Die Liebe zu Calisto
- Synthese
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert das pessimistische Weltbild in Fernando de Rojas' „La Celestina“ und untersucht, wie die Figur der Melibea als positives Gegengewicht zu dieser düsteren Grundhaltung wirkt.
- Das pessimistische Weltbild in „La Celestina“
- Der Einfluss von Petrarcas Weltanschauung
- Die Rolle der Fortuna
- Die Degradierung positiver Werte
- Melibea als Gegengewicht
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitende Fragestellung
Die Arbeit untersucht die Düsternis in „La Celestina“ und beleuchtet die Frage, ob das Werk von einem dominierenden Pessimismus geprägt ist. Der Autor geht auf die Bezüge zu Petrarcas Weltanschauung ein, insbesondere dessen Gedanken zur Unmäßigkeit des Menschen und zur Rolle der Fortuna.
Das negative Weltbild der „Celestina“
Dieser Abschnitt beleuchtet die Degradierung positiver Werte wie Liebe, Freundschaft und Loyalität in „La Celestina“. Er zeigt, wie die Charaktere durch ihre Handlungsweisen in ein negatives Schicksal geraten.
Die Figur der Melibea als positives Gegengewicht
Hier wird die Figur der Melibea als Kontrast zum pessimistischen Gesamtbild dargestellt. Der Autor analysiert die Bedeutung ihrer Liebe zu Calisto, die ihr die Erfüllung ihrer Sehnsüchte und ein Gefühl der Freiheit ermöglicht. Der Abschnitt befasst sich zudem mit dem Selbstmord Melibeas und stellt dessen Motivation in den Kontext der Liebe und Einsicht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen „La Celestina“, Fernando de Rojas, pessimistisches Weltbild, Petrarca, Fortuna, Liebe, Freundschaft, Loyalität, Degradierung, Melibea, Selbstmord, Liebe und Einsicht.
Häufig gestellte Fragen
Welches Weltbild vermittelt das Werk „La Celestina“?
Das Werk von Fernando de Rojas vermittelt ein überaus negatives und pessimistisches Weltbild, in dem positive Werte wie Liebe und Freundschaft degradiert werden.
Welche Rolle spielt die Figur der Melibea in der Geschichte?
Melibea fungiert als positives Gegengewicht; sie ist die einzige Figur, die Unabhängigkeit entwickelt und Konsequenzen aus ihrem Handeln zieht.
Was bedeutet „amor loco“ im Kontext von Celestina?
Es bezeichnet die „verirrte“ oder rein körperliche Liebe, die im 15. Jahrhundert moralisch verurteilt wurde und im Werk zu Zerstörung führt.
Warum ist der Selbstmord Melibeas von Bedeutung?
Ihr Selbstmord wird als Manifestation von Liebe und Einsicht interpretiert, mit der sie sich von den verderblichen gesellschaftlichen Normen ihrer Zeit löst.
Welchen Einfluss hatte Petrarca auf Fernando de Rojas?
Rojas bezieht sich auf Petrarcas Gedanken zum Wirken der Fortuna (Schicksal) und zur Unbeständigkeit des menschlichen Glücks.
- Quote paper
- Magister Artium Florian Jetzlsperger (Author), 2004, Das Weltbild der Celestina und die Figur der Melibea, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/89210