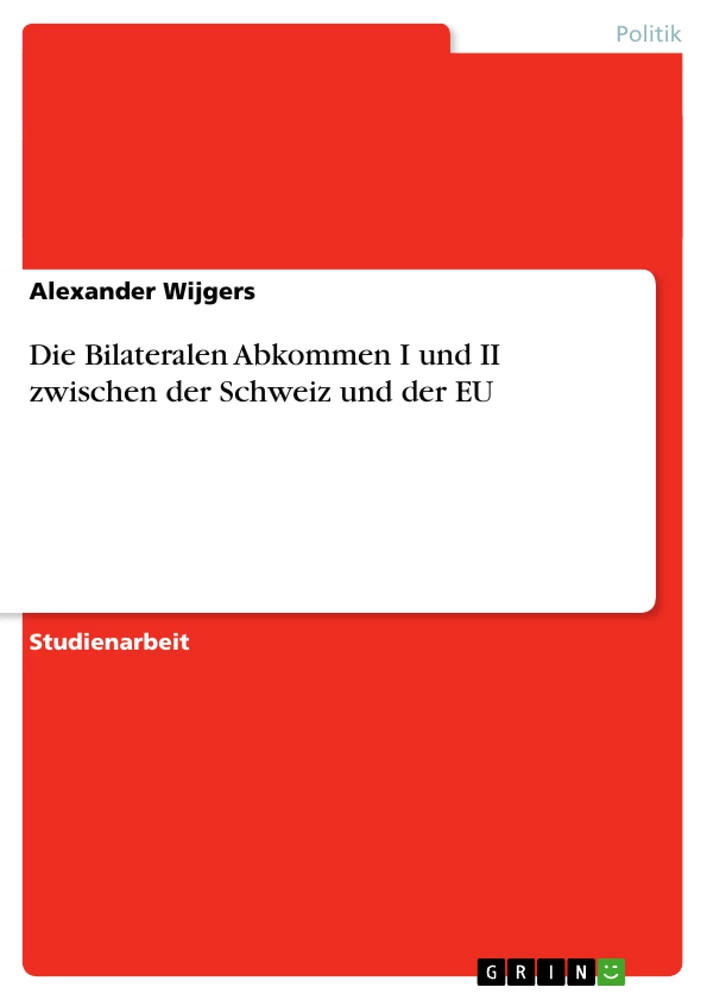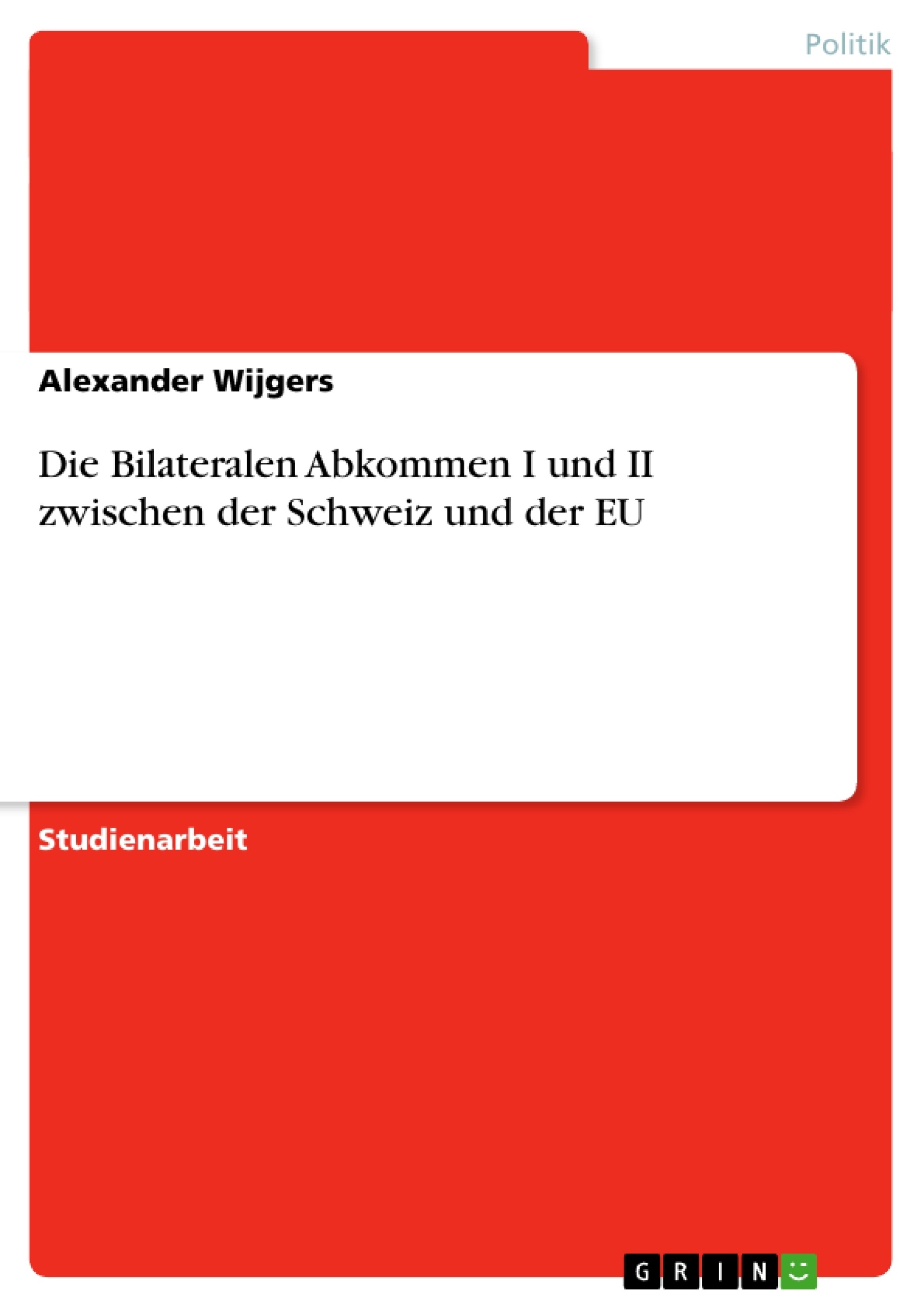Die Schweiz und die EU rücken wieder näher zusammen, so oder ähnlich könnten die Schlagzeilen nach den Abschluss der Bilateralen Verträge I und der Bilateralen Verträge II lauten. Für die Schweiz war dies jedoch ein langer steiniger Weg, der immer wieder von innenpolitischen Problemen gesteuert wurde. Die EU ist für die Schweiz aufgrund der geographischen Nähe der Wirtschaftspartner Nummer eins.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Ablehnung des EWR - Beitritts
- Bilaterale Verträge I
- Chronologie
- Forschung
- Öffentliches Beschaffungswesen
- Technische Handelshemmnisse
- Landwirtschaft
- Luftverkehr
- Landverkehr
- Personenverkehr
- Bilateralen Verträge II
- Chronologie
- Schengen / Dublin
- Zinsbesteuerung
- Betrugsbekämpfung
- Verarbeitete Landwirtschaft
- Umwelt
- Statistik
- MEDIA
- Bildung, Berufsbildung, Jugend
- Ruhegehälter
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Bilateralen Verträgen I und II zwischen der Schweiz und der EU. Ziel ist es, die Inhalte der beiden Abkommen, ihre Entstehung, ihre Verhandlungsschwierigkeiten sowie ihre Vor- und Nachteile aufzuzeigen.
- Die Ablehnung des EWR-Beitritts durch die Schweiz als Ausgangspunkt für die bilateralen Verträge
- Die Inhalte der Bilateralen Verträge I und II sowie ihre Auswirkungen auf die Schweizer Wirtschaft und Politik
- Die Verhandlungsschwierigkeiten und die Rolle der Direktdemokratie in der schweizerischen Politik
- Die Vor- und Nachteile der bilateralen Verträge für die Schweiz
- Die Bedeutung der bilateralen Verträge für die Zukunft der Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext der bilateralen Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU dar und verdeutlicht die Bedeutung der EU als wichtigster Wirtschaftspartner für die Schweiz. Sie führt die Ablehnung des EWR-Beitritts durch die Schweizer Bevölkerung im Jahr 1992 ein, der als Wendepunkt für die Entwicklung der bilateralen Beziehungen gilt.
Das zweite Kapitel analysiert die Folgen der Ablehnung des EWR-Beitritts für die Schweiz. Es werden sowohl die negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Beziehungen zur EU als auch die positiven Aspekte, wie z.B. die Stärkung der Schweizer Neutralität im Kontext der GATT-Verhandlungen, beleuchtet.
Das dritte Kapitel widmet sich den Bilateralen Verträgen I. Es beschreibt die Chronologie der Verhandlungen, die Inhalte der Abkommen in verschiedenen Bereichen wie Forschung, öffentliches Beschaffungswesen, technische Handelshemmnisse, Landwirtschaft, Luftverkehr, Landverkehr und Personenverkehr und beleuchtet die Vor- und Nachteile dieser Verträge für die Schweiz.
Das vierte Kapitel setzt sich mit den Bilateralen Verträgen II auseinander. Es beschreibt die Verhandlungsschritte, die Inhalte der Abkommen in Bereichen wie Schengen/Dublin, Zinsbesteuerung, Betrugsbekämpfung, verarbeitete Landwirtschaft, Umwelt, Statistik, MEDIA, Bildung, Berufsbildung, Jugend und Ruhegehälter und beleuchtet die Bedeutung dieser Verträge für die weitere Integration der Schweiz in den europäischen Raum.
Schlüsselwörter
Bilaterale Verträge, Schweiz, EU, EWR, Direktdemokratie, Wirtschaft, Politik, Integration, Handel, Landwirtschaft, Umwelt, Bildung, Schengen/Dublin, Zinsbesteuerung, Betrugsbekämpfung, Forschung, Öffentliches Beschaffungswesen, Medien, Ruhegehälter, Personenverkehr.
Häufig gestellte Fragen
Warum hat die Schweiz den EWR-Beitritt 1992 abgelehnt?
Die Ablehnung erfolgte durch eine Volksabstimmung und war geprägt von innenpolitischen Bedenken hinsichtlich Souveränität und Neutralität, was den Weg für die bilateralen Abkommen ebnete.
Was beinhalten die Bilateralen Verträge I?
Die Bilateralen I (1999) umfassen sieben Abkommen, darunter den Personenfreizügigkeitsverkehr, Land- und Luftverkehr, Landwirtschaft sowie technische Handelshemmnisse und Forschung.
Welche Themen decken die Bilateralen Verträge II ab?
Die Bilateralen II (2004) erweitern die Zusammenarbeit auf Bereiche wie Schengen/Dublin (Sicherheit und Asyl), Zinsbesteuerung, Umwelt, Bildung und die MEDIA-Programme.
Wie wichtig ist die EU als Wirtschaftspartner für die Schweiz?
Aufgrund der geografischen Lage und engen wirtschaftlichen Verflechtung ist die EU der wichtigste Handelspartner der Schweiz, was die Notwendigkeit der Verträge unterstreicht.
Welche Rolle spielt die Direktdemokratie bei den Verhandlungen?
In der Schweiz müssen wichtige internationale Verträge oft vors Volk, was die Verhandlungen mit der EU komplexer macht, da innenpolitische Mehrheiten stets berücksichtigt werden müssen.
Was bedeutet das Schengen/Dublin-Abkommen für die Schweiz?
Es ermöglicht der Schweiz die Teilnahme am grenzüberschreitenden visumfreien Raum (Schengen) und regelt die Zuständigkeit für Asylverfahren innerhalb Europas (Dublin).
- Quote paper
- Alexander Wijgers (Author), 2005, Die Bilateralen Abkommen I und II zwischen der Schweiz und der EU, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/89333