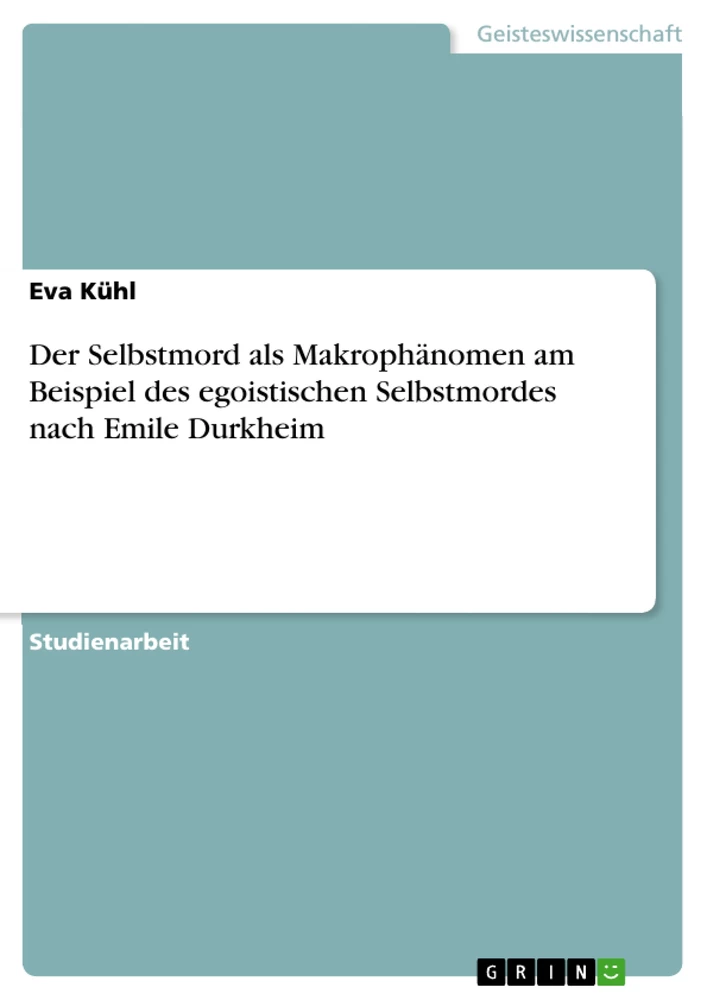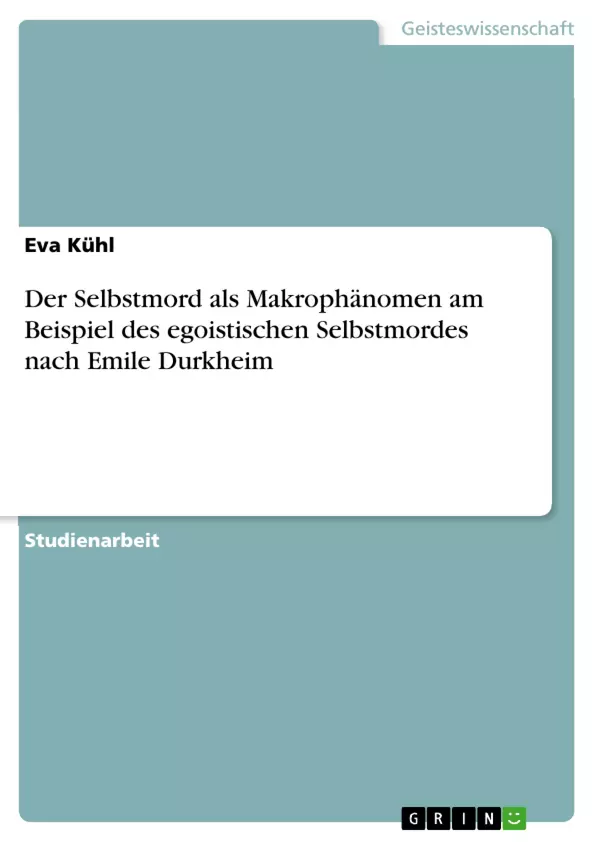Das Phänomen des Selbstmordes kann von unterschiedlichen Standpunkten aus betrachtet werden. Man kann nach den persönlichen, psychologischen Ursachen suchen, die eine einzelne Person dazu bringen, sich das Leben zu nehmen, oder fragen, unter welchen Umständen im spezifischen Umfeld des Einzelnen es dazu kommt. Auf der anderen Seite können gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge untersucht werden, die möglicherweise auf eine größere Gruppe von Menschen denselben Effekt ausüben, der schließlich zum Selbstmord führen kann.
Letzteres hat der Franzose Emile Durkheim in seinem Werk Der Selbstmord aus dem Jahr 1897 getan. Mit der vorliegenden Arbeit soll diese Betrachtungsweise des Selbstmordes ausgehend von Durkheims Ansätzen erläutert werden. Durkheim untersucht den Selbstmord auf der Ebene größerer Gruppen bzw. ganzer Gesellschaften, also auf der Ebene der Makrosoziologie, als ein Phänomen, das in erster Linie soziale Ursachen hat und nicht entscheidend auf den seelischen Zustand einzelner Personen innerhalb der Gruppen zurückzuführen ist.
Bevor ich zur Darstellung von Durkheims Werk komme, möchte ich zunächst den Begriff ,Selbstmord’ allgemein definieren, d.h. versuchen, die Frage zu klären, unter welchen Umständen oder Voraussetzungen man überhaupt von Selbstmord spricht.
Dann werde ich Durkheims Ansatz über die Ursachen der Selbstmordraten verschiedener Gruppen und seine Begründungen erläutern und dabei speziell auf die von ihm genannte Form des egoistischen Selbstmordes eingehen. Anschließend werden einige spätere Meinungen angeführt, die sich kritisch mit Durkheims Theorien auseinandersetzen.
Bevor ich Emile Durkheims Ansichten zum Thema Selbstmord behandele, möchte ich mich hier zunächst mit der Frage beschäftigen, wie der Begriff ‚Selbstmord’ definiert werden kann und welche Aspekte berücksichtigt werden müssen, um ihn gegen andere Handlungen, die ähnliche Merkmale aufweisen wie eine Selbstmordhandlung oder die tödlich enden, abzugrenzen. Durkheim selbst nimmt zu Beginn seines Werkes eine Definition vor, in die er verschiedene Merkmale einer selbstmörderischen Handlung einbezieht. Er beginnt mit der Aktivität des vom Tod Betroffenen; Selbstmord ist also „jede[r] Tod, der mittelbar oder unmittelbar auf eine Handlung oder Unterlassung zurückgeht, deren Urheber das Opfer selbst ist“. Genauso sieht auch der erste Definitionsversuch von Christa Lindner-Braun (1990) aus, sie schreibt: „D1: [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition des Begriffes, Selbstmord'
- Der Selbstmord als Makrophänomen nach Emile Durkheim
- Integration als beeinflussender Faktor für die Selbstmordrate
- Der egoistische Selbstmord
- Spätere Stimmen und Kritik zu Durkheim
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit widmet sich der Analyse des Selbstmordes aus der Perspektive der Makrosoziologie, insbesondere unter Bezugnahme auf Emile Durkheims Werk "Der Selbstmord". Ziel ist es, Durkheims Ansatz zur Erklärung von Selbstmordraten auf gesellschaftlicher Ebene zu erläutern und seine Kernaussagen zu beleuchten.
- Definition des Begriffs "Selbstmord" im Vergleich zu anderen Todesarten
- Durkheims These: Der Einfluss der Gesellschaft auf die Selbstmordrate
- Der egoistische Selbstmord als eine Form des Selbstmords, die durch fehlende Integration in soziale Gruppen entsteht
- Kritik an Durkheims Theorie und alternative Sichtweisen auf den Selbstmord
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Das Kapitel stellt den Selbstmord als ein komplexes Phänomen vor und erläutert die unterschiedlichen Betrachtungsweisen, einschließlich der individuellen und gesellschaftlichen Perspektive. Es wird auf Durkheims Werk hingewiesen und die Zielsetzung der Arbeit beschrieben.
- Definition des Begriffes, Selbstmord': Das Kapitel befasst sich mit der Definition des Begriffs "Selbstmord" und grenzt ihn von anderen Todesarten ab. Es analysiert Durkheims Definition und vergleicht sie mit anderen Definitionen, insbesondere von Christa Lindner-Braun und der World Health Organization (WHO).
- Der Selbstmord als Makrophänomen nach Emile Durkheim: Dieses Kapitel stellt Durkheims zentrale These vor, dass der Selbstmord nicht primär durch individuelle Faktoren, sondern durch die Gesellschaft beeinflusst wird. Es werden die Kernaussagen seiner Theorie erläutert, insbesondere der Einfluss der Integration in eine Gruppe auf die Selbstmordrate.
- Integration als beeinflussender Faktor für die Selbstmordrate: In diesem Kapitel wird Durkheims Argumentation im Detail beleuchtet, dass die Integration in soziale Gruppen einen maßgeblichen Einfluss auf die Selbstmordrate hat. Es werden die verschiedenen Formen der Integration und ihre Auswirkungen auf das Individuum erläutert.
- Der egoistische Selbstmord: Dieses Kapitel stellt Durkheims Theorie des egoistischen Selbstmordes vor. Es erklärt, wie fehlende Integration und soziale Isolation zu einer erhöhten Selbstmordgefahr führen können. Es werden Beispiele und Fallstudien aus Durkheims Werk vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe und Themen dieser Arbeit sind: Selbstmord, Makrosoziologie, Emile Durkheim, Integration, egoistischer Selbstmord, soziale Beziehungen, gesellschaftliche Faktoren, soziale Krankheit, Integrationstheorie, Durkheims Theorie des Selbstmords.
Häufig gestellte Fragen
Was definiert Emile Durkheim als Selbstmord?
Durkheim definiert Selbstmord als jeden Tod, der mittelbar oder unmittelbar auf eine Handlung oder Unterlassung zurückgeht, deren Urheber das Opfer selbst ist, wobei das Opfer um das Ergebnis seiner Handlung wusste.
Was ist ein egoistischer Selbstmord?
Der egoistische Selbstmord resultiert laut Durkheim aus einer mangelnden Integration des Individuums in soziale Gruppen. Wenn die Bindungen zur Gesellschaft schwach sind, steigt die Wahrscheinlichkeit für diese Form des Suizids.
Warum betrachtet Durkheim den Selbstmord als Makrophänomen?
Durkheim untersucht nicht die individuellen psychologischen Ursachen, sondern die Selbstmordraten ganzer Gesellschaften. Er sieht soziale Ursachen und den Grad der gesellschaftlichen Integration als entscheidende Faktoren an.
Welche Rolle spielt die soziale Integration in Durkheims Theorie?
Die Integration ist der zentrale Faktor. Je stärker ein Individuum in religiöse, familiäre oder politische Gruppen eingebunden ist, desto geringer ist die Neigung zum Selbstmord, da die Gruppe dem Einzelnen Halt gibt.
Wann erschien Durkheims Werk „Der Selbstmord“?
Das wegweisende soziologische Werk wurde im Jahr 1897 veröffentlicht.
- Citation du texte
- Eva Kühl (Auteur), 2005, Der Selbstmord als Makrophänomen am Beispiel des egoistischen Selbstmordes nach Emile Durkheim, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/89369