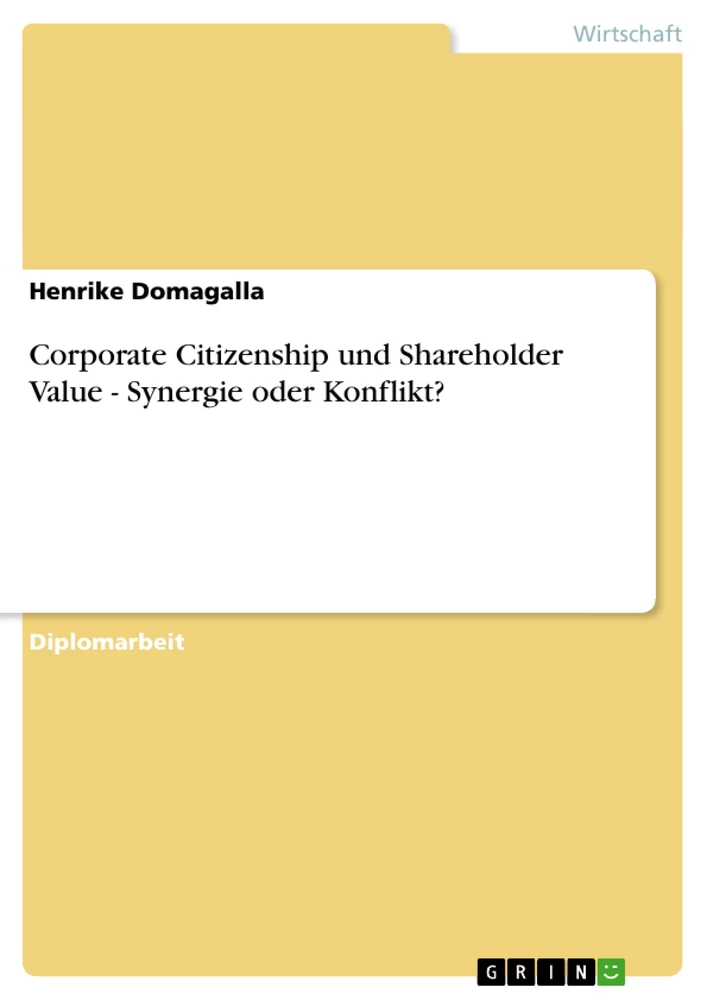Was ist die Aufgabe von Unternehmen? Was sollen, müssen und können sie leisten? Für wen sind Unternehmen verantwortlich, und welchen Platz sollen sie in einer immer globaler werdenden Welt einnehmen? Das alles sind Fragen, die immer wieder gestellt werden und für die durch sich laufend ändernde Umstände immer wieder neue Antworten gefunden werden müssen.
Nicht erst seit der Aufdeckung der Korruptionsaffäre bei Siemens, der Kinderarbeit bei indischen Lieferanten des Bekleidungsherstellers ESPRIT und dem erst kürzlich bekannt gewordenen Fleischskandal in Süddeutschland wird über die Verantwortung, die Unternehmen gegenüber der Gesellschaft und der Umwelt haben, diskutiert. So schrieb beispielsweise Wirtschaftswoche-Autor Christian Ramthun im Vorfeld der Gründung der Initiative Freiheit und Verantwortung im September 2000: „Die Unternehmen (...) müssen sich wie die Bürger stärker für das Gemeinwesen engagieren. Der Rückzug aus der gesellschaftlichen Verantwortung ins Private ist beendet. Der Trend kehrt sich um. Zur New Economy gesellt sich die New Society.” Mehr Bürger, weniger Staat ist also das Stichwort. In Zeiten von immer weniger gefüllten Staatskassen scheint dies eine logische Konsequenz zu sein. In Teilen der Wirtschaft ist diese Konsequenz bereits im Bewusstsein angekommen. Gerade internationale Großkonzerne sind bekannt dafür, sich in verschiedensten Bereichen der Gesellschaft zu engagieren.
Dennoch gibt es noch immer ein breites Spektrum von Kritikern, die gewinnorientiertes Wirtschaften und soziale Verantwortung als gegensätzlich ansehen.
Ziel dieser Arbeit ist es, klar zu definieren, was Corporate Citizenship im Einzelnen bedeutet und den Status quo im Bezug auf dessen Nutzen, Stellenwert und die derzeitige Umsetzung in Deutschland herauszuarbeiten. Mögliche Schwachstellen sollen hervorgehoben werden, um zu zeigen, an welchen Stellen noch gearbeitet werden kann, um die Effizienz der bisherigen Corporate Citizenship-Aktivitäten weiter zu erhöhen.
Zur Erarbeitung der theoretischen Grundlagen wird umfangreiche Sekundärliteratur unterschiedlicher Autoren, darunter Habisch, Schrader und Wieland, herangezogen. Die für die empirische Untersuchung benötigten Daten stammen zum größten Teil aus Studien der Bertelsmann Stiftung sowie des Centers for Corporate Citizenship.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fragestellung und Zielsetzung
- Methodische Vorgehensweise und Aufbau
- Grundlagen und Begriffe
- Corporate Citizenship
- Begriffsverständnis und wesentliche Merkmale
- Strategien und Maßnahmen des Corporate Citizenship
- Corporate Citizenship versus Corporate Social Responsibility
- Zusammenfassende Darstellung der Aufgabenfelder des Corporate Citizenship
- Shareholder-Value- versus Stakeholder-Value-Ansatz
- Begriffsverständnis des Shareholder-Value-Ansatzes
- Begriffsverständnis des Stakeholder-Value-Ansatz
- Stärken und Schwächen der beiden Ansätze
- Initiativen, Standards und Nutzen von Corporate Citizenship
- Initiativen, Vereine und Netzwerke als Hilfe und Handlungsgrundlage
- Der UN Global Compact
- Initiative Freiheit und Verantwortung
- Seitenwechsel ® - Lernen in anderen Arbeitswelten
- Unternehmen: Partner der Jugend" (UPJ) e.V.
- Center for Corporate Citizenship e.V.
- Nutzen aus Sicht der Wirtschaftsunternehmen
- Absatzpolitischer Nutzen
- Personalpolitischer Nutzen
- Kommunikationspolitischer Nutzen
- Nutzen für die gemeinnützigen Einrichtungen
- Nutzen für die Gesellschaft
- Überblick Corporate Citizenship in Deutschland
- Stellenwert des Corporate Citizenship aus verschiedenen Blickwinkeln
- Stellenwert für die Wirtschaft
- Stellenwert für die (potenziellen) Mitarbeiter
- Stellenwert für Kunden und Auswirkung auf die Markenpolitik
- Umsetzung in der Praxis
- Verteilung nach Unternehmensgröße und Branchen
- Verteilung nach Bereichen und Formen des Engagements
- Reichweite der Corporate Citizenship-Aktivitäten
- Investitionen für Corporate Citizenship
- Kommunikation von Corporate Citizenship
- Zusammenfassung und Auswertung
- Fallbeispiele
- Vorstellung der Beispielunternehmen
- METRO Group
- Rosenthal AG
- Iwan Budnikowsky GmbH und Co. KG
- Tabellarische Darstellung der Praxisbeispiele anhand der empirischen Kernaussagen
- Auswertung der Fallbeispiele
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit dem Spannungsfeld zwischen Corporate Citizenship und Shareholder Value. Ziel ist es, die Beziehung zwischen diesen beiden Konzepten zu analysieren und zu erforschen, ob und in welcher Weise sie sich ergänzen oder gegenseitig ausschließen. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung von Corporate Citizenship für Unternehmen und die Gesellschaft sowie die Herausforderungen, die sich im Kontext des Shareholder Value-Ansatzes ergeben.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs Corporate Citizenship
- Analyse der unterschiedlichen Perspektiven auf Corporate Citizenship (z. B. wirtschaftlicher, gesellschaftlicher, ethischer)
- Zusammenhang zwischen Corporate Citizenship und Shareholder Value
- Praxisbeispiele von Unternehmen, die Corporate Citizenship-Initiativen erfolgreich implementiert haben
- Auswirkungen von Corporate Citizenship auf die Reputation und den Erfolg von Unternehmen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellung und Zielsetzung der Arbeit dar und skizziert die methodische Vorgehensweise. Kapitel 2 beleuchtet die theoretischen Grundlagen des Corporate Citizenship und des Shareholder Value-Ansatzes. Dabei werden die jeweiligen Begriffsverständnisse, Merkmale und Strategien untersucht sowie der Unterschied zwischen Corporate Citizenship und Corporate Social Responsibility herausgearbeitet.
Kapitel 3 analysiert Initiativen, Standards und den Nutzen von Corporate Citizenship. Es werden verschiedene Initiativen und Netzwerke vorgestellt, die Unternehmen bei der Umsetzung von Corporate Citizenship-Aktivitäten unterstützen. Weiterhin werden die positiven Auswirkungen von Corporate Citizenship für Unternehmen, gemeinnützige Einrichtungen und die Gesellschaft dargestellt.
Kapitel 4 bietet einen umfassenden Überblick über Corporate Citizenship in Deutschland. Es werden der Stellenwert des Corporate Citizenship aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet und Praxisbeispiele für die Umsetzung in Unternehmen vorgestellt. Kapitel 5 analysiert Fallbeispiele von Unternehmen, die sich erfolgreich mit Corporate Citizenship auseinandersetzen. Es werden die Kernaussagen der Fallbeispiele dargestellt und deren Bedeutung im Hinblick auf die Forschungsfrage bewertet.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themengebiete der Arbeit umfassen Corporate Citizenship, Shareholder Value, Stakeholder Value, Corporate Social Responsibility, Nachhaltige Entwicklung, soziale Verantwortung, gesellschaftliches Engagement, Unternehmensethik, Reputation, Markenpolitik, Unternehmensstrategie, Praxisbeispiele.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Corporate Citizenship (CC)?
Corporate Citizenship bezeichnet das über die eigentliche Geschäftstätigkeit hinausgehende gesellschaftliche Engagement von Unternehmen als "gute Bürger".
Wie unterscheidet sich CC von Corporate Social Responsibility (CSR)?
CSR ist der Oberbegriff für verantwortliches unternehmerisches Handeln, während CC meist den Bereich des bürgerschaftlichen Engagements (Spenden, Sponsoring, Ehrenamt) meint.
Was ist der Shareholder-Value-Ansatz?
Ein Managementkonzept, bei dem die Maximierung des Marktwerts des Eigenkapitals (Nutzen für die Aktionäre) im Vordergrund steht.
Steht soziales Engagement im Konflikt zum Gewinnstreben?
Kritiker sehen oft einen Gegensatz, während Befürworter betonen, dass CC langfristig den Markenwert steigert und damit auch den Shareholder Value erhöht (Synergie).
Welchen Nutzen haben Unternehmen von Corporate Citizenship?
Zu den Vorteilen zählen absatzpolitischer Nutzen (Kundenbindung), personalpolitischer Nutzen (Mitarbeitermotivation) und eine bessere Reputation.
- Citar trabajo
- Henrike Domagalla (Autor), 2007, Corporate Citizenship und Shareholder Value - Synergie oder Konflikt?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/89440