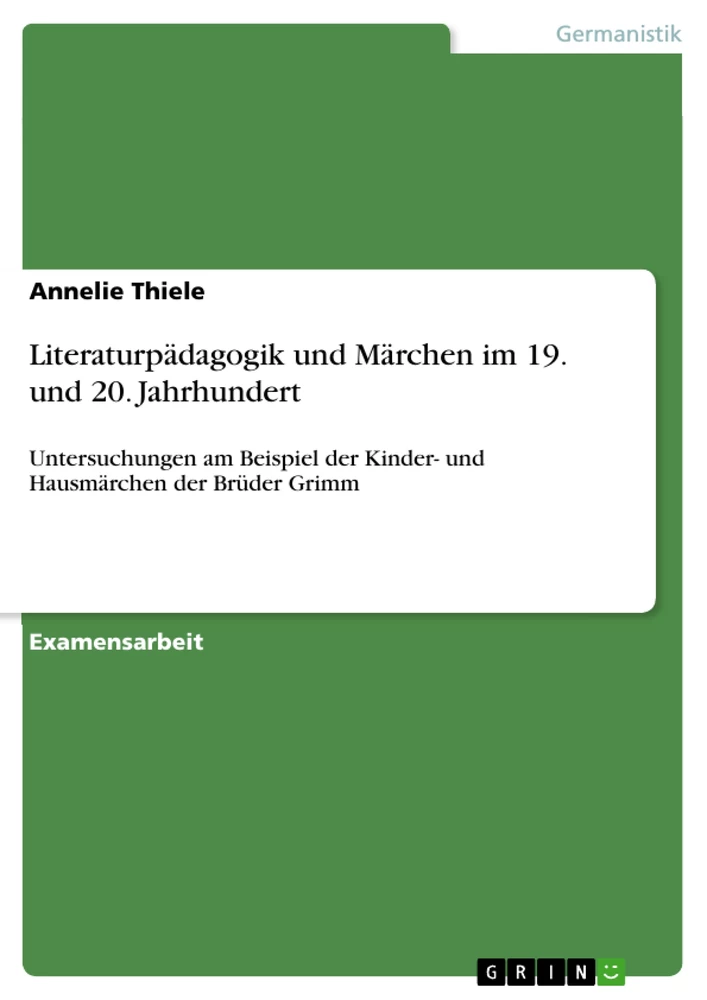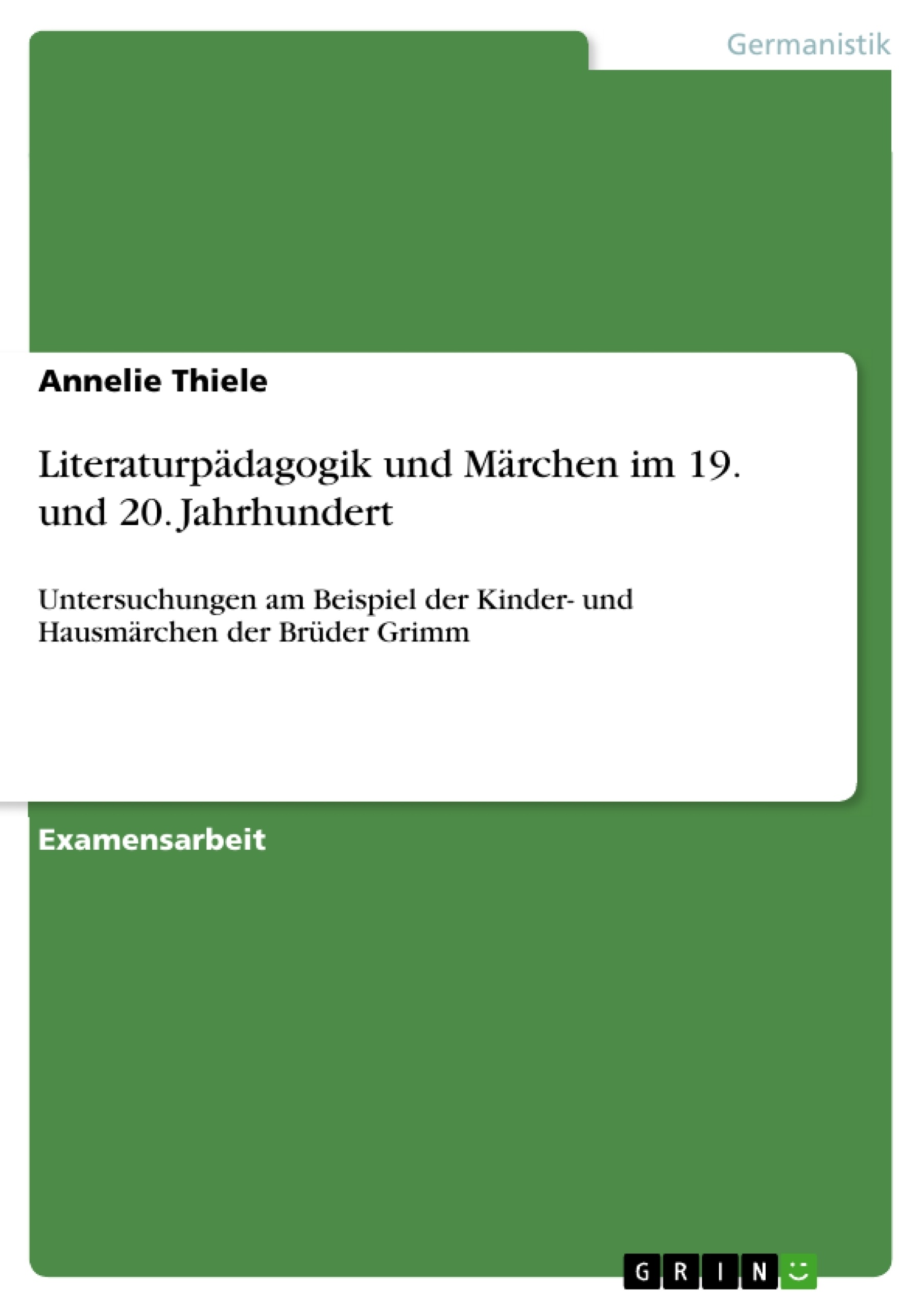"Es war einmal...", wer kennt sie nicht, die alten Märchen nach den Brüdern Grimm: "Hänsel und Gretel", "Rotkäppchen", "Dornröschen", "Frau Holle", "Rapunzel", "Aschenputtel", "Schneeweißchen und Rosenrot" etc.
Von Generation zu Generation weitererzählt oder vorgelesen, inzwischen in 160 Sprachen übersetzt, weltweit beliebt und bekannt bei Groß und Klein. In der Vergangenheit avancierten die "Kinder- und Hausmärchen" der Brüder Grimm zum meist verkauften Buch nach der Bibel.
Heutzutage sind die Grimmschen Märchen vielseitig verwendbar: Eltern oder andere Familienmitglieder lesen Kindern zu Hause Märchen vor, in so genannten "Märchenhäusern" bieten erfahrene Märchenerzähler/innen unterschiedliche phantastische Erzählungen kinder- und erwachsenengerecht an. Andere, oft ausgebildete Märchenerzähler und Pädagogen, bringen sowohl Kindern innerhalb einer Märchenstunde im Unterricht, als auch Erwachsenen, insbesondere älteren Menschen, in gesellschaftlichen Räumen, Krankenhäusern sowie in Altenheimen, die Bedeutung der Märchen von Jakob und Wilhelm Grimm nahe.
Bereits im Altertum finden sich märchenähnliche Motive, zum Beispiel in Erzählungen aus Ägypten, die als Hinweise auf die Existenz von Volksmärchen gesehen werden können. Während des Mittelalters und der Neuzeit nehmen märchenhafte Motive in verschiedenen Geschichten stetig zu, bis von der Gattung "Märchen" gesprochen wird. Während im 16. Jahrhundert vor allem die Märchen Straparolas, im 17. Basiles, Perraults und im 18. Jahrhundert Gallands, Wielands und Musäus ihre Bedeutung finden, ist das 19. Jahrhundert in Deutschland besonders durch die Märchensammlung der Brüder Grimm geprägt.
Jakob und Wilhelm Grimm konnten sich mit ihrer gemeinsam erarbeiteten und veröffentlichten Märchensammlung sowohl im 19. als auch im 20. Jahrhundert großer Popularität erfreuen. Nachdem Volksmärchen zunächst lediglich in Erzählkreisen zur Unterhaltung Erwachsener verwendet wurden, wurden sie durch die Verschriftlichung der "Kinder- und Hausmärchen" auch Kindern zugänglich gemacht.
Dies geschah jedoch in einem längeren Prozess. Von Auflage zu Auflage bearbeiteten die Brüder Grimm ihre Märchensammlung. Dabei gingen sie auf die Auffassungen und Wünsche ihrer Zeitgenossen ein, sodass die Veränderungen in eine kindgerechte Richtung verliefen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Was sind Märchen?
- 2.1 Definition von Märchen aus literaturwissenschaftlicher Sicht
- 2.1.1 Volksmärchen - Kunstmärchen
- 2.1.2 Volksmärchen
- 2.1.3 Kurze Abgrenzung des Märchens gegen benachbarte Gattungen
- 2.2 Definition von Märchen aus literaturpädagogischer Sicht
- 3. Entstehung, Entwicklung und Rezeption der „Kinder- und Hausmärchen“
- 3.1 Altertum
- 3.2 Mittelalter
- 3.3 Neuzeit
- 4. Entstehung der Märchen, Sammeltätigkeit der Brüder Grimm und Herausstellung der Helfer und Gewährspersonen
- 5. Die Kinder- und Hausmärchen in der literaturpädagogischen und literaturdidaktischen Diskussion des 19. und 20. Jahrhunderts
- 5.1 Märchenpädagogik im Deutschen Kaiserreich von 1871 bis 1918
- 5.2 Märchen in der Schule der Weimarer Republik
- 5.3 Pädagogik des Märchens im Dritten Reich
- 5.4 Rezeption von (illustrierten) Märchen nach 1945
- 5.5 Grimms Märchen in der literaturpädagogischen Diskussion der DDR
- 5.6 Die Kinder- und Hausmärchen in der Literaturpädagogik der BRD
- 6. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rezeption der Grimmschen Kinder- und Hausmärchen in der Literaturpädagogik des 19. und 20. Jahrhunderts. Ziel ist es, die unterschiedlichen Perspektiven und Bewertungen der Märchen in verschiedenen Epochen aufzuzeigen und die Entwicklung der Märchenpädagogik nachzuvollziehen. Dabei werden sowohl positive als auch kritische Auseinandersetzungen mit den Märchen berücksichtigt.
- Definition und Abgrenzung des Märchens aus literaturwissenschaftlicher und literaturpädagogischer Sicht
- Entstehung und Entwicklung der Grimmschen Märchensammlung
- Die Rolle der Märchen in der Pädagogik des 19. und 20. Jahrhunderts
- Kontroversen und Debatten um die pädagogische Eignung der Grimmschen Märchen
- Der Einfluss von gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen auf die Rezeption der Märchen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Grimmschen Märchen ein und hebt deren weitverbreitete Bekanntheit und Popularität hervor. Sie skizziert die vielseitige Verwendung der Märchen von der Vorlesestunde bis hin zu pädagogischen Kontexten und weist auf die lange Geschichte märchenhafter Motive hin, beginnend vom Altertum bis zur Herausbildung der Märchengattung im 19. Jahrhundert durch die Grimms. Die Einleitung betont die kontroversen Diskussionen um die Grimmschen Märchen im 19. und 20. Jahrhundert und kündigt die bevorstehende Auseinandersetzung mit literaturwissenschaftlichen und -pädagogischen Definitionen des Märchens an.
2. Was sind Märchen?: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition des Märchens aus literaturwissenschaftlicher und literaturpädagogischer Perspektive. Es differenziert zwischen Volks- und Kunstmärchen und grenzt das Märchen von verwandten Gattungen wie Legende und Sage ab. Der Fokus liegt auf der Herausarbeitung der spezifischen Merkmale des Märchens und seiner Bedeutung für die jeweilige Disziplin. Die verschiedenen Definitionen bilden die Grundlage für die spätere Analyse der Rezeption der Grimmschen Märchen in der Pädagogik.
3. Entstehung, Entwicklung und Rezeption der „Kinder- und Hausmärchen“: Dieses Kapitel beleuchtet die geschichtliche Entwicklung der Grimmschen Märchen von ihren Ursprüngen im Altertum über das Mittelalter bis in die Neuzeit. Es beschreibt den Sammelprozess der Brüder Grimm und die Herausforderungen bei der Herausgabe der Sammlung. Die Veränderungen und Bearbeitungen der Märchen im Laufe der Zeit werden im Kontext ihrer Rezeption diskutiert. Das Kapitel legt den Fokus auf die Entstehung der Sammlung und deren Anpassung an die jeweiligen Bedürfnisse und Erwartungen der Zeit.
4. Entstehung der Märchen, Sammeltätigkeit der Brüder Grimm und Herausstellung der Helfer und Gewährspersonen: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Arbeit der Brüder Grimm bei der Sammlung und Edition der Kinder- und Hausmärchen. Es untersucht die Quellen, aus denen sie ihre Märchen bezogen haben, und beschreibt die Herausforderungen und Schwierigkeiten, mit denen sie dabei konfrontiert waren. Darüber hinaus wird die Rolle der Helfer und Gewährspersonen bei der Sammlung und der Entstehung der Märchen hervorgehoben.
5. Die Kinder- und Hausmärchen in der literaturpädagogischen und literaturdidaktischen Diskussion des 19. und 20. Jahrhunderts: Dieses Kapitel analysiert die Rezeption der Grimmschen Märchen in der Literaturpädagogik des 19. und 20. Jahrhunderts. Es untersucht die unterschiedlichen pädagogischen Ansätze und Perspektiven auf die Märchen in verschiedenen Epochen, vom Deutschen Kaiserreich über die Weimarer Republik und das Dritte Reich bis hin zur Nachkriegszeit in der BRD und der DDR. Die Diskussionen um die pädagogische Eignung der Märchen und deren Anpassung an die jeweiligen gesellschaftlichen und politischen Bedingungen werden im Detail beleuchtet.
Schlüsselwörter
Grimms Märchen, Kinder- und Hausmärchen, Literaturpädagogik, Literaturdidaktik, Märchenforschung, Volksmärchen, Kunstmärchen, Pädagogik des 19. und 20. Jahrhunderts, Rezeption, Märchenpädagogik, Erziehung, Kinderliteratur.
Häufig gestellte Fragen zu: Rezeption der Grimmschen Kinder- und Hausmärchen in der Literaturpädagogik des 19. und 20. Jahrhunderts
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Rezeption der Grimmschen Kinder- und Hausmärchen in der Literaturpädagogik des 19. und 20. Jahrhunderts. Das Ziel ist es, die unterschiedlichen Perspektiven und Bewertungen der Märchen in verschiedenen Epochen aufzuzeigen und die Entwicklung der Märchenpädagogik nachzuvollziehen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Abgrenzung des Märchens aus literaturwissenschaftlicher und literaturpädagogischer Sicht, die Entstehung und Entwicklung der Grimmschen Märchensammlung, die Rolle der Märchen in der Pädagogik des 19. und 20. Jahrhunderts, Kontroversen und Debatten um die pädagogische Eignung der Grimmschen Märchen und den Einfluss gesellschaftlicher und politischer Entwicklungen auf die Rezeption der Märchen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Was sind Märchen?, Entstehung, Entwicklung und Rezeption der „Kinder- und Hausmärchen“, Entstehung der Märchen, Sammeltätigkeit der Brüder Grimm und Herausstellung der Helfer und Gewährspersonen, Die Kinder- und Hausmärchen in der literaturpädagogischen und literaturdidaktischen Diskussion des 19. und 20. Jahrhunderts und Schluss.
Wie wird das Märchen definiert?
Das Kapitel "Was sind Märchen?" differenziert zwischen Volks- und Kunstmärchen und grenzt das Märchen von verwandten Gattungen wie Legende und Sage ab. Es werden literaturwissenschaftliche und literaturpädagogische Perspektiven betrachtet.
Welche historischen Perioden werden betrachtet?
Die Arbeit untersucht die Rezeption der Grimmschen Märchen in verschiedenen Epochen: Deutsches Kaiserreich (1871-1918), Weimarer Republik, Drittes Reich, Nachkriegszeit in BRD und DDR.
Welche Aspekte der Rezeption werden analysiert?
Die Analyse umfasst unterschiedliche pädagogische Ansätze und Perspektiven auf die Märchen in den verschiedenen Epochen, inklusive Diskussionen um die pädagogische Eignung der Märchen und deren Anpassung an gesellschaftliche und politische Bedingungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Grimms Märchen, Kinder- und Hausmärchen, Literaturpädagogik, Literaturdidaktik, Märchenforschung, Volksmärchen, Kunstmärchen, Pädagogik des 19. und 20. Jahrhunderts, Rezeption, Märchenpädagogik, Erziehung, Kinderliteratur.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf die Grimmschen Kinder- und Hausmärchen und literaturwissenschaftliche und -pädagogische Texte aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Die genauen Quellenangaben finden sich im Haupttext.
- Citar trabajo
- Annelie Thiele (Autor), 2007, Literaturpädagogik und Märchen im 19. und 20. Jahrhundert, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/89537