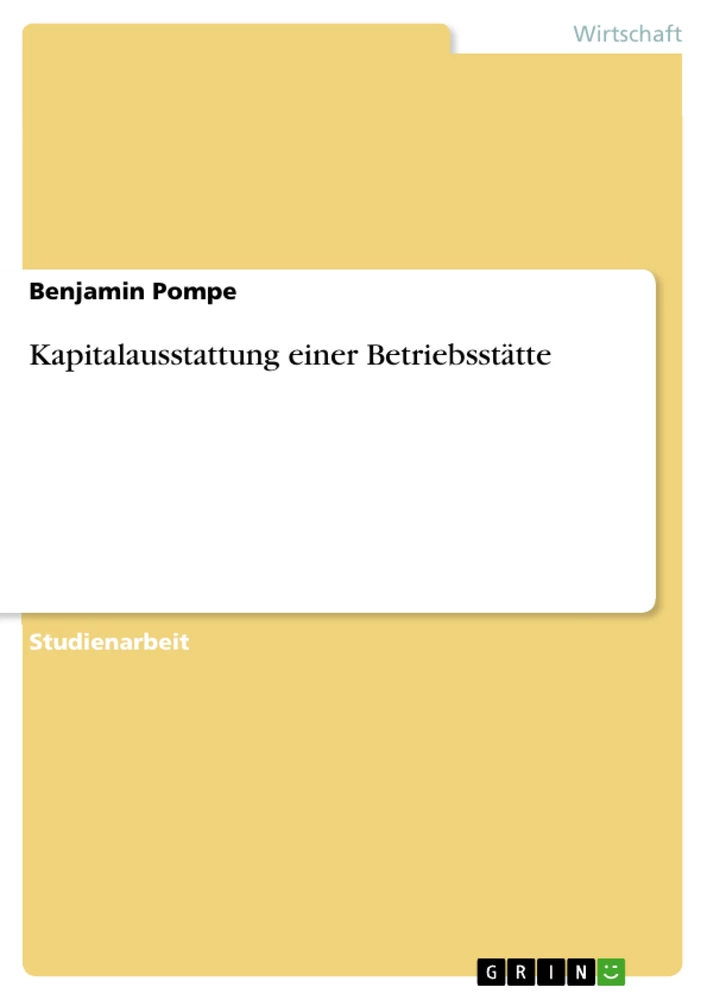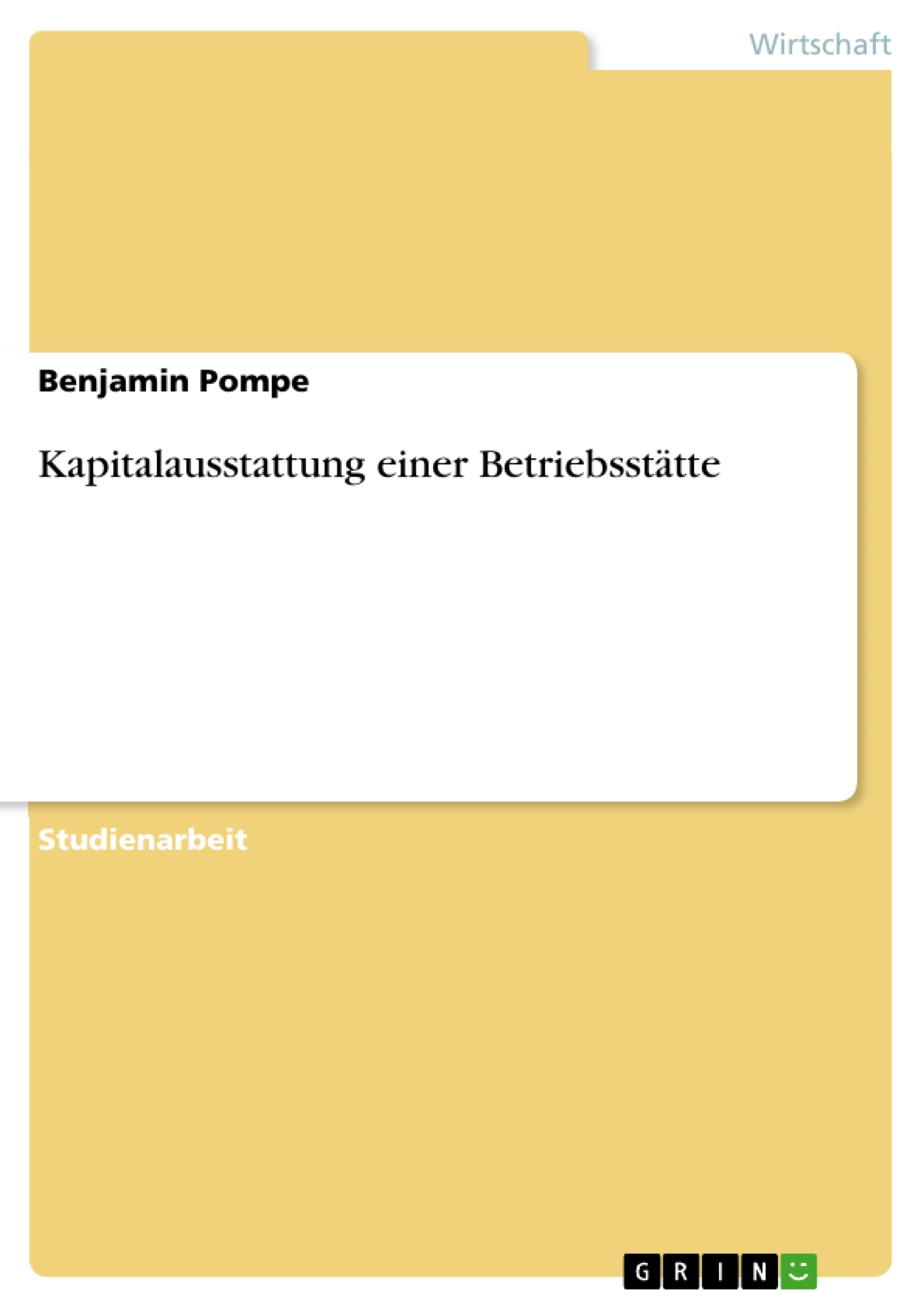Die Wirtschaft in Deutschland ist geprägt durch die immer schneller voranschreitende Globalisierung. Allein im Jahr 2006 flossen Direktinvestitionen von insgesamt 90,8 Milliarden Euro ins Ausland. Immer mehr Unternehmen wollen sich durch den Gang ins Ausland neue Absatzmärkte erschließen oder in den Genuss von niedrigen Lohnkosten und Steuervergünstigungen im Ausland kommen. Eine Möglichkeit der Direktinvestition im Ausland stellt, neben der Gründung einer Tochtergesellschaft, die Errichtung einer Betriebsstätte dar. Der Betriebsstätte kommt aus ertragsteuerlicher Sicht, als ein Konstrukt zur zwischenstaatlichen Ertrags- und Vermögensabgrenzung innerhalb des internationalen Einheits-unternehmens, eine besondere Bedeutung zu. Ein wichtiger Teilaspekt dieser Ertrags und Vermögensabgrenzung ist die Frage der Kapitalausstattung der Betriebsstätte. Die Höhe des Fremdkapitals hat unmittelbaren Einfluss auf die zurechenbaren Zinsaufwendungen und damit mittelbar auch auf die Höhe der beschränkt steuerpflichtigen Einkünfte im Betriebsstättenstaat. Im Zuge dieser Untersuchung sollen, soweit der Rahmen dies erlaubt, die steuergestalterischen Möglichkeiten die sich aus der Variation des Verhältnisses von Dotationskapital und Fremdkapital ergeben können dargestellt, und die Regelungen die diese Möglichkeiten beschränken vorgestellt werden. Sowohl die deutsche Finanzverwaltung als auch die OECD haben Regeln und Methoden zur Bestimmung einer angemessenen Kapitalausstattung der Betriebsstätte entwickelt. Ziel dieser Untersuchung ist es dem Leser einen Überblick über die in Deutschland geltenden Regelungen zur Kapitalausstattung der Betriebsstätte zu liefern und auf eventuelle Unterschiede zu den von der OECD vertretenen Methoden hinzuweisen. Die Untersuchung wird sich dabei sowohl in Bezug auf die Regelungen der deutschen Finanzverwaltung als auch der OECD auf die allgemein gültigen Methoden beschränken. Die speziellen Bestimmungen für die Kapitalausstattung der Betriebsstätten von Finanz- und Versicherungsunternehmen werden im Folgenden nicht behandelt.
Die Untersuchung beginnt mit der Abgrenzung der Betriebsstätte im internationalen Steuerrecht. Im Rahmen dieses Abschnitts wird auf den Begriff der Betriebsstätte sowie die Grundzüge der Besteuerungskonzeption eingegangen. Aufbauend darauf folgt der Hauptteil zur Kapitalausstattung der Betriebsstätte. Dabei wird im ersten Abschnitt zunächst die Frage des Finanzierungsbedarfs der Betriebsstätte diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Die Kapitalausstattung der Betriebsstätte
- 1.1 Motivation
- 1.2 Gang der Untersuchung
- 2. Abgrenzung der Betriebsstätte im internationalen Steuerrecht
- 3. Kapitalausstattung der Betriebsstätte
- 3.1 Bedeutung der Kapitalausstattung für die steuerliche Erfolgsabgrenzung
- 3.3 Dotationskapital
- 3.3.1 Methoden zur Ermittlung des Dotationskapitals
- 3.3.2 Negatives Dotationskapital
- 3.3.3 Unangemessene Dotationskapitalausstattung
- 3.4 Fremdkapital
- 4. Abschließende Würdigung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Kapitalausstattung von Betriebsstätten im internationalen Steuerrecht. Ziel ist es, einen Überblick über die in Deutschland geltenden Regelungen zu geben und Unterschiede zu den OECD-Methoden aufzuzeigen. Die Arbeit konzentriert sich auf allgemein gültige Methoden und lässt spezielle Bestimmungen für Finanz- und Versicherungsunternehmen außer Acht.
- Kapitalausstattung von Betriebsstätten im internationalen Kontext
- Bedeutung der Kapitalausstattung für die steuerliche Erfolgsabgrenzung
- Methoden zur Ermittlung des Dotationskapitals
- Einfluss von Eigen- und Fremdkapital auf die Besteuerung
- Vergleich der deutschen Regelungen mit den OECD-Methoden
Zusammenfassung der Kapitel
1. Die Kapitalausstattung der Betriebsstätte: Dieses einleitende Kapitel motiviert die Arbeit durch die Darstellung der zunehmenden Globalisierung und der damit verbundenen Bedeutung internationaler Direktinvestitionen, insbesondere durch die Errichtung von Betriebsstätten. Es wird die ertragsteuerliche Relevanz der Kapitalausstattung einer Betriebsstätte im Kontext der zwischenstaatlichen Ertrags- und Vermögensabgrenzung hervorgehoben. Der Einfluss der Kapitalstruktur (Eigen- und Fremdkapital) auf die steuerliche Belastung wird als zentraler Untersuchungsgegenstand definiert. Die Arbeit grenzt ihren Fokus auf die allgemein gültigen Methoden der deutschen Finanzverwaltung und der OECD ab.
2. Abgrenzung der Betriebsstätte im internationalen Steuerrecht: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition und Abgrenzung des Begriffs "Betriebsstätte" im internationalen Steuerrecht, was für die korrekte Zuordnung von Einkünften und die Anwendung der Kapitalausstattungsregeln essentiell ist. Es legt die Grundlagen für das Verständnis der nachfolgenden Kapitel, in denen die Kapitalausstattung im Detail behandelt wird. Die Definition von Betriebsstätten wird im Kontext der Vermeidung von Doppelbesteuerung diskutiert und die relevanten Rechtsgrundlagen werden beleuchtet.
3. Kapitalausstattung der Betriebsstätte: Das Kernkapitel dieser Arbeit analysiert die Bedeutung der Kapitalausstattung für die steuerliche Erfolgsabgrenzung. Es befasst sich eingehend mit dem Dotationskapital, verschiedenen Methoden zu dessen Ermittlung, sowie dem Umgang mit negativem oder unangemessenem Dotationskapital. Zusätzlich wird die Rolle des Fremdkapitals und dessen Einfluss auf die Zinsaufwendungen und die steuerpflichtigen Einkünfte beleuchtet. Das Kapitel vergleicht die Ansätze der deutschen Finanzverwaltung und der OECD und zeigt mögliche Unterschiede und Gemeinsamkeiten auf. Die verschiedenen Methoden zur Bestimmung einer angemessenen Kapitalausstattung werden detailliert erläutert und an Beispielen veranschaulicht.
Schlüsselwörter
Internationale Unternehmensbesteuerung, Betriebsstätte, Kapitalausstattung, Dotationskapital, Fremdkapital, Steuerliche Erfolgsabgrenzung, OECD-Methoden, Deutsche Finanzverwaltung, Eigenkapital, Zinsaufwendungen, zwischenstaatliche Ertragsabgrenzung.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Kapitalausstattung von Betriebsstätten im internationalen Steuerrecht
Was ist der Gegenstand der Seminararbeit?
Die Seminararbeit befasst sich mit der Kapitalausstattung von Betriebsstätten im internationalen Steuerrecht. Sie untersucht die in Deutschland geltenden Regelungen und vergleicht diese mit den OECD-Methoden. Der Fokus liegt auf allgemein gültigen Methoden; spezielle Bestimmungen für Finanz- und Versicherungsunternehmen werden nicht behandelt.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Kapitalausstattung von Betriebsstätten im internationalen Kontext, Bedeutung der Kapitalausstattung für die steuerliche Erfolgsabgrenzung, Methoden zur Ermittlung des Dotationskapitals, Einfluss von Eigen- und Fremdkapital auf die Besteuerung, und einen Vergleich der deutschen Regelungen mit den OECD-Methoden.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Kapitel 1 bietet eine Einleitung und Motivation. Kapitel 2 behandelt die Abgrenzung der Betriebsstätte im internationalen Steuerrecht. Kapitel 3 analysiert die Kapitalausstattung der Betriebsstätte im Detail, inklusive Dotationskapital, Fremdkapital und den Vergleich deutscher und OECD-Methoden. Kapitel 4 bietet eine abschließende Würdigung.
Was versteht man unter Dotationskapital?
Die Arbeit erklärt ausführlich den Begriff des Dotationskapitals und beschreibt verschiedene Methoden zu dessen Ermittlung. Sie befasst sich auch mit dem Umgang mit negativem oder unangemessenem Dotationskapital.
Welche Rolle spielt Fremdkapital in der Seminararbeit?
Die Rolle des Fremdkapitals und dessen Einfluss auf die Zinsaufwendungen und die steuerpflichtigen Einkünfte wird im Detail untersucht und in Relation zum Eigenkapital gesetzt.
Wie werden die deutschen Regelungen mit den OECD-Methoden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Ansätze der deutschen Finanzverwaltung und der OECD, um Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufzuzeigen. Die verschiedenen Methoden zur Bestimmung einer angemessenen Kapitalausstattung werden detailliert erläutert und an Beispielen veranschaulicht.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Seminararbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Internationale Unternehmensbesteuerung, Betriebsstätte, Kapitalausstattung, Dotationskapital, Fremdkapital, Steuerliche Erfolgsabgrenzung, OECD-Methoden, Deutsche Finanzverwaltung, Eigenkapital, Zinsaufwendungen, zwischenstaatliche Ertragsabgrenzung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Seminararbeit?
Ziel der Seminararbeit ist es, einen Überblick über die in Deutschland geltenden Regelungen zur Kapitalausstattung von Betriebsstätten im internationalen Steuerrecht zu geben und diese mit den OECD-Methoden zu vergleichen.
- Arbeit zitieren
- Benjamin Pompe (Autor:in), 2007, Kapitalausstattung einer Betriebsstätte, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/89610