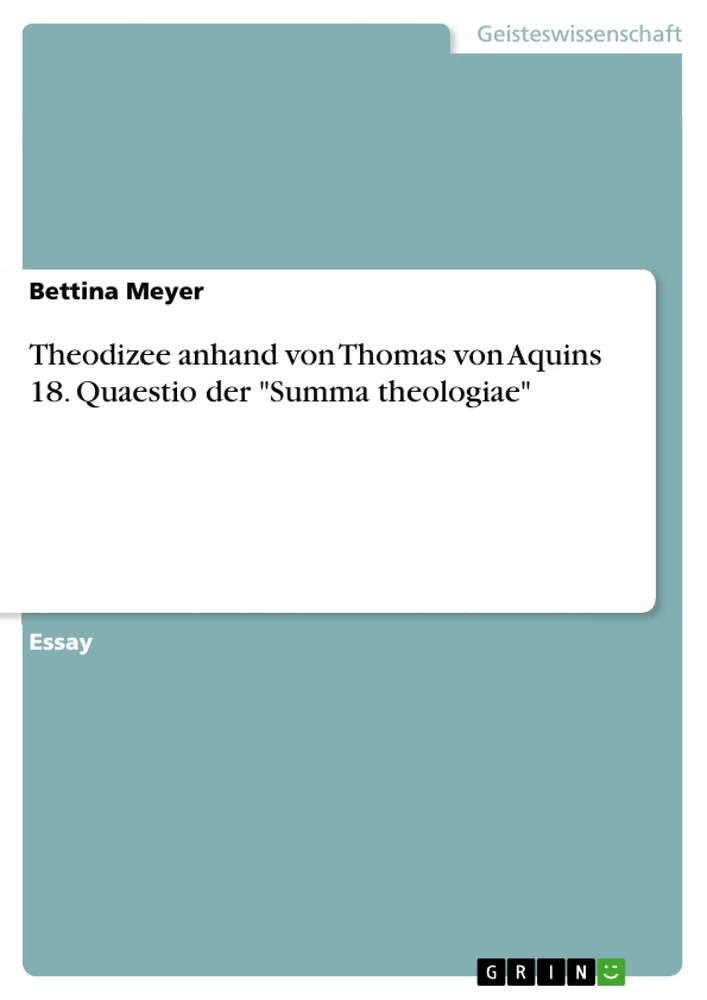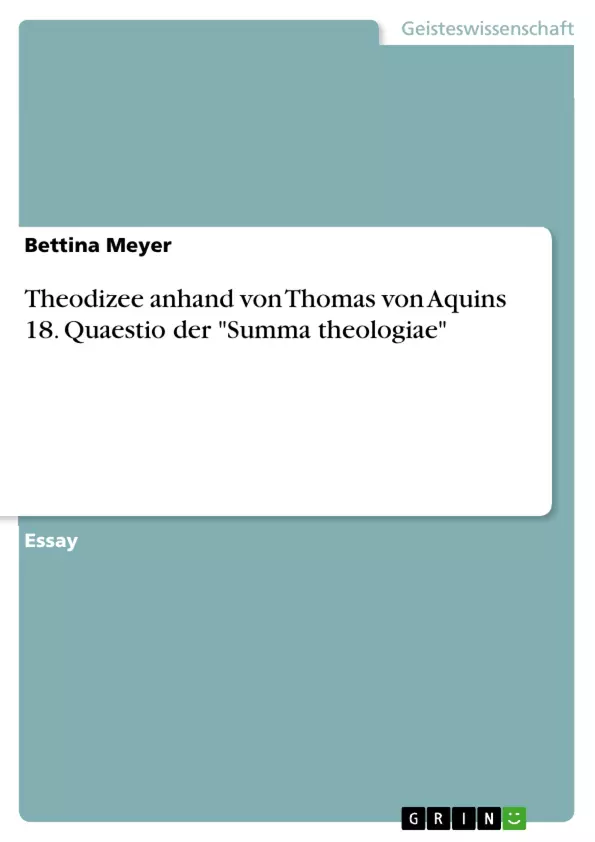Leibniz führte den Begriff Theodizee ein. Damit bezeichnete er die Lösung des Problems, wie sich der Glaube an einen allwissenden, allgütigen und allmächtigen Gott mit dem Vorhandensein des Böses bzw. des Übels in der Welt vereinbaren lasse.
Thomas von Aquin war ein gläubiger Mönch im 13. Jahrhundert und beschäftigte sich mit diesem Problem. In seiner 18. Quaestio der Summa theologiae „Über das Gutsein und das Schlechtsein der menschlichen Handlungen im allgemein“ beginnt er mit der Frage, ob jede menschliche Handlung gut sei oder es auch schlecht gäbe. Thomas von Aquin geht davon aus, dass Gott das größtmögliche Sein hat (die höchstmögliche Existenz; lat. „esse“ = dt. „sein, Existenz“) und somit auch das größtmögliche Gutsein. Handlungen, die als schlecht bezeichnet werden, mangelt es an Sein (Existenz) und dadurch auch an Gutsein. Es gibt also keine schlechten, sondern nur weniger gute Handlungen.
Inhaltsverzeichnis
- Über das Gutsein und das Schlechtsein der menschlichen Handlungen im Allgemeinen
- Das Böse als Abwesenheit des Guten
- Das Böse als Teil der Schöpfung Gottes
- Das Böse als notwendige Bedingung zur Verwirklichung des Guten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Thomas von Aquins Auseinandersetzung mit dem Problem der Theodizee anhand seiner 18. Quaestio der Summa theologiae. Ziel ist es, Aquins Argumentation zu rekonstruieren und seine Antwort auf die Frage nach dem Ursprung und der Natur des Böses in der Welt zu analysieren.
- Thomas von Aquins Verständnis von Gut und Böse
- Die Rolle des menschlichen Willens bei der Entstehung des Bösen
- Aquins Antwort auf das Problem der Theodizee
- Vergleich mit anderen klassischen Theodizeen
- Die Bedeutung von Umständen und Objekt bei der Handlungsbewertung
Zusammenfassung der Kapitel
Über das Gutsein und das Schlechtsein der menschlichen Handlungen im Allgemeinen: Dieses Kapitel analysiert Thomas von Aquins Definition von Gut und Böse in menschlichen Handlungen. Aquin argumentiert, dass Gott das höchste Sein und somit das höchste Gut darstellt. Schlechte Handlungen sind demnach nicht ein Gegenstück zum Guten, sondern ein Mangel an Sein und damit an Gutsein. Wichtige Faktoren bei der Bestimmung des moralischen Wertes einer Handlung sind das Objekt, die Umstände und der Zweck der Handlung. Aquins Unterscheidung zwischen generischem und spezifischem Gutsein wird erläutert, ebenso wie die Rolle der Vernunft und die Bedeutung individueller Umstände. Handlungen können indifferent sein, wenn sie weder der Vernunft entsprechen noch gegen sie verstoßen. Die Individualität des Menschen und seine Rolle im moralischen Handeln stehen im Mittelpunkt dieser Analyse von Aquins Philosophie.
Das Böse als Abwesenheit des Guten: Dieses Kapitel präsentiert die erste von drei klassischen Antworten auf die Theodizee, die Aquin implizit vertritt. Diese Antwort, die auf Augustinus und Plotin zurückgeht, definiert das Böse als die Abwesenheit von Gut. Das Böse ist nicht selbstständig geschaffen, sondern resultiert aus dem Unterlassen des Guten durch den freien Willen des Menschen. Diese Interpretation hebt die Verantwortung des Menschen für sein Handeln hervor und betont die göttliche Vollkommenheit, die unvereinbar mit dem Erschaffen von Bösem ist. Die Passage unterstreicht die Bedeutung des freien Willens in Aquins Theodizee-Konzept.
Das Böse als Teil der Schöpfung Gottes: Dieses Kapitel stellt eine alternative klassische Antwort auf die Theodizee vor – ebenfalls von Augustinus vertreten und auf Plotin zurückgehend – die das Böse als Teil der göttlichen Schöpfung begreift. Das Böse existiert als notwendige Komponente eines umfassenden Ganzen, in dem das Vollkommene und Unvollkommene zusammenwirken. Diese Perspektive, im Gegensatz zur vorherigen, akzeptiert das Böse als integrativen Bestandteil der Schöpfung, anstatt es als Mangel an Gut zu definieren. Diese Sichtweise wird als eine weitere mögliche Interpretation der göttlichen Ordnung präsentiert, die im Gegensatz zu Aquins Präferenz steht.
Das Böse als notwendige Bedingung zur Verwirklichung des Guten: Dieses Kapitel präsentiert die dritte klassische Antwort auf das Problem der Theodizee. Diese Position, die auf Irenaeus und Hegel zurückgeht, versteht das Böse als notwendige Bedingung für die Verwirklichung des Guten im Menschen. Der Mensch durchläuft einen schmerzhaften Prozess, um sein volles Potential zu erreichen. Diese Sichtweise wird kritisch betrachtet, da sie eine individuelle Rechtfertigung des Leidens erschwert. Es wird betont, dass diese Auffassung, obwohl einflussreich, nicht Aquins bevorzugte Erklärung des Bösen ist.
Schlüsselwörter
Theodizee, Thomas von Aquin, Summa theologiae, Gut und Böse, menschliche Handlung, freier Wille, Gott, Übel, Augustinus, Plotin, Irenaeus, Hegel, Sein, Existenz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Thomas von Aquins Theodizee"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Thomas von Aquins Auseinandersetzung mit dem Problem der Theodizee, insbesondere seine 18. Quaestio der Summa theologiae. Sie rekonstruiert Aquins Argumentation und analysiert seine Antwort auf die Frage nach Ursprung und Natur des Bösen in der Welt.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Thomas von Aquins Verständnis von Gut und Böse, die Rolle des menschlichen Willens bei der Entstehung des Bösen, Aquins Antwort auf das Problem der Theodizee, einen Vergleich mit anderen klassischen Theodizeen und die Bedeutung von Umständen und Objekt bei der Handlungsbewertung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel, die sich mit folgenden Aspekten befassen: Das Gutsein und Schlechtsein menschlicher Handlungen im Allgemeinen, das Böse als Abwesenheit des Guten, das Böse als Teil der Schöpfung Gottes und das Böse als notwendige Bedingung zur Verwirklichung des Guten. Zusätzlich enthält sie ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter.
Wie definiert Thomas von Aquin Gut und Böse?
Aquin definiert Gott als höchstes Sein und höchstes Gut. Schlechte Handlungen sind für ihn kein Gegenstück zum Guten, sondern ein Mangel an Sein und damit an Gutsein. Wichtige Faktoren bei der Bestimmung des moralischen Wertes einer Handlung sind das Objekt, die Umstände und der Zweck der Handlung.
Welche Rolle spielt der freie Wille in Aquins Theodizee?
Der freie Wille spielt eine zentrale Rolle. Das Böse resultiert aus dem Unterlassen des Guten durch den freien Willen des Menschen. Aquins Verständnis betont die Verantwortung des Menschen für sein Handeln und die göttliche Vollkommenheit, die unvereinbar mit dem Erschaffen von Bösem ist.
Welche klassischen Antworten auf die Theodizee werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert drei klassische Antworten auf die Theodizee: Das Böse als Abwesenheit des Guten (Augustinus, Plotin), das Böse als Teil der Schöpfung Gottes (Augustinus, Plotin) und das Böse als notwendige Bedingung zur Verwirklichung des Guten (Irenaeus, Hegel). Aquins eigene Position wird im Kontext dieser verschiedenen Ansätze analysiert.
Welche Bedeutung haben die Umstände und das Objekt einer Handlung?
Die Umstände und das Objekt einer Handlung sind entscheidende Faktoren bei der Bestimmung des moralischen Wertes einer Handlung nach Aquin. Handlungen können indifferent sein, wenn sie weder der Vernunft entsprechen noch gegen sie verstoßen. Die Individualität des Menschen und seine Rolle im moralischen Handeln spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Theodizee, Thomas von Aquin, Summa theologiae, Gut und Böse, menschliche Handlung, freier Wille, Gott, Übel, Augustinus, Plotin, Irenaeus, Hegel, Sein, Existenz.
- Quote paper
- Bettina Meyer (Author), 2005, Theodizee anhand von Thomas von Aquins 18. Quaestio der "Summa theologiae", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/89680