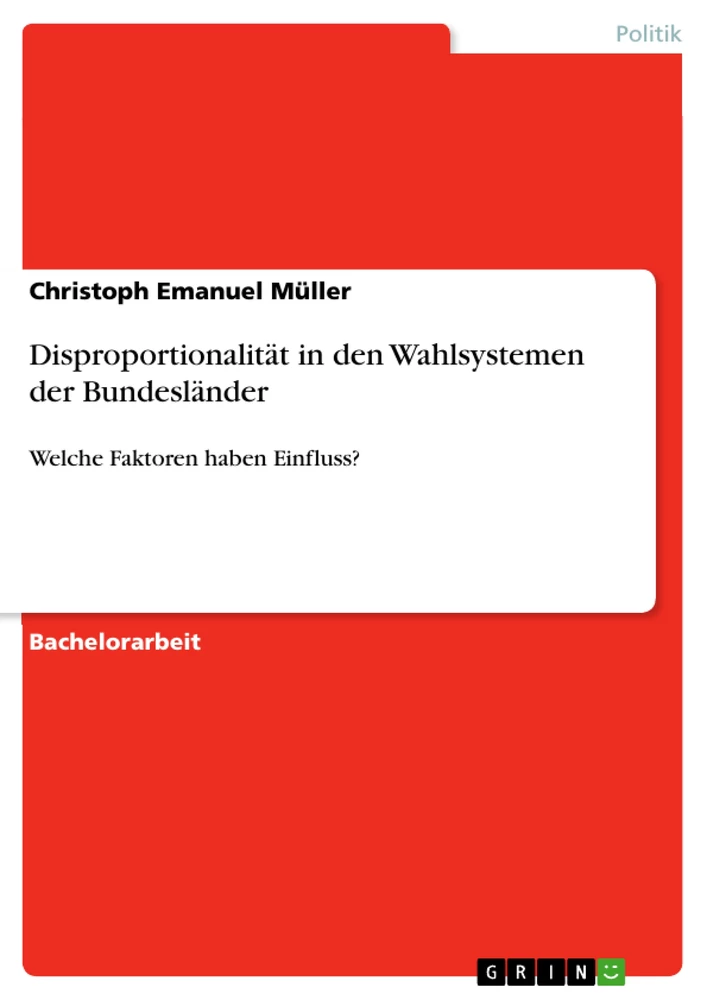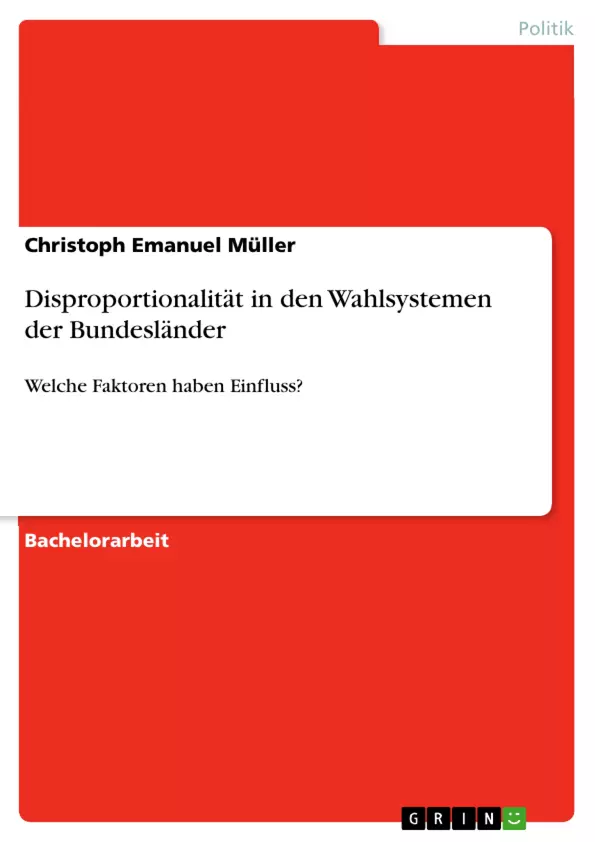Wahlen sind heute eine grundlegende Voraussetzung für das Funktionieren einer Demokratie. Durch sie können die Bürger eines Landes oder einer untergeordneten Gebietskörperschaft ihre Repräsentanten für verschiedene Arten von Volksvertretungen bestimmen.
Der konkrete Ablauf einer Wahl und die für die Verrechnung von Wählerstimmen in Mandate gebräuchlichen Methoden hängen von gesetzlichen Vorgaben ab, über die ein bestimmtes Wahlsystem definiert werden kann. Ein Wahlsystem regelt, „…wie der Wähler seine polit. Präferenz in Stimmen ausdrücken kann und wie dieses Votum in Entscheidungen über die (personelle) Besetzung von Ämtern/Mandaten und die (parteipolit.) Zusammensetzung von Repräsentativversammlungen übertragen wird.“ (Nohlen, 2003: S. 717)
Verschiedene Wahlsysteme mit ihren technischen Elementen haben unterschiedliche Eigenschaften und können zu Unterschieden in der Besetzung der Gremien führen. Generell geht man davon aus, dass mit steigendem Proportionalitätsgrad eine geringere Bevorzugung von Parteien stattfindet. Ob eine hohe Proportionalität gut oder schlecht, gerecht oder ungerecht ist, kann nur politisch oder normativ beurteilt werden.
Das Hauptanliegen dieser Arbeit besteht nun darin, Unterschiede zwischen den Wahlsystemen der deutschen Bundesländer in ihrer Proportionalität mithilfe von technischen Elementen der Wahlsysteme zu erklären. Es soll also untersucht werden, in wieweit die technischen Wahlelemente als Erklärungsfaktoren und Prädiktoren für die Proportionalität herangezogen werden können. Die in den Ländern existierenden technischen Elemente werden im Laufe der Studie zusammen mit den gängigen, in der internationalen Wahlsystemforschung gebräuchlichen Arbeitshypothesen präsentiert.
Mit dieser empirisch-quantitativen Untersuchung wird einerseits versucht, empirisch gesicherte Hypothesen zu überprüfen, andererseits mögliche Besonderheiten der Wahlsysteme der Bundesländer zu entdecken und zu erklären. Eine systematische Überprüfung der Proportionalität und ihrer Bestimmungsgründe in den Ländern wurde bisher nicht durchgeführt. Da Wahlsysteme keine unveränderbaren Gegebenheiten sind und durch Parlamentsbeschlüsse abgeändert werden können, kann aus dieser Untersuchung zudem abgeleitet werden, welche Konsequenzen sich hinsichtlich einer Veränderung der Proportionalität durch eine Abänderung technischer Wahlsystemelemente in den Bundesländern ergeben könnten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Literaturrahmen
- 3. Disproportionalität und der politisch-institutionelle Ansatz
- 4. Die Wahlsysteme der deutschen Bundesländer
- 5. Technische Elemente von Wahlsystemen
- 6. Untersuchungsdesign, Daten und Methode
- 7. Operationalisierung
- 8. Bivariate Analyse
- 9. Multivariate Analyse
- 10. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen technischen Wahlsystemelementen und der Disproportionalität in den Wahlsystemen der deutschen Bundesländer. Das Hauptziel ist es, den Einfluss verschiedener Faktoren auf die Proportionalität zu ermitteln und zu analysieren, welche technischen Elemente als Erklärungsfaktoren dienen können. Die Studie überprüft empirisch gesicherte Hypothesen und sucht nach Besonderheiten in den Wahlsystemen der Bundesländer.
- Einfluss der Prozenthürde auf die Disproportionalität
- Bedeutung der Wahlkreisgröße für die Proportionalität
- Auswirkungen von Sitzzuteilungsverfahren auf die Disproportionalität
- Analyse der Rolle von Überhang- und Ausgleichsmandaten
- Vergleich der Wahlsysteme der deutschen Bundesländer
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Wahlsystemdisproportionalität in den deutschen Bundesländern ein. Sie erläutert die Bedeutung von Wahlsystemen für demokratische Prozesse und benennt das Hauptanliegen der Arbeit: die Erklärung von Unterschieden in der Proportionalität der Wahlsysteme der Bundesländer anhand technischer Elemente. Es wird die Forschungsmethodik skizziert und der Aufbau der Arbeit vorgestellt, der von der Literaturrecherche über die theoretische Einbettung bis hin zur empirischen Analyse reicht. Die Studie hebt die Bedeutung der Untersuchung hervor, da Wahlsysteme veränderbar sind und die Ergebnisse Aufschluss über die Konsequenzen von Änderungen geben können.
2. Literaturrahmen: Dieses Kapitel präsentiert einen Überblick über die relevanten Studien zum Zusammenhang zwischen technischen Wahlsystemvariablen und Disproportionalität. Es werden die Arbeiten von Rae (1967), Taagepera und Shugart (1989), Gallagher (1991) und Lijphart (1994, 1999) vorgestellt, die den Einfluss von Faktoren wie Wahlkreisgröße, Sperrklauseln, Wahlformeln und Sitzzuteilungsverfahren auf die Disproportionalität untersucht haben. Der Least-Square Index, der in der vorliegenden Arbeit verwendet wird, wird ebenfalls im Kontext der Arbeiten Gallaghers erwähnt. Die Kapitel betont die Bedeutung dieser Vorarbeiten für das eigene Forschungsvorhaben.
3. Disproportionalität und der politisch-institutionelle Ansatz: Dieser Abschnitt definiert den Begriff der Disproportionalität und bettet ihn in einen theoretischen Rahmen ein. Er beleuchtet den Zusammenhang zwischen den technischen Elementen der Wahlsysteme und dem Grad der Disproportionalität. Es werden die verschiedenen Ansätze und Perspektiven der Wahlsystemforschung diskutiert und die theoretischen Grundlagen für die spätere empirische Analyse gelegt. Der Abschnitt liefert das konzeptionelle Verständnis für die Analyse der Disproportionalität innerhalb der deutschen Bundesländer.
4. Die Wahlsysteme der deutschen Bundesländer: Dieses Kapitel beschreibt und klassifiziert die Wahlsysteme der deutschen Bundesländer. Es liefert eine detaillierte Übersicht über die verschiedenen Systeme und deren Eigenschaften. Die Beschreibung der Wahlsysteme bildet die Grundlage für die spätere empirische Analyse und den Vergleich der verschiedenen Bundesländer. Der Abschnitt liefert die notwendigen Informationen über die zu untersuchenden Wahlsysteme, um die empirischen Ergebnisse einordnen zu können.
5. Technische Elemente von Wahlsystemen: Hier werden die technischen Wahlsystemelemente vorgestellt, von denen ein Einfluss auf die Disproportionalität erwartet wird. Es werden detailliert die verschiedenen Elemente wie die Prozenthürde, die Wahlkreisgröße, die Parlamentskammergröße, das Sitzzuteilungsverfahren und Regelungen zu Überhang- und Ausgleichsmandaten beschrieben. Der Abschnitt liefert den detaillierten Rahmen für die Variablen, die in der empirischen Analyse untersucht werden. Er betont den erwarteten Einfluss der verschiedenen Elemente und verweist auf die in der internationalen Wahlsystemforschung gebräuchlichen Arbeitshypothesen.
Schlüsselwörter
Disproportionalität, Wahlsysteme, Bundesländer, Prozenthürde, Wahlkreisgröße, Parlamentskammergröße, Sitzzuteilungsverfahren, Überhangmandate, Ausgleichsmandate, empirische Analyse, multivariate Analyse, Proportionalität, Wahlsystemforschung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse der Wahlsystemdisproportionalität in den deutschen Bundesländern
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen technischen Elementen von Wahlsystemen und dem Grad der Disproportionalität in den Wahlsystemen der deutschen Bundesländer. Das Hauptziel ist die Ermittlung und Analyse des Einflusses verschiedener Faktoren auf die Proportionalität und die Identifizierung von technischen Elementen als Erklärungsfaktoren.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf den Einfluss der Prozenthürde, der Wahlkreisgröße, der Sitzzuteilungsverfahren, von Überhang- und Ausgleichsmandaten auf die Disproportionalität. Ein weiterer Schwerpunkt ist der Vergleich der Wahlsysteme der einzelnen deutschen Bundesländer.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in zehn Kapitel: Einleitung, Literaturrahmen, Disproportionalität und der politisch-institutionelle Ansatz, Die Wahlsysteme der deutschen Bundesländer, Technische Elemente von Wahlsystemen, Untersuchungsdesign, Daten und Methode, Operationalisierung, Bivariate Analyse, Multivariate Analyse und Zusammenfassung.
Was wird in der Einleitung erläutert?
Die Einleitung führt in das Thema der Wahlsystemdisproportionalität ein, erläutert die Bedeutung von Wahlsystemen für demokratische Prozesse und beschreibt das Hauptanliegen der Arbeit. Sie skizziert die Forschungsmethodik und den Aufbau der Arbeit.
Was beinhaltet der Literaturrahmen?
Das Kapitel "Literaturrahmen" bietet einen Überblick über relevante Studien zum Zusammenhang zwischen technischen Wahlsystemvariablen und Disproportionalität. Es werden wichtige Arbeiten von Rae, Taagepera & Shugart, Gallagher und Lijphart vorgestellt und der verwendete Least-Square Index erläutert.
Wie wird Disproportionalität definiert und theoretisch eingeordnet?
Kapitel 3 definiert Disproportionalität und bettet sie in einen theoretischen Rahmen ein. Es beleuchtet den Zusammenhang zwischen technischen Elementen und dem Grad der Disproportionalität und diskutiert verschiedene Ansätze der Wahlsystemforschung.
Wie werden die Wahlsysteme der Bundesländer beschrieben?
Kapitel 4 beschreibt und klassifiziert detailliert die Wahlsysteme der deutschen Bundesländer, was die Grundlage für die spätere empirische Analyse bildet.
Welche technischen Elemente von Wahlsystemen werden untersucht?
Kapitel 5 stellt die technischen Wahlsystemelemente vor, die einen Einfluss auf die Disproportionalität haben sollen (Prozenthürde, Wahlkreisgröße, Parlamentskammergröße, Sitzzuteilungsverfahren, Überhang- und Ausgleichsmandate).
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet bivariate und multivariate Analysemethoden zur empirischen Untersuchung des Zusammenhangs zwischen den technischen Wahlsystemelementen und der Disproportionalität.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Disproportionalität, Wahlsysteme, Bundesländer, Prozenthürde, Wahlkreisgröße, Parlamentskammergröße, Sitzzuteilungsverfahren, Überhangmandate, Ausgleichsmandate, empirische Analyse, multivariate Analyse, Proportionalität, Wahlsystemforschung.
- Quote paper
- Christoph Emanuel Müller (Author), 2007, Disproportionalität in den Wahlsystemen der Bundesländer, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/89711