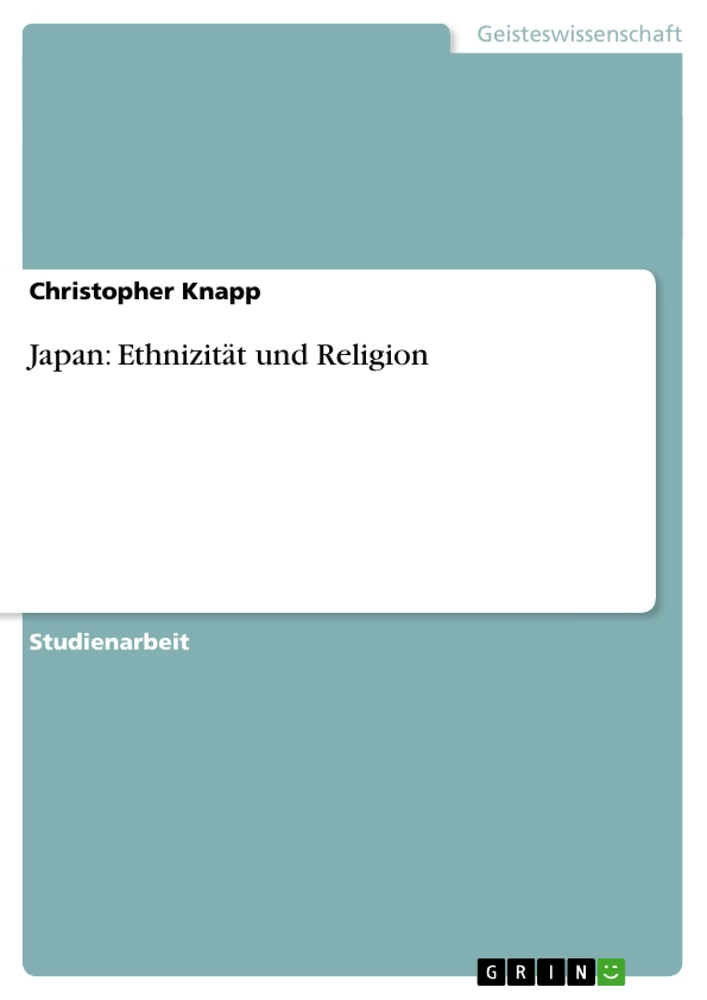Die Unterschiede zwischen fremdem und eigenem Land sind ein Thema, das nahezu zwangsläufig jeden beschäftigt, der einmal eine Region mit genügend geographischem Abstand zum Heimatland besucht hat. Nur einen Schritt von solchen Reflexionen entfernt folgt dann - nahezu ebenso zwangsläufig - eine Abstraktion des Beobachteten auf so etwas wie einen „Nationalcharakter“ (meist verbunden mit einem kurzen Anfall von Heimweh). Dieses fruchtbare Konversationsthema findet seinen Widerhall aber auch in ernsthafteren Unternehmungen wie Politik und leider auch militärischen Aggressionen, wie nicht nur die jüngere Geschichte lehrt. Ausgangspunkt in beiden Fällen ist stets eine über Urlaubsgespräche hinausgehende intellektuelle Beschäftigung mit dem Thema. Ironischerweise scheint es in deren Ausmaß ebenfalls nationale Unterschiede zu geben - Nietzsche spöttelte einst, es kennzeichne die Deutschen, dass die Frage nach ihrem „Deutschsein“ bei ihnen nie aussterbe (Nietzsche 1978 in Coulmas 1993: 20) - und auf der Rangliste der mit diesem im sozialwissenschaftlichen Sprachgebrauch als „Ethnizität“ oder „ethnischer Identität“ bezeichnetem Phänomen stark beschäftigten Nationen dürfte interessanterweise ein für die Europäer sonst eher unauffälliges Land weit oben stehen, nämlich Japan.
Bücher über die Besonderheiten der Japaner bilden dort ein eigenes Genre mit beachtlichen Verkaufszahlen (Coulmas 1993: 20) und wurden und werden keineswegs von einer denkbaren wie klischeehaften Gruppe konservativer provinzieller Nationalisten geschrieben, sondern häufig von ausgebildeten Intellektuellen mit wissenschaftlichem Anspruch (Davis 1992: 254). Dass diese japanische „Nabelschau“ im frühen 19 Jhdt. begann (Romppel 1994: 25) und im Zweiten Weltkrieg einen vorläufigen Höhepunkt fand (Romppel 1994: 28) erstaunt dabei weit weniger als die Tatsache, dass das Weltkriegsende nicht auch solch geistiger Beschäftigung ein Ende bereitete, denn nach einem kurzen Schweigen nationalistischer Stimmen bis etwa 1950 (Yoshino 1992: 206) begann die Diskussion um die japanische Identität mit einer massiven Flut von Büchern über nationale Besonderheiten in den 70er Jahren (Coulmas 1993: 22) erneut. An diesem bis heute andauernden Diskurs um das Besondere des „Japaner-Seins“ ist im religionswissenschaftlichen Kontext eine Eigenart besonders interessant: Das Moment des Religiösen.
Inhaltsverzeichnis
- Theoretische und methodische Vorüberlegungen
- Ethnizität
- Religion
- Religion und Ethnizität
- Methodik
- Identität und Religion
- Shintoismus, „National Learning“ und Ultranationalismus
- Kokugaku und die Wiederentdeckung des Shinto
- Die Meiji-Restauration: Shinto als Staatsreligion
- Nihonjinron - die „Japaner - Theorie“
- Das geheimnisvolle Japanisch
- Die sprachlose Kommunikation der Japaner
- Identität und japanisches „,New Auge“
- Yamaori Tetsuo und die impersonalen Götter der Japaner
- Auswertung: Identität und Religion in der Geschichte der japanischen Selbstfindung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Suche nach der nationalen Identität in Japan und die Rolle, die religiöse Elemente dabei spielen. Sie analysiert historische und zeitgenössische Perspektiven auf die japanische Selbstfindung, indem sie den Einfluss von Shintoismus, „National Learning“ und anderen Strömungen beleuchtet.
- Die Konstruktion der japanischen Identität im Kontext des Nationalismus
- Die Rolle des Shintoismus in der Entwicklung der japanischen Nationalidentität
- Das Konzept des „Nihonjinron“ und die Suche nach den Besonderheiten der Japaner
- Der Einfluss religiöser Elemente auf das Selbstbild Japans
- Die Verknüpfung von Religion und Ethnizität im Kontext der japanischen Kulturgeschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel werden die theoretischen Grundlagen der Arbeit vorgestellt. Es werden die Konzepte von Ethnizität und Religion definiert und die methodischen Ansätze der Arbeit erläutert. Das zweite Kapitel befasst sich mit der Entwicklung der japanischen Identität und der Rolle, die Religion dabei spielt. Es analysiert die Bedeutung von Shintoismus, „National Learning“ und Ultranationalismus sowie die Entstehung des „Nihonjinron“. Das dritte Kapitel schließlich befasst sich mit der Analyse der japanischen Selbstfindung, indem es die Verbindung von Identität und Religion in der Geschichte der japanischen Kultur untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen japanische Identität, Ethnizität, Religion, Shintoismus, „National Learning“, Ultranationalismus, Nihonjinron, „New Age“, Kulturgeschichte und Selbstfindung.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem Begriff "Nihonjinron"?
Nihonjinron bezeichnet ein literarisches Genre und einen Diskurs über die angebliche Einzigartigkeit der japanischen Identität, Kultur und Sprache.
Welche Rolle spielt der Shintoismus für die japanische Identität?
Der Shintoismus wurde besonders während der Meiji-Restauration als Staatsreligion instrumentalisiert, um einen nationalen Einheitsgedanken und Ultranationalismus zu fördern.
Was ist "Kokugaku"?
Kokugaku oder "National Learning" war eine intellektuelle Bewegung zur Wiederentdeckung der japanischen Klassik und des Shinto, abseits von fremden (chinesischen) Einflüssen.
Wie wird die "sprachlose Kommunikation" der Japaner im Text erklärt?
Im Rahmen des Nihonjinron-Diskurses wird oft behauptet, Japaner besäßen eine besondere Form der intuitiven, nonverbalen Verständigung, die für Außenstehende nicht fassbar sei.
Wer ist Yamaori Tetsuo?
Yamaori Tetsuo ist ein Gelehrter, der sich mit den "impersonalen Göttern" der Japaner und der Verbindung von Identität und modernem japanischem "New Age" befasst.
- Arbeit zitieren
- M.A. Christopher Knapp (Autor:in), 2001, Japan: Ethnizität und Religion, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/89788