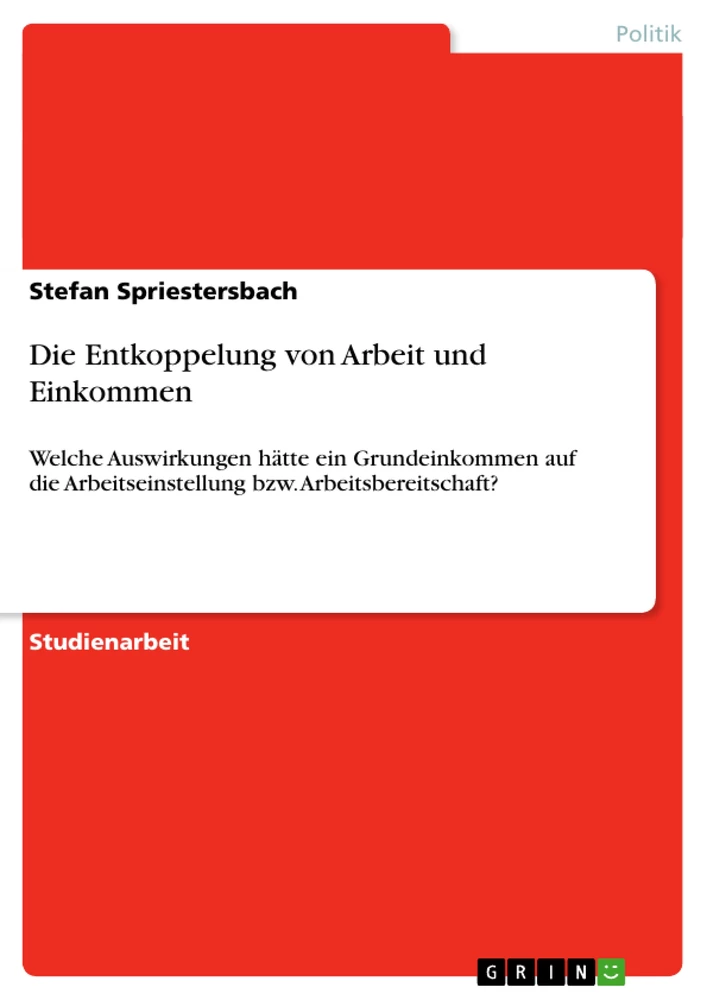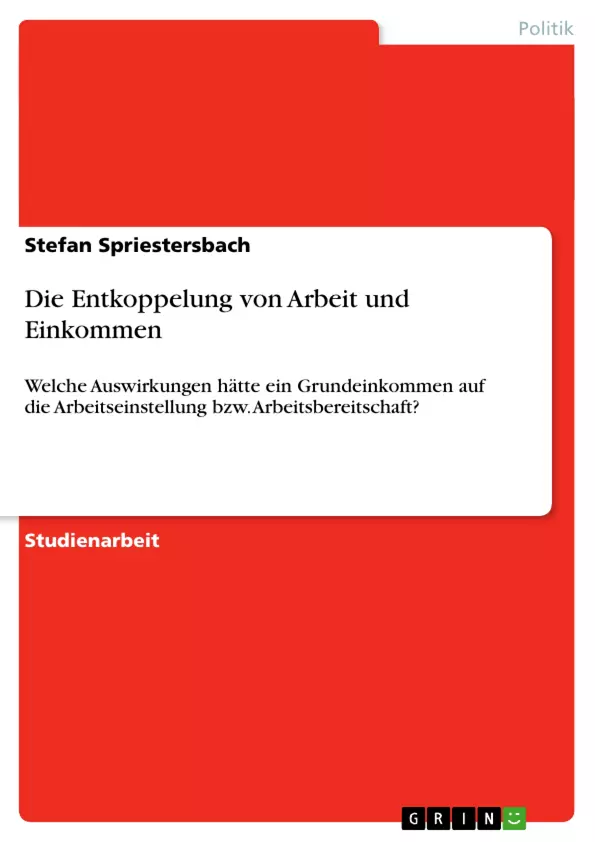Stellt man sich die Frage: Was würde ich tun, wenn ich nicht arbeiten müsste? – So fallen die Antworten meist ähnlich aus. Von „gar nichts“ bis „was ich will“ ist alles dabei. Würde die Befreiung des Zwanges von Arbeit aber wirklich eine der beiden meisten gegebenen Antworten in Erscheinung treten lassen, oder wäre gar ein ganz anderes Szenario möglich? Welches Verhalten würde der Mensch an den Tag legen? Unter dem Aspekt der vorherrschenden eher sozialwissenschaftlichen Diskussion, neben der temporären politischen, um die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens, solidarisches Bürgergeldes oder einer negativen Einkommenssteuer wird dieser Punkt neben der Finanzierungsmachbarkeit am häufigsten angesprochen und aus diesem fast immer eine Unumsetzbarkeit bescheinigt. In dieser Hausarbeit möchte ich die Veränderung der Arbeitswelt, des Arbeitsbegriffs und der Arbeitsmoral unter dem Aspekt der Erlangung von Handlungsfreiheit durch ein bedingungsloses Grundeinkommen untersuchen. Dabei spielt das Modell eines Grundeinkommens oder die Höhe gar keine Rolle. Der Fokus liegt auf dem Verhalten des Menschen und die neue nie da gewesene Situation einer Existenzsicherheit ohne Arbeit. Diese entsagt dem heutigen Verständnis von Erwerbsarbeit seine eigentliche Bestimmung und somit die mögliche Motivation zu Handeln. Eröffnet aber wiederum andere Handlungsstrategien, welche erwartet werden können.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Verhaltenstheoretischer Ansatz
- Herleitung der Fragestellung und Hypothese
- Definitionen
- Von der Freiheit zur Handlungsfreiheit
- Aspekte der Handlungsfreiheit durch ein bedingungsloses Grundeinkommen
- Handlungsfreiheit auf dem Arbeitsmarkt
- Handlungsfreiheit bei Familien und Familienarbeit
- Handlungsfreiheit im Bildungsweg
- Handlungsfreiheit und Soziale Exklusion
- Erweiterung der Verhaltenstheorie um eine dritte Dimension
- Handlungsfreiheit und individueller selbstbestimmbarer Arbeit
- Eingeschränkte Handlungsfreiheit
- Das Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Auswirkungen eines bedingungslosen Grundeinkommens auf die Arbeitsmoral und Arbeitsbereitschaft der Menschen. Der Fokus liegt dabei nicht auf dem Modell des Grundeinkommens selbst, sondern auf dem veränderten Verhalten und den neuen Handlungsmöglichkeiten, die durch die Existenzsicherung ohne Arbeit entstehen.
- Analyse der Handlungsfreiheit, die durch ein bedingungsloses Grundeinkommen entsteht
- Untersuchung der Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, Familienarbeit und Bildung
- Bewertung der Rolle des Grundeinkommens zur Vermeidung sozialer Exklusion
- Erörterung der Motivation zur Arbeit, wenn die primären Bedürfnisse bereits gedeckt sind
- Beurteilung der Hypothese, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen die Handlungsfreiheit zu individueller, selbstbestimmter Arbeit erhöht
Zusammenfassung der Kapitel
Das Abstract stellt die Fragestellung und die zugrundeliegende Hypothese vor. Es erläutert den verhaltenstheoretischen Ansatz, der die Motivation zur Arbeit als Reaktion auf den Reiz zur Vermeidung von Not und Armut betrachtet. Kapitel 2 behandelt die Freiheit des Menschen und beleuchtet, wie ein bedingungsloses Grundeinkommen die Handlungsfreiheit durch die Beseitigung des Zwangs zur Arbeit erhöhen könnte.
Kapitel 3 analysiert verschiedene Aspekte der Handlungsfreiheit, die durch ein bedingungsloses Grundeinkommen entstehen können, wie z.B. auf dem Arbeitsmarkt, in Familien und im Bildungsbereich. Es wird auch die Rolle des Grundeinkommens bei der Vermeidung sozialer Exklusion und die Frage, welche Bedürfnisse Arbeit in Zukunft befriedigen könnte, behandelt. Die Erweiterung der Verhaltenstheorie um eine dritte Dimension, die Handlungsfreiheit, wird ebenfalls diskutiert.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Begriffe und Konzepte der Arbeit sind Handlungsfreiheit, bedingungsloses Grundeinkommen, Arbeitsmoral, Arbeitsbereitschaft, soziale Exklusion, individuelle, selbstbestimmte Arbeit, Motivation, Bedürfnisse und Verhaltenstheorie. Die Arbeit befasst sich mit den Auswirkungen eines bedingungslosen Grundeinkommens auf diese zentralen Themenbereiche.
Häufig gestellte Fragen
Was untersucht diese Arbeit zum bedingungslosen Grundeinkommen?
Die Arbeit analysiert die Veränderung der Arbeitswelt, des Arbeitsbegriffs und der Arbeitsmoral unter dem Aspekt der neu gewonnenen Handlungsfreiheit.
Wie verändert ein Grundeinkommen die Handlungsfreiheit?
Es befreit den Menschen vom existenziellen Zwang zur Erwerbsarbeit und ermöglicht eine individuellere Gestaltung des Lebensweges.
Welche Auswirkungen hat das Modell auf den Arbeitsmarkt?
Es wird untersucht, ob die Motivation zur Arbeit sinkt oder ob neue Strategien für selbstbestimmte, sinnstiftende Arbeit entstehen.
Spielt die Höhe des Grundeinkommens in der Arbeit eine Rolle?
Nein, der Fokus liegt auf dem verhaltenstheoretischen Ansatz und der grundsätzlichen Situation einer Existenzsicherheit ohne Arbeitszwang.
Kann ein Grundeinkommen soziale Exklusion verhindern?
Die Arbeit erörtert, inwiefern die finanzielle Absicherung gesellschaftliche Teilhabe unabhängig vom Beschäftigungsstatus ermöglicht.
- Quote paper
- Stefan Spriestersbach (Author), 2008, Die Entkoppelung von Arbeit und Einkommen , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/89834