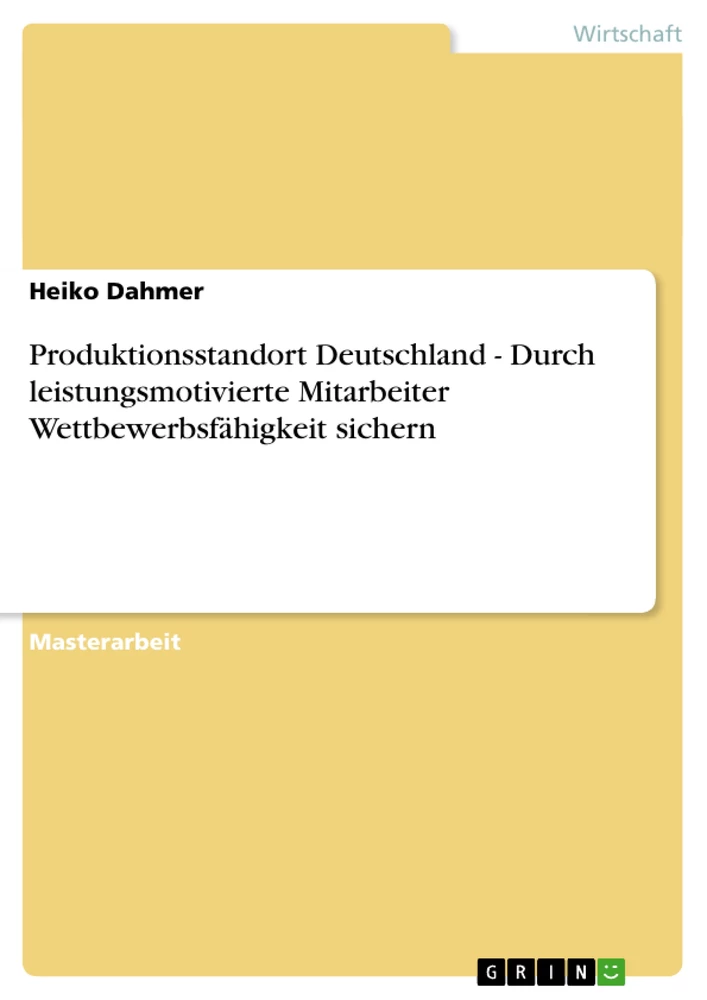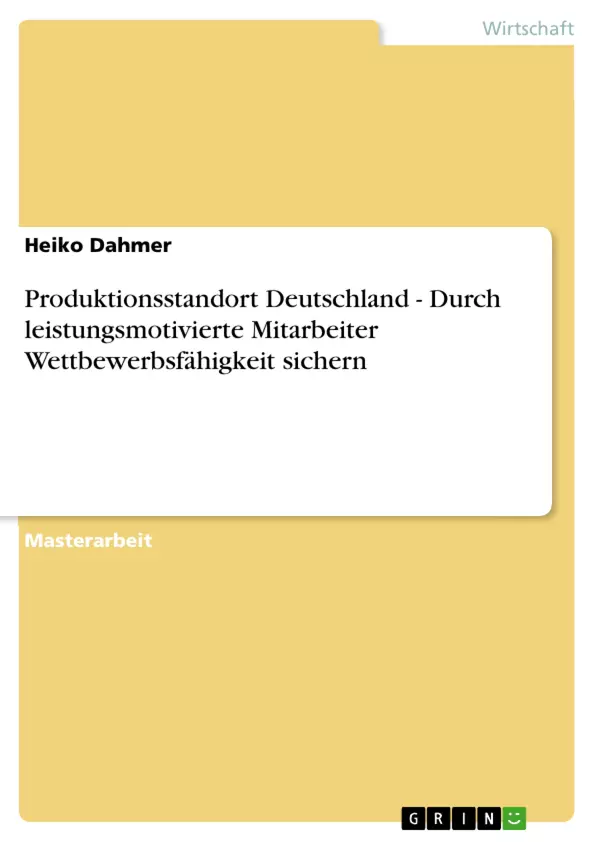Der Standort Deutschland gehört zu den führenden Standorten für Unternehmen weltweit und ist der attraktivste Investitionsstandort in Europa. Das Siegel „Made in Germany“ steht im Ausland nach wie vor für hohe Qualität und für zuverlässige Produkte. Internationale Manager schätzen den Standort Deutschland wegen seiner guten Infrastruktur, der Qualität von Forschung und Entwicklung, der gut ausgebildeten Arbeitskräfte sowie der Attraktivität des europäischen Binnenmarktes. Gleichzeitig kritisieren Unternehmer eine mangelnde Flexibilität des Arbeitsrechts, die teils überzogene Bürokratie und Regulierungsdichte sowie die hohen Arbeitskosten in Deutschland.
Gerade Unternehmen in Deutschland mit einem hohen Arbeitskostenanteil, zu denen auch produzierenden Unternehmen gehören, reagieren auf diese Wettbewerbsnachteile zum Teil mit einer Verlagerung von Produktionsstätten an attraktivere Standorte. Diese Abwanderungstendenzen sowie zunehmende Automatisierung von Prozessen führen auf dem Arbeitsmarkt zu dramatischen Konsequenzen: die Beschäftigung in Deutschland nahm im Zeitraum von 1970 bis 2004 um 18% ab. Dieser Arbeitsplatzabbau schreitet in Deutschland weiter fort. Umso mehr ist die Arbeitsplatzsicherheit für den einzelnen Bürger und Mitarbeiter von existenzieller Bedeutung.
Die vorliegende Master-Thesis verfolgt das Ziel, den beschriebenen Abwanderungstendenzen im produzierenden Bereich entgegenzuwirken und so Arbeitsplätze am Standort Deutschland zu sichern. Der Fokus der Betrachtungen liegt auf der großindustriellen Fertigung in der Lebensmittelindustrie, da der Autor aus diesem Bereich eigene Berufserfahrung einfließen lassen kann. Zudem handelt sich es bei der Lebensmittelindustrie um einen der größten Industriezweige gemessen an Umsatz und Beschäftigung.
In der vorliegenden Arbeit werden im ersten Schritt detailliert das Umfeld am Standort Deutschland analysiert und darauf aufbauend Strategien zur Sicherung des Unternehmensstandortes vorgestellt.
Weiterhin fokussiert sich die vorliegende Arbeit auf die Betrachtung der Ressource Personal und deren Beitrag zur Sicherung des Standorts Deutschland. Von besonderem Interesse sind hier die Mitarbeiter mit einer technisch-gewerblicher Tätigkeit, da diese einerseits den Großteil der Belegschaft einer Produktion ausmachen, andererseits auch bislang wenig Literatur zu dieser Zielgruppe vorliegt. Gleichzeitig kann der Autor auch hier auf eigene Praxiserfahrungen zurückgreifen. Es werden relevante Theorien zur Leistungsmotivation und deren praktische Anwendung in konkreten Motivationstools dargestellt.
Im Folgenden wird erläutert, wie motivierte Mitarbeiter zur Sicherung des Unternehmensstandorts Deutschland, und damit auch zur Sicherung ihres eigenen Arbeitsplatzes, beitragen können. Hierfür werden aus den vorgestellten Strategien diejenigen mit Bezug zur Ressource Personal dargestellt. Es wird herausgearbeitet, warum die Umsetzung der Strategien der Motivation und Unterstützung durch die Mitarbeiter bedarf und eine Hypothese aufgestellt, dass die oben dargestellten Motivationstools über die Beeinflussung der Motivation der Mitarbeiter zur Umsetzung der Strategien beitragen können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Analyse der Wettbewerbsfähigkeit der Lebensmittelindustrie
- PESTEL-Umfeldanalyse
- SWOT-Analyse
- Strategien aus der SWOT-Analyse
- Herausforderung der Umsetzung der Strategien
- Theorien der Leistungsmotivation
- Grundlagen der Motivation
- Motivationstheorien
- Anwendung der Motivationstheorien
- Motivationstools für Unternehmen
- Extrinsische monetäre Tools
- Extrinsische nicht-monetäre Tools
- Intrinsische Tools
- Umsetzung der Strategien
- Hebel 1 – Lohnkosten
- Hebel 2 – Produktivität
- Hebel 4 – Innovation
- Hebel 5 Qualität und Wissen
- Abschlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Lebensmittelindustrie und analysiert den Einfluss leistungsmotivierter Mitarbeiter auf den Unternehmenserfolg. Ziel ist es, Strategien zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit aufzuzeigen und geeignete Motivationstools zu identifizieren.
- Analyse der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Lebensmittelindustrie
- Einfluss von Mitarbeitermotivation auf die Wettbewerbsfähigkeit
- Vorstellung relevanter Motivationstheorien
- Beschreibung geeigneter monetärer und nicht-monetärer Motivationstools
- Umsetzung von Strategien zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Lebensmittelindustrie ein und betont die Bedeutung leistungsmotivierter Mitarbeiter für den Unternehmenserfolg. Sie gibt einen Ausblick auf die Struktur und den Inhalt der Arbeit.
Analyse der Wettbewerbsfähigkeit der Lebensmittelindustrie: Dieses Kapitel analysiert die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Lebensmittelindustrie mittels PESTEL- und SWOT-Analyse. Die PESTEL-Analyse untersucht politische, ökonomische, soziokulturelle, technologische, ökologische und rechtliche Einflussfaktoren. Die SWOT-Analyse identifiziert Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken der Branche. Aus der SWOT-Analyse werden Strategien abgeleitet, um die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Die Herausforderungen bei der Umsetzung dieser Strategien werden ebenfalls diskutiert, wobei die komplexen Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Faktoren herausgearbeitet werden.
Theorien der Leistungsmotivation: Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen Motivationstheorien, beginnend mit frühen Ansätzen und ihren Kritikpunkten bis hin zu modernen Theorien. Es werden die Grundlagen der Motivation, wie Arbeitszufriedenheit und intrinsische sowie extrinsische Motivation, erläutert. Die Kapitel analysieren Theorien wie die von Maslow, Herzberg und McClelland, und ihre Anwendbarkeit im Kontext der Lebensmittelindustrie wird diskutiert, wobei die jeweilige Reichweite und Limitationen der Ansätze berücksichtigt werden. Es wird gezeigt, wie diese Theorien zur Gestaltung von Motivationsprogrammen beitragen können.
Motivationstools für Unternehmen: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Motivationstools, die Unternehmen einsetzen können, um die Leistungsmotivation ihrer Mitarbeiter zu fördern. Es werden sowohl extrinsische monetäre (Entlohnungssysteme, Incentives, variable Entgeltsysteme, flexible Zusatzleistungen) als auch extrinsische nicht-monetäre Tools (Führen mit Zielen) und intrinsische Tools (Führungsverhalten, Ideenmanagement, Mitarbeitergespräche, Empowerment, Teamarbeit) detailliert beschrieben und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile im Kontext der Lebensmittelindustrie analysiert. Die Auswahl der geeigneten Tools hängt stark von den individuellen Unternehmenszielen und der Unternehmenskultur ab. Es wird der Zusammenhang zwischen den verschiedenen Tools und deren möglichen Synergieeffekten beleuchtet.
Umsetzung der Strategien: In diesem Kapitel werden konkrete Strategien zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Lebensmittelindustrie vorgestellt und mit passenden Motivationstools verknüpft. Es werden verschiedene Hebel (z.B. Lohnkosten, Produktivität, Innovation, Qualität und Wissen) identifiziert und für jeden Hebel passende Strategien und Motivationstools vorgeschlagen. Die Umsetzung der Strategien wird anhand von Beispielen illustriert, und die Kapitel analysiert die möglichen wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Maßnahmen. Es wird die enge Verknüpfung zwischen strategischer Planung und der gezielten Motivation der Mitarbeiter betont.
Schlüsselwörter
Wettbewerbsfähigkeit, Lebensmittelindustrie, Deutschland, Leistungsmotivation, Motivationstheorien, Motivationstools, Strategien, Mitarbeitermotivation, PESTEL-Analyse, SWOT-Analyse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Lebensmittelindustrie und Mitarbeitermotivation
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Lebensmittelindustrie und analysiert den Einfluss leistungsmotivierter Mitarbeiter auf den Unternehmenserfolg. Ziel ist es, Strategien zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit aufzuzeigen und geeignete Motivationstools zu identifizieren.
Welche Methoden werden zur Analyse der Wettbewerbsfähigkeit eingesetzt?
Die Arbeit verwendet eine PESTEL-Analyse zur Untersuchung politischer, ökonomischer, soziokultureller, technologischer, ökologischer und rechtlicher Einflussfaktoren auf die Lebensmittelindustrie. Zusätzlich wird eine SWOT-Analyse durchgeführt, um Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken der Branche zu identifizieren. Aus den Analysen werden Strategien zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit abgeleitet.
Welche Motivationstheorien werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Motivationstheorien, darunter Ansätze von Maslow, Herzberg und McClelland. Die Grundlagen der Motivation, wie Arbeitszufriedenheit und intrinsische sowie extrinsische Motivation, werden erläutert. Die Anwendbarkeit der Theorien im Kontext der Lebensmittelindustrie wird diskutiert, inklusive ihrer Reichweite und Limitationen.
Welche Motivationstools werden vorgestellt?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Motivationstools, sowohl extrinsische monetäre (z.B. Entlohnungssysteme, Incentives) als auch extrinsische nicht-monetäre (z.B. Führen mit Zielen) und intrinsische Tools (z.B. Führungsverhalten, Empowerment). Die Vor- und Nachteile der Tools im Kontext der Lebensmittelindustrie werden analysiert, und der Zusammenhang zwischen den Tools und deren möglichen Synergieeffekten wird beleuchtet.
Wie werden Strategien zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit umgesetzt?
Die Arbeit präsentiert konkrete Strategien zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, verknüpft mit passenden Motivationstools. Verschiedene Hebel (Lohnkosten, Produktivität, Innovation, Qualität und Wissen) werden identifiziert, und für jeden Hebel werden Strategien und Motivationstools vorgeschlagen. Die Umsetzung wird anhand von Beispielen illustriert, und die möglichen wirtschaftlichen Auswirkungen werden analysiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Wettbewerbsfähigkeit, Lebensmittelindustrie, Deutschland, Leistungsmotivation, Motivationstheorien, Motivationstools, Strategien, Mitarbeitermotivation, PESTEL-Analyse, SWOT-Analyse.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, die Analyse der Wettbewerbsfähigkeit der Lebensmittelindustrie (inkl. PESTEL und SWOT), ein Kapitel zu Motivationstheorien, ein Kapitel zu Motivationstools, ein Kapitel zur Umsetzung von Strategien und eine Abschlussbetrachtung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Strategien zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Lebensmittelindustrie aufzuzeigen und geeignete Motivationstools zu identifizieren, um den Einfluss leistungsmotivierter Mitarbeiter auf den Unternehmenserfolg zu analysieren.
- Citar trabajo
- Dipl.-Ing., MBA Heiko Dahmer (Autor), 2007, Produktionsstandort Deutschland - Durch leistungsmotivierte Mitarbeiter Wettbewerbsfähigkeit sichern, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/89921