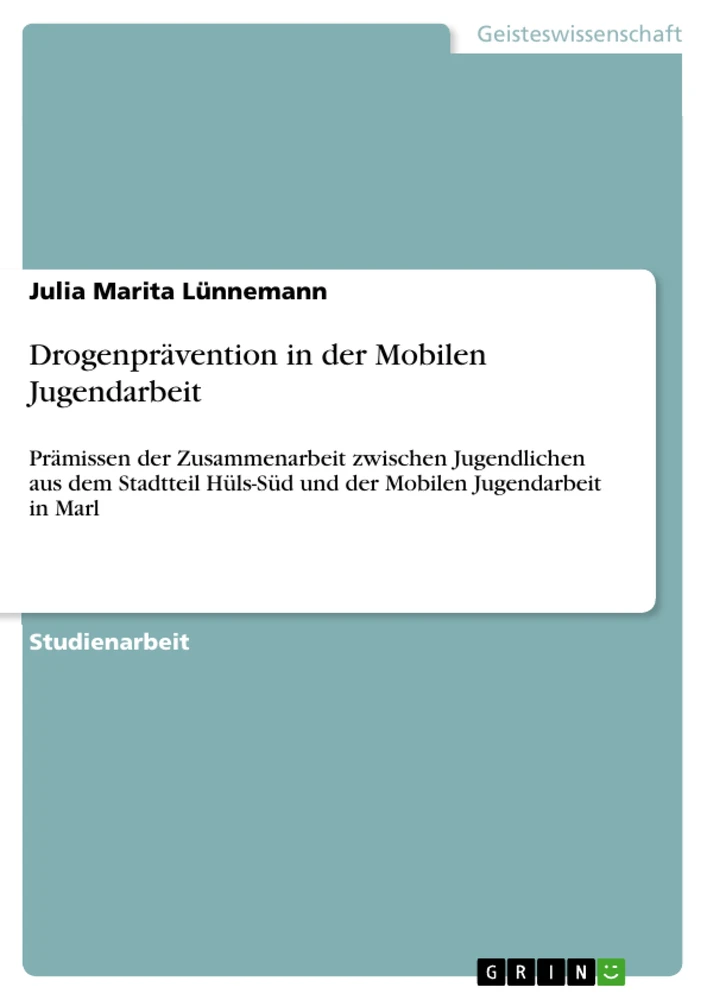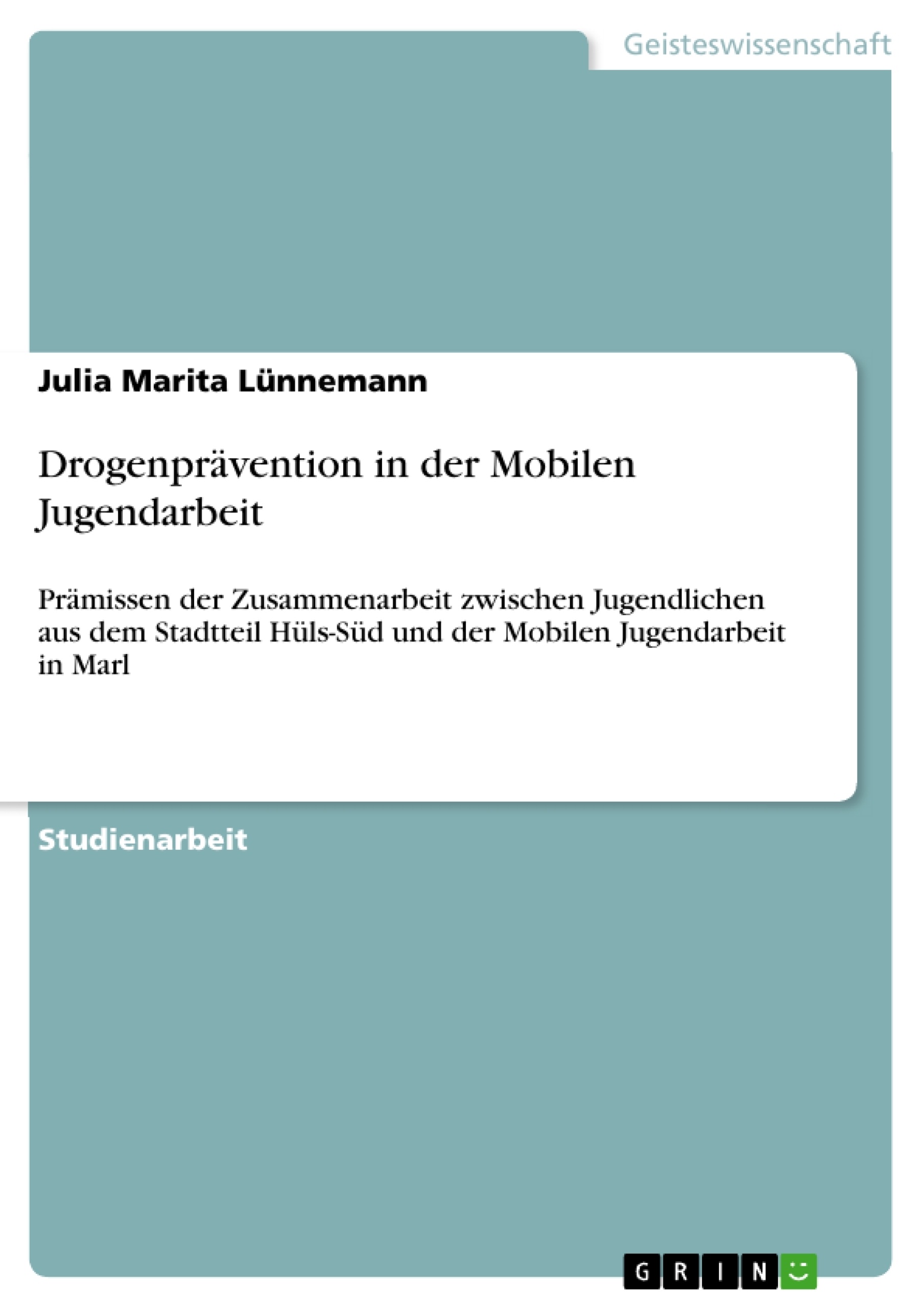In dieser Arbeit sollen die Handlungsansätze der Mobilen Jugendarbeit in Marl, bei der Arbeit mit Drogen konsumierenden Jugendlichen, aus Hüls-Süd und die Prämissen für eine Zusammenarbeit zwischen diesen Jugendlichen und der Mobilen Jugendarbeit behandelt werden.
Die Effizienz der Zusammenarbeit wird dabei nicht gemessen und ist für die Erhebung von keinem weiteren Belangen. Das Konzept der aufsuchenden Mobilen Jugendarbeit, entstanden in Stuttgart, hat sich in den letzten vierzig Jahren in Deutschland ausgebreitet. Seit ein paar Jahren verkehrt sie auch in der Kleinstadt Marl.
Der Begriff „Mobile“ verrät bereits, dass es sich um eine Form der „beweglichen“ Jugendarbeit handelt, um „Jugendarbeit auf Rädern“. Die Mobile Jugendarbeit in Marl nutzt hierfür einen umgebauten Linienbus, ein „Jugendzentrum auf Rädern“, wie die Mitarbeiter es selbst bezeichnen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Theoretische Einordnung und Einführung ins Themengebiet.
- 1.1 Definition des Begriffs „Prävention“.
- 1.2 Definition des Begriffs, im Kontext der Sozialen- und Mobilen Jugendarbeit.
- 1.3 Cannabiskonsum bei Jugendlichen in Deutschland...
- 1.4 Entstehung und Entwicklung der Mobilen Jugendarbeit in Deutschland………………………………………………..
- 1.5 Rechtliche Verankerung
- 2. Bestimmung der Sachlage .....
- 2.1 Mobile Jugendarbeit in Marl
- 2.2 Stadtteil Hüls-Süd...
- 2.3 Drogenprävention in der Mobilen Jugendarbeit Marl.…………………………….
- 2.5 Hypothesenformulierung..
- 3. Methodik..
- 3.1 Das problemzentrierte Interview..
- 3.2 Gestaltung des Interviews.......
- 3.3 Auswahl des Interviewpartners.....
- 3.4 Auswertung...
- 4. Ergebnisse der Untersuchung: Belegung der Hypothesen.....
- I. Hypothese.........
- II. Hypothese.....
- III. Hypothese.
- IV. Hypothese........
- 5. Einordnung und Betrachtung der Befunde/Diskussion.......
- 5.1 Zusammenfassung und kritische Betrachtung der Prämissen.........
- 5.2 Akzeptierende Jugendarbeit im Diskurs.......
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit der Drogenprävention in der Mobilen Jugendarbeit, speziell mit der Zusammenarbeit zwischen Jugendlichen aus dem Stadtteil Hüls-Süd und der Mobilen Jugendarbeit in Marl. Das Ziel ist es, die Prämissen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu identifizieren und zu analysieren. Dabei wird der Fokus auf die Handlungsansätze der Mobilen Jugendarbeit in Marl gelegt, wenn sie mit Jugendlichen arbeitet, die Cannabis konsumieren.
- Definition und Bedeutung von Prävention im Kontext der Sozialen- und Mobilen Jugendarbeit
- Drogenkonsum, insbesondere Cannabiskonsum, bei Jugendlichen in Deutschland
- Die Entstehung und Entwicklung der Mobilen Jugendarbeit in Deutschland
- Die Situation der Mobilen Jugendarbeit in Marl und im Stadtteil Hüls-Süd
- Die Herausforderungen und Chancen der Drogenprävention in der Mobilen Jugendarbeit in Marl
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema der Drogenprävention und beleuchtet die Definition des Begriffs „Prävention“ in verschiedenen Kontexten, insbesondere im Rahmen der Sozialen- und Mobilen Jugendarbeit. Weiterhin wird der Cannabiskonsum bei Jugendlichen in Deutschland beleuchtet. Das zweite Kapitel befasst sich mit der aktuellen Situation der Mobilen Jugendarbeit in Marl und dem Stadtteil Hüls-Süd. Es wird die Problematik des Cannabiskonsums unter Jugendlichen in Hüls-Süd aufgezeigt und die Rolle der Mobilen Jugendarbeit in der Drogenprävention in Marl dargelegt. Das dritte Kapitel widmet sich der Methodik der Forschung, die auf einem problemzentrierten Interview basiert. Die Gestaltung, Auswahl des Interviewpartners und die Auswertung des Interviews werden erläutert. Im vierten Kapitel werden die Ergebnisse der Untersuchung vorgestellt und die Hypothesen, die im zweiten Kapitel formuliert wurden, belegt. Das fünfte Kapitel beleuchtet die Ergebnisse der Untersuchung und diskutiert die Ergebnisse im Kontext der Prämissen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen der Mobilen Jugendarbeit und Jugendlichen aus Hüls-Süd.
Schlüsselwörter
Drogenprävention, Mobile Jugendarbeit, Jugendhilfe, Stadtteil Hüls-Süd, Marl, Cannabis, Cannabiskonsum, Jugendliche, Prämissen, Zusammenarbeit, problemzentriertes Interview, Qualitative Inhaltsanalyse
Häufig gestellte Fragen
Was zeichnet die Mobile Jugendarbeit in Marl aus?
Die Mobile Jugendarbeit in Marl nutzt einen umgebauten Linienbus als „Jugendzentrum auf Rädern“, um Jugendliche direkt in ihren Lebensräumen, wie dem Stadtteil Hüls-Süd, zu erreichen.
Wie wird Drogenprävention in diesem Kontext verstanden?
Prävention bedeutet hier nicht nur Aufklärung, sondern vor allem Beziehungsarbeit und die Schaffung von Angeboten, die auf die Lebensrealität konsumierender Jugendlicher (insb. Cannabis) eingehen.
Was ist das Ziel der Zusammenarbeit mit Jugendlichen in Hüls-Süd?
Ziel ist es, Vertrauen aufzubauen und durch „akzeptierende Jugendarbeit“ Handlungsansätze zu entwickeln, die den Jugendlichen helfen, Risiken zu minimieren und Unterstützung zu finden.
Welche Forschungsmethode wurde in dieser Arbeit verwendet?
Die Arbeit basiert auf einem problemzentrierten Interview und einer anschließenden qualitativen Inhaltsanalyse zur Überprüfung aufgestellter Hypothesen.
Woher stammt das Konzept der Mobilen Jugendarbeit?
Das Konzept der aufsuchenden Mobilen Jugendarbeit entstand ursprünglich in Stuttgart und hat sich in den letzten 40 Jahren in ganz Deutschland verbreitet.
- Citation du texte
- Julia Marita Lünnemann (Auteur), 2014, Drogenprävention in der Mobilen Jugendarbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/899395