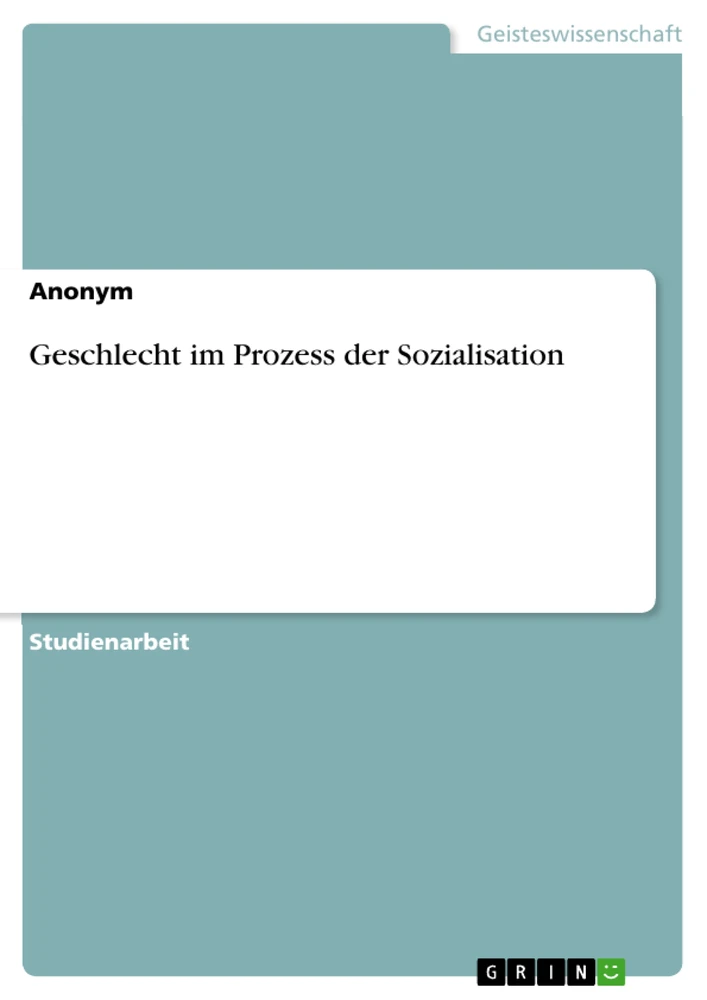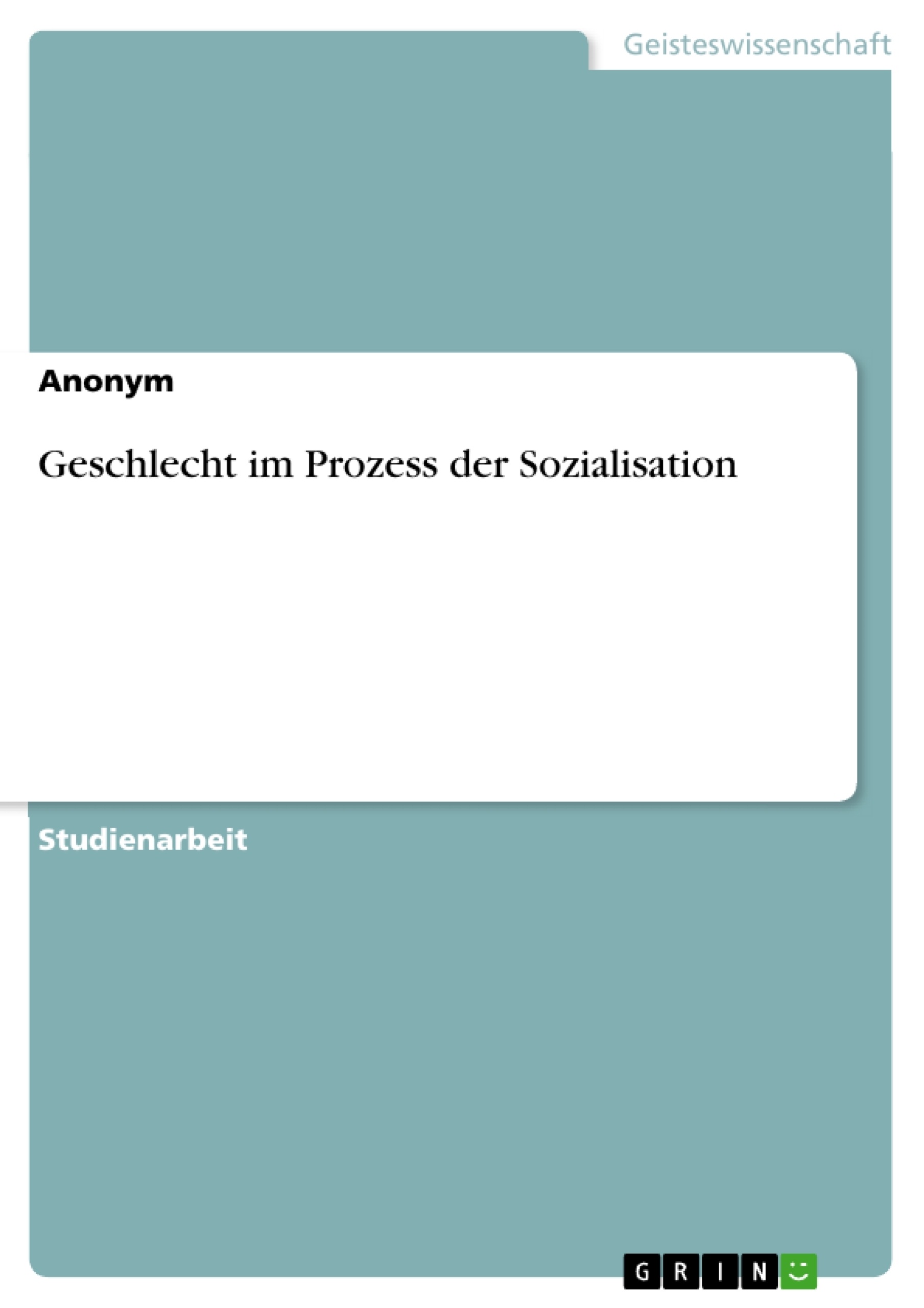Im Folgenden soll es um das Thema "Geschlecht im Prozess der Sozialisation" gehen und um die Fragestellung, inwieweit Geschlecht konstruiert und durch Sozialisation übernommen ist. Heutzutage gibt es eine Vielzahl von Wissenschaftler_innen, die sich der Geschlechterforschung widmen und (Un)gleichheiten zwischen den Geschlechtern aufgreifen und in ihrer Komplexität behandeln.
Wenn von Sozialisation die Rede ist, meint dies zeitlich vor allem einen Prozess, der innerhalb der Kindheit stattfindet.
Sozialisation meint das durch Normen und Richtlinien bewusst oder unbewusst entwickelte Verhalten im Zuge der Identitätsbildung jeden Individuums. Dazu zählen auch die Geschlechterzuordnung und Wahrnehmung als männlich oder weiblich. Bei dem Geschlechterbegriff wird folglich zwischen dem biologischen Geschlecht (aus dem us-amerikanischem abgeleitet: "sex") und dem sozialen Geschlecht ("gender") unterschieden.
Das biologische Geschlecht orientiert sich an den primären Geschlechtsorganen und wird nach der Geburt erfasst (Penis – männlich; Vagina – weiblich). Das soziale Geschlecht beschreibt ein weitaus komplexeres Konstrukt und beinhaltet u.a. welchem Geschlecht sich das Individuum zugehörig fühlt, sowie die damit einhergehenden Verhaltens- und Denkmuster, die im Zuge der Sozialisation geprägt werden. Diese begriffliche Differenzierung ermöglicht es den Wissenschaftler_innen eine Trennung von dem biologischen Geschlecht (ausgehend von den primären Geschlechtsorganen) und dem sozialen Geschlecht (also das normativ geprägte Verhalten als Mann oder Frau) vorzunehmen.
Mit der Frage wie wir Menschen zu dem werden, was wir sind, insbesondere wie sich das Individuum in einer Gesellschaft entwickelt, beschäftigten sich schon viele Soziologen und Soziologinnen. Schon bei dem soziologischen Klassiker Emile Durkheim lässt sich bereits ein erster Ansatz ableiten, dass Kinder erst durch die sie umgebende Gesellschaft lernen, was von ihnen erwartet wird und dazu zählt auch die in unserer Gesellschaft existierende Zweigeschlechtlichkeit und welches Verhalten als männlich oder als weiblich akzeptiert gilt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zum Begriff von Sozialisation und Geschlecht
- Ansätze zur Fragebeantwortung aus verschiedenen Werken mit dem Schwerpunkt auf Haushalt, Erziehung und Kinderspielwaren
- Pädagogischer Lösungsansatz des „Gender mainstreaming“
- Schluss und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Einfluss von Geschlecht auf den Prozess der Sozialisation. Sie untersucht, inwieweit das Geschlecht konstruiert und durch Sozialisation übernommen wird und beleuchtet dabei insbesondere die Rolle von Haushaltstätigkeiten, Erziehung und Kinderspielwaren in frühen Jahren.
- Die Konstruktion von Geschlecht im Kontext der Sozialisation
- Der Einfluss von Haushaltstätigkeiten auf die Geschlechterrollen
- Die Bedeutung von Erziehung für die Entwicklung von Geschlechteridentitäten
- Die Rolle von Kinderspielwaren in der Sozialisation von Geschlechtern
- Der pädagogische Ansatz des „Gender mainstreaming“ als Lösungsstrategie
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema „Geschlecht im Prozess der Sozialisation“ ein und stellt die Fragestellung nach der Konstruktion von Geschlecht durch Sozialisation in den Mittelpunkt. Sie erläutert den historischen Kontext der Geschlechterforschung und definiert die zentralen Begriffe „Sozialisation“ und „Geschlecht“.
Ansätze zur Fragebeantwortung aus verschiedenen Werken mit dem Schwerpunkt auf Haushalt, Erziehung und Kinderspielwaren
Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Ansätze zur Beantwortung der Frage, inwieweit Geschlecht konstruiert ist. Es beleuchtet insbesondere die Einflussfaktoren Haushaltstätigkeiten, Erziehung und Kinderspielwaren. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse von traditionellen Geschlechterrollen und deren Reproduktion im Sozialisationsprozess.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Sozialisation im Kontext des Geschlechts?
Sozialisation bezeichnet den Prozess, in dem Individuen durch Normen und Richtlinien bewusst oder unbewusst Verhaltensweisen entwickeln, die zur Identitätsbildung beitragen. Dazu gehört auch die Übernahme geschlechtsspezifischer Rollen und Wahrnehmungen.
Was ist der Unterschied zwischen "Sex" und "Gender"?
Das biologische Geschlecht ("Sex") orientiert sich an körperlichen Merkmalen wie den Geschlechtsorganen. Das soziale Geschlecht ("Gender") ist ein komplexes Konstrukt, das die Geschlechtsidentität sowie die durch Sozialisation geprägten Verhaltens- und Denkmuster umfasst.
Welchen Einfluss haben Kinderspielwaren auf die Geschlechterrollen?
Spielzeug spielt eine zentrale Rolle in der frühen Sozialisation, da es oft traditionelle Geschlechterrollen reproduziert und Kindern vermittelt, welches Verhalten als männlich oder weiblich akzeptiert gilt.
Wie definierte Emile Durkheim die Entwicklung von Kindern in der Gesellschaft?
Durkheim vertrat den Ansatz, dass Kinder erst durch ihre soziale Umwelt lernen, was von ihnen erwartet wird, einschließlich der gesellschaftlich existierenden Zweigeschlechtlichkeit.
Was ist das Ziel von "Gender Mainstreaming" in der Pädagogik?
Gender Mainstreaming ist ein pädagogischer Lösungsansatz, der darauf abzielt, Geschlechtergerechtigkeit zu fördern und die einseitige Konstruktion von Geschlechterrollen im Bildungsprozess zu reflektieren und aufzubrechen.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2018, Geschlecht im Prozess der Sozialisation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/899451