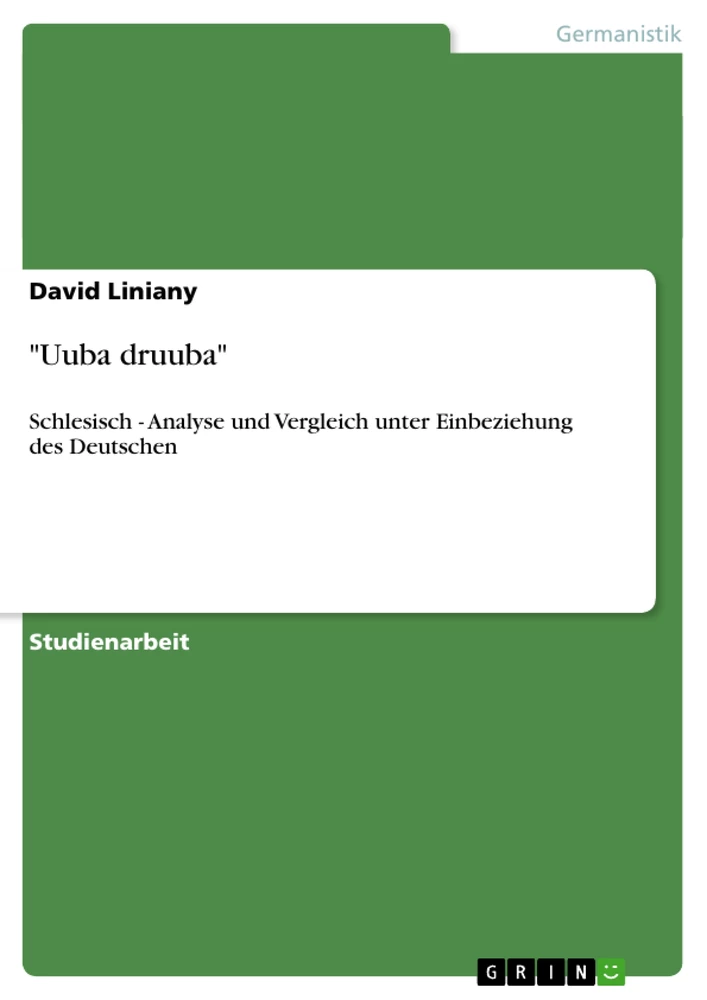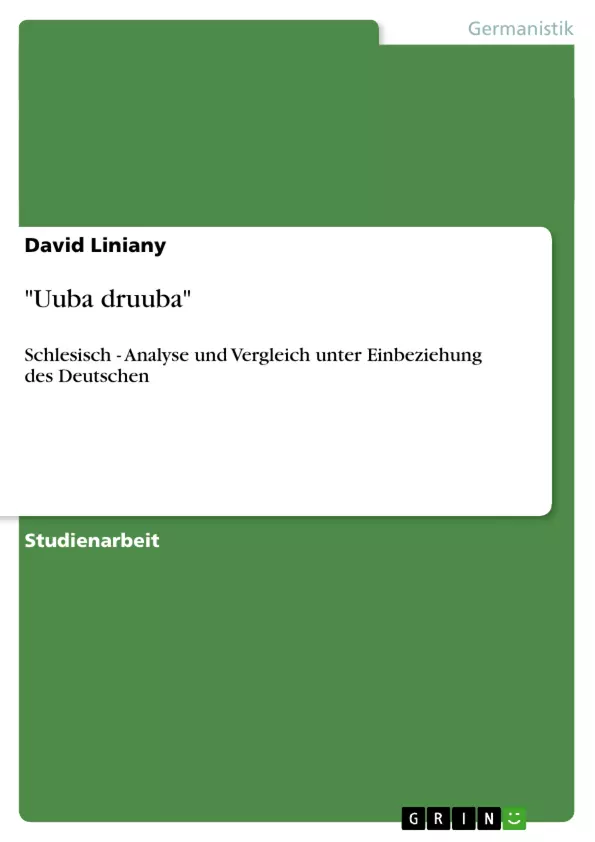Im Ursprung war Schlesien von den ostgermanischen Stämmen der Silinger und Lugier besiedelt. Der heutige Landesname Schlesien leitet sich von den wandalischen Silingern ab. Im Zuge der Völkerwanderung wanderten Ostgermanen nach Süden und ermöglichten somit eine Ansiedlung, in der Mitte des 5. Jahrhunderts, von Slawen in Schlesien. Diese nahmen gegen Endes des 10. Jahrhunderts an der Bildung des polnischen Reiches unter Mscislaw I. teil. Aus dem Haus der Piasten (im 12. Jh.) kristallisierte sich im weiteren Verlauf der Geschichte eine eigenständige schlesische Herzogs-Herrschaftslinie heraus. Besonders das Entgegenstellen des Herzogs Heinrich I. dem Bärtigen (1208-38) gegen Polen förderte eine bewusste Ansiedlung von deutschen Handwerkern, Bauern, Bergleuten und Kaufleuten. In erster Linie handelte es sich hierbei um Siedler aus fränkischen, thüringischen und obersächsischen Gebieten, doch auch Westfalen und Hessen kamen der Möglichkeit einer Migration nach. Allein diese Tatsache ließ viele Spracheinflüsse in den schlesischen Raum eindringen und lässt eine heutige Mundartenkarte des Gebietes sehr reich und bunt erscheinen.
Gerade die Ansiedlung von Arbeitern aus dem ehemals Deutschen Reich führte zu einer Gründung zahlreicher Dörfer und Städte im Zeitraum von 1300-1500. Schon 1320 gab es bedingt durch eine dynastische Aufteilung zehn niederschlesische und sieben oberschlesische Fürstentümer, die in ihrer Orientierung stark nach Böhmen ausgerichtet waren und letztendlich sogar 1327 die böhmische Lehnshoheit anerkannten. 1526 ging Schlesien mit dem Königreich Böhmen in Habsburgische Herrschaft über, doch hielt die Vorherrschaft des fürstlichen Geschlechts der Piasten noch bis 1675 an. Erst der eben mit 1675 datierte Tod des letzten Piasten ließ Schlesien zu einer österreichischen Provinz werden.
Im weiteren Verlauf der Historie wurde Schlesien von drei schlesischen Kriegen überzogen, was einen Abtritt der Schlesischen Provinz an Preußen hervorbrachte und nur ein kleines Gebiet um Troppau und Teschen als Herzogtum Schlesien bei Österreich bestehen ließ. Der südöstliche Teil Schlesiens wird als Oberschlesien bezeichnet. Der nordwestliche Teil, welcher sich der Tiefenebene zuwendet, nennt man Niederschlesien.
Inhaltsverzeichnis
- Zum Ursprung und Geographie Schlesiens – des Schlesischen
- Der schlesische Dialekt
- Die schlesischen Teilmundarten
- Das Gebirgsschlesische
- Das Gleetzische (Glätzische auf dt.)
- Die Oberlausitzer Mundart
- Das Neiderländische „Aiber der Auder“
- Die Kräutermundart
- Die Breslauische Mundart
- Oberschlesisch (auch „Wasserpolnisch\" genannt)
- Die schlesischen Teilmundarten
- Lateinische und französische Einflüsse in der schlesischen Sprache „Fremdwörter“
- Einfluss des Polnischen auf die schlesische Sprache
- Satzlehre und Satzbildung im Schlesischen
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert den schlesischen Dialekt, seine Ursprünge und seine geographische Verbreitung. Sie untersucht die verschiedenen Teilmundarten des Schlesischen und deren Entwicklung, sowie den Einfluss anderer Sprachen, insbesondere des Polnischen, auf die schlesische Sprache. Die Satzstruktur und -bildung im Schlesischen wird ebenfalls behandelt.
- Ursprung und geographische Verteilung des Schlesischen
- Klassifizierung und Charakterisierung der schlesischen Dialekte
- Sprachliche Einflüsse auf das Schlesische (Polnisch, Deutsch etc.)
- Grammatik und Satzbau des Schlesischen
- Schlesisch im Vergleich zum Standarddeutschen
Zusammenfassung der Kapitel
Zum Ursprung und Geographie Schlesiens – des Schlesischen: Dieses Kapitel befasst sich mit der geschichtlichen Entwicklung Schlesiens und seinen geographischen Grenzen. Es beschreibt die Besiedlung Schlesiens durch ostgermanische Stämme wie die Silingen und Lugier, gefolgt von slawischen Siedlern. Die Ansiedlung deutscher Handwerker, Bauern und Kaufleute, insbesondere aus fränkischen, thüringischen und obersächsischen Gebieten, wird detailliert dargestellt. Die Entstehung verschiedener Fürstentümer und der Übergang Schlesiens unter habsburgische Herrschaft werden erläutert, ebenso wie die schlesischen Kriege und die folgende Teilung Schlesiens zwischen Österreich und Preußen. Die Unterscheidung zwischen Ober- und Niederschlesien wird ebenfalls geklärt, wobei der Fokus auf der komplexen historischen Entwicklung und ihren Einfluss auf die sprachliche Vielfalt liegt.
Der schlesische Dialekt: Das Kapitel beschreibt den schlesischen Dialekt als hochdeutschen Dialekt, genauer als ostmitteldeutsche Mundart. Es wird die Hauptmundart, das Gebirgsschlesische, sowie die Unterteilung in Stamm- und Diphtongierungsmundarten erklärt. Die einzelnen Teilmundarten wie Glätzisch, Neiderländisch, Kräutermundart, Breslauische Mundart und Oberschlesisch werden benannt und in ihren Merkmalen grob umrissen. Der Unterschied zwischen Stamm- und Diphtongierungsmundarten, der sich in der Vokalentwicklung zeigt, wird im Detail erklärt, und es wird auf die Bedeutung dieses Unterschiedes für die Klassifizierung der schlesischen Dialekte hingewiesen. Die Zusammenfassung verweist auf die Komplexität des Schlesischen und die Bedeutung der Unterscheidung von Stamm- und Diphtongierungsmundarten für das Verständnis seiner Vielfalt.
Lateinische und französische Einflüsse in der schlesischen Sprache „Fremdwörter“: Dieses Kapitel (und das folgende) werden in der Kurzfassung weggelassen, um keine wichtigen Informationen vorwegzunehmen.
Einfluss des Polnischen auf die schlesische Sprache: Dieses Kapitel (und das folgende) werden in der Kurzfassung weggelassen, um keine wichtigen Informationen vorwegzunehmen.
Satzlehre und Satzbildung im Schlesischen: Dieses Kapitel (und das folgende) werden in der Kurzfassung weggelassen, um keine wichtigen Informationen vorwegzunehmen.
Schlüsselwörter
Schlesisch, Dialekt, Mundart, Sprachgeschichte, Geographie Schlesiens, Gebirgsschlesisch, Stammmundarten, Diphtongierungsmundarten, Polnische Einflüsse, Deutsche Sprache, Mittelhochdeutsch, Satzbau.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum schlesischen Dialekt
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Dieser Text bietet einen umfassenden Überblick über den schlesischen Dialekt. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und die wichtigsten Themen, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Glossar mit Schlüsselbegriffen. Der Fokus liegt auf der sprachlichen Entwicklung des Schlesischen, seinen geographischen Varietäten und den Einflüssen anderer Sprachen.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text gliedert sich in die Kapitel: "Zum Ursprung und Geographie Schlesiens – des Schlesischen", "Der schlesische Dialekt", "Lateinische und französische Einflüsse in der schlesischen Sprache „Fremdwörter“", "Einfluss des Polnischen auf die schlesische Sprache", "Satzlehre und Satzbildung im Schlesischen" und "Schluss". Die Kapitel drei bis fünf enthalten in der Vorschau nur eine kurze Zusammenfassung.
Worüber handelt das Kapitel "Zum Ursprung und Geographie Schlesiens – des Schlesischen"?
Dieses Kapitel beschreibt die historische Entwicklung Schlesiens und seine geographischen Grenzen. Es beleuchtet die Besiedlung durch verschiedene Stämme, die Entstehung von Fürstentümern, die schlesischen Kriege und die Teilung Schlesiens zwischen Österreich und Preußen. Der Schwerpunkt liegt auf dem Einfluss der komplexen historischen Entwicklung auf die sprachliche Vielfalt.
Was wird im Kapitel "Der schlesische Dialekt" behandelt?
Dieses Kapitel charakterisiert den schlesischen Dialekt als hochdeutschen Dialekt und ostmitteldeutsche Mundart. Es erklärt die Hauptmundart (Gebirgsschlesisch) und die Unterteilung in Stamm- und Diphtongierungsmundarten. Die verschiedenen Teilmundarten wie Glätzisch, Neiderländisch, Kräutermundart, Breslauische Mundart und Oberschlesisch werden benannt und kurz beschrieben. Der Unterschied zwischen Stamm- und Diphtongierungsmundarten wird detailliert erläutert.
Welche Sprachlichen Einflüsse werden behandelt?
Der Text erwähnt den Einfluss des Lateinischen, Französischen und insbesondere des Polnischen auf den schlesischen Dialekt. Die Kapitel zu diesen Einflüssen sind in der Vorschau jedoch nicht detailliert beschrieben.
Wie wird die Grammatik und der Satzbau des Schlesischen behandelt?
Die Satzlehre und Satzbildung im Schlesischen wird in einem eigenen Kapitel behandelt, dessen Inhalt in der vorliegenden Vorschau jedoch nicht detailliert dargestellt ist.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für den Text?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Schlesisch, Dialekt, Mundart, Sprachgeschichte, Geographie Schlesiens, Gebirgsschlesisch, Stammmundarten, Diphtongierungsmundarten, Polnische Einflüsse, Deutsche Sprache, Mittelhochdeutsch, Satzbau.
Für wen ist dieser Text gedacht?
Dieser Text ist für Personen gedacht, die sich akademisch mit dem schlesischen Dialekt auseinandersetzen möchten. Er dient als Überblick und Einleitung zu einem tiefergehenden Studium.
- Quote paper
- David Liniany (Author), 2006, "Uuba druuba", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/89975