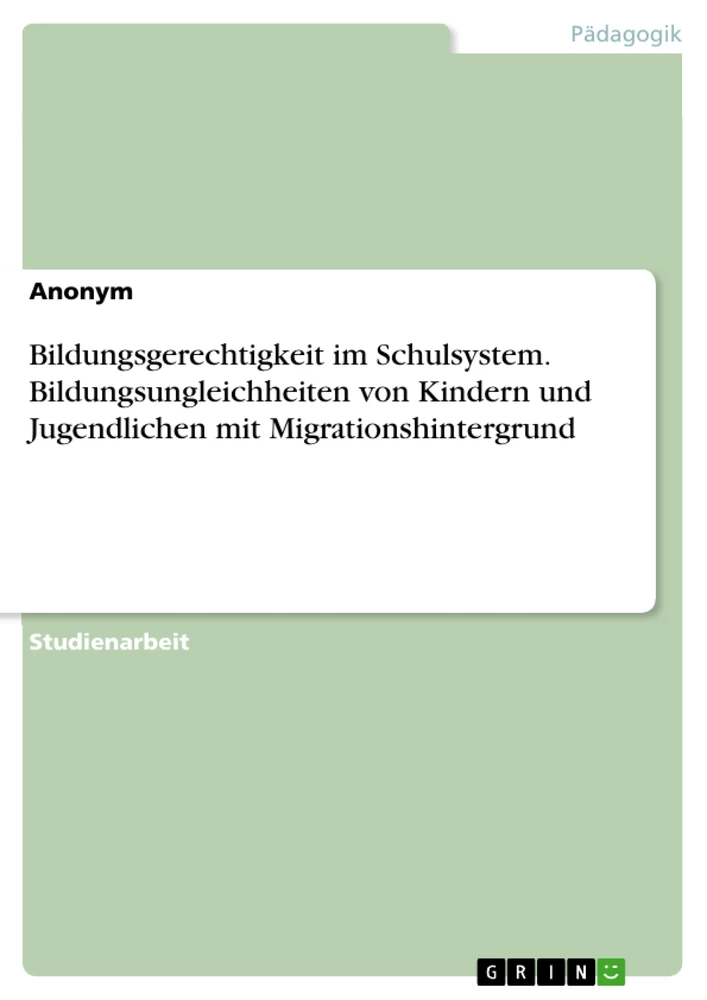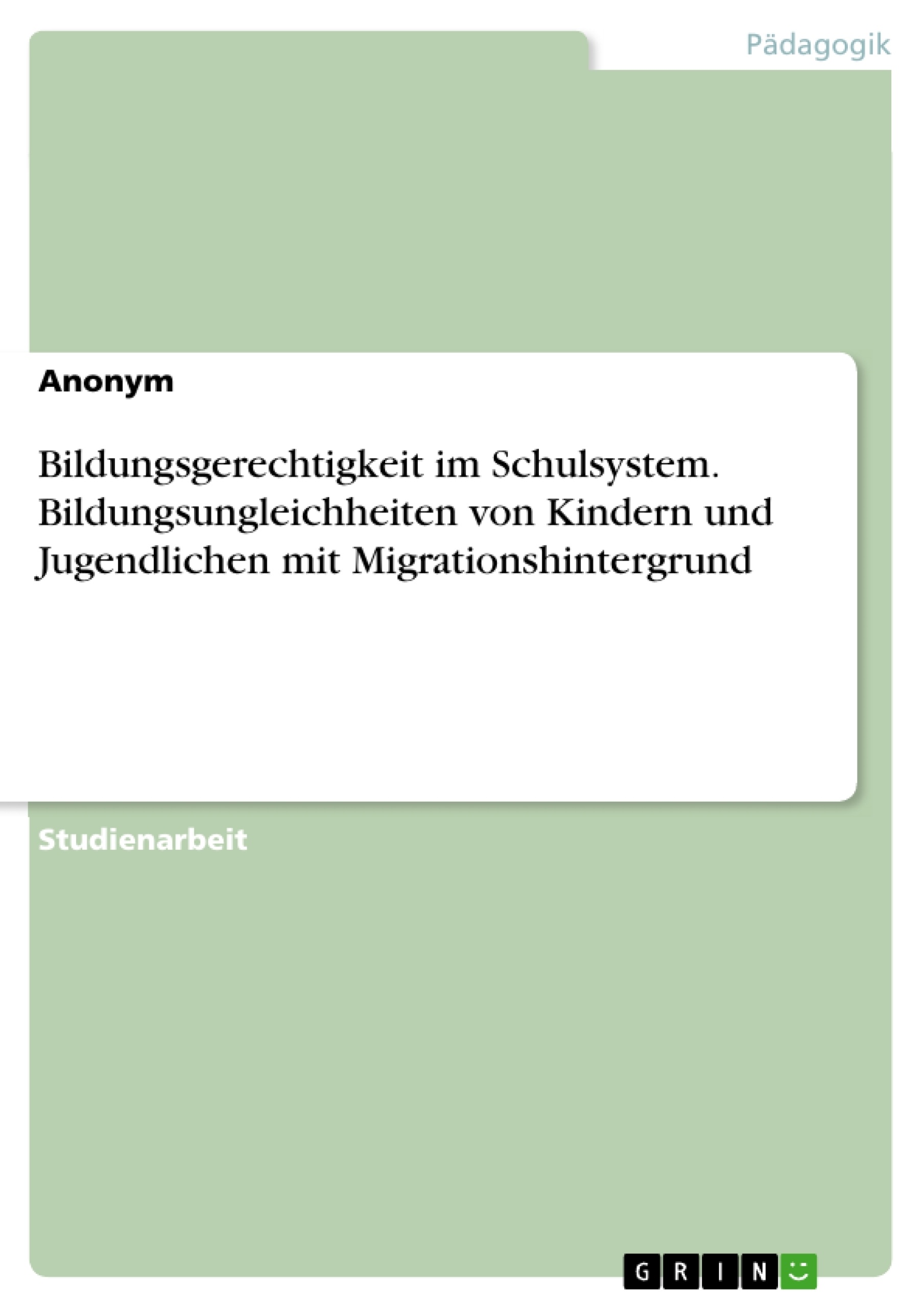Die Hausarbeit beschäftigt sich mit Theorien und Studien zur Analyse von Ungleichheiten in der Schule. Dabei geht es speziell um in Deutschland lebende Jugendliche mit Migrationshintergrund.
Die Bundesrepublik Deutschland etablierte sich in den letzten vierzig Jahren als Einwanderungsland und es entwickelte sich eine große Multikulturalität und Vielsprachigkeit. Das Recht auf Bildung herrscht hier für alle. Seit einigen Jahren ist durch die PISA-Studie bekannt, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund mehr Defizite in ihrer Schullaufbahn aufweisen als Jugendliche ohne Migrationshintergrund. Um bessere Bildungserfolge zu gewährleisten, ist eine erfolgreiche Integration seitens der Bildungspolitik unausweichlich.
Zunächst wird auf den Punkt der Bildungsgerechtigkeit eingegangen. Darauffolgend soll ein empirischer Einblick in Studien über Bildungsungleichheiten eröffnet werden. Anschließend erläutert der Autor die Thematik der "Theorien der kulturellen Defizite" sowie den Begriff der "institutionellen Diskriminierung" im Kontext Schule. Diese beiden Ursachen werden anhand von Fachliteratur und verschiedenen Autorenmeinungen analysiert und in Zusammenhang mit den empirischen Befunden beleuchtet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Bildungsgerechtigkeit
- 3. Empirische Einblicke in Bildungsungleichheit
- 4. Ursachen der Bildungsungleichheit
- 4.1. Theorie der kulturellen Defizite
- 4.2. Institutionelle Diskriminierung
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit Theorien und Studien zur Analyse von Ungleichheiten im Bildungssystem, insbesondere im Hinblick auf Jugendliche mit Migrationshintergrund in Deutschland. Sie beleuchtet die Herausforderungen der Bildungsgerechtigkeit in einem multikulturellen Kontext und untersucht die Ursachen für Bildungsungleichheit, die durch empirische Studien belegt werden. Die Arbeit analysiert die Theorie der kulturellen Defizite und die institutionelle Diskriminierung als Schlüsselfaktoren für die Benachteiligung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund im Bildungssystem. Ziel ist es, ein besseres Verständnis für die Entstehung von Bildungsungleichheit unter diesen Ursachen zu entwickeln und die Faktoren zu identifizieren, die für eine Verbesserung der Situation relevant sind.
- Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit im Bildungssystem
- Empirische Befunde zu Bildungsungleichheit bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund
- Theorie der kulturellen Defizite als Ursache für Bildungsungleichheit
- Institutionelle Diskriminierung im Bildungskontext
- Faktoren, die zur Benachteiligung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund beitragen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Bildungsungleichheit bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Deutschland ein. Es beleuchtet die aktuelle Situation und stellt die Relevanz des Themas dar.
- Kapitel 2: Bildungsgerechtigkeit: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Bildungsgerechtigkeit und erläutert seine Bedeutung im Kontext des deutschen Bildungssystems. Es wird auf die Begriffe Chancengleichheit und Bildungsungleichheit eingegangen und ihre Bedeutung in Relation zueinander dargestellt.
- Kapitel 3: Empirische Einblicke in Bildungsungleichheit: Dieses Kapitel bietet einen empirischen Einblick in Studien zur Bildungsungleichheit. Es werden ausgewählte Befunde vorgestellt, die auf die Ursachen der Ungleichheit hinweisen.
- Kapitel 4: Ursachen der Bildungsungleichheit: Dieses Kapitel analysiert zwei wichtige Ursachen für Bildungsungleichheit: die Theorie der kulturellen Defizite und die institutionelle Diskriminierung. Die Kapitel 4.1 und 4.2 beleuchten diese beiden Ursachen anhand von Fachliteratur und verschiedenen Autorenmeinungen. Die empirischen Befunde aus Kapitel 3 werden in diesem Zusammenhang diskutiert.
Schlüsselwörter
Bildungsgerechtigkeit, Bildungsungleichheit, Chancengleichheit, Migrationshintergrund, kulturelle Defizite, institutionelle Diskriminierung, empirische Studien, PISA-Studie, Integration, Humankapital.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Bildungsgerechtigkeit im deutschen Schulsystem?
Bildungsgerechtigkeit zielt darauf ab, dass alle Kinder, unabhängig von ihrer Herkunft oder ihrem sozialen Status, die gleichen Chancen auf Bildungserfolg haben.
Warum haben Jugendliche mit Migrationshintergrund oft schlechtere Bildungserfolge?
Empirische Studien wie PISA zeigen Defizite auf, die oft auf sprachliche Barrieren, soziale Benachteiligung und institutionelle Rahmenbedingungen zurückzuführen sind.
Was besagt die "Theorie der kulturellen Defizite"?
Diese Theorie schreibt den Bildungsmangel den fehlenden kulturellen oder sprachlichen Ressourcen im Elternhaus der Migranten zu, wird jedoch in der Fachliteratur kritisch diskutiert.
Was ist institutionelle Diskriminierung in der Schule?
Es handelt sich um Benachteiligungen, die durch die Strukturen und Routinen des Schulsystems selbst entstehen, wie etwa bei Übergangsempfehlungen oder der Zuweisung zu Schulformen.
Welche Rolle spielt die PISA-Studie für dieses Thema?
Die PISA-Studie hat die Bildungsungleichheit in Deutschland erst massiv in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt und den Reformbedarf bei der Integration aufgezeigt.
Wie kann die Bildungspolitik für mehr Chancengleichheit sorgen?
Durch gezielte Sprachförderung, den Abbau institutioneller Hürden und eine bessere Unterstützung von Familien mit geringem Humankapital.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2017, Bildungsgerechtigkeit im Schulsystem. Bildungsungleichheiten von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/899896