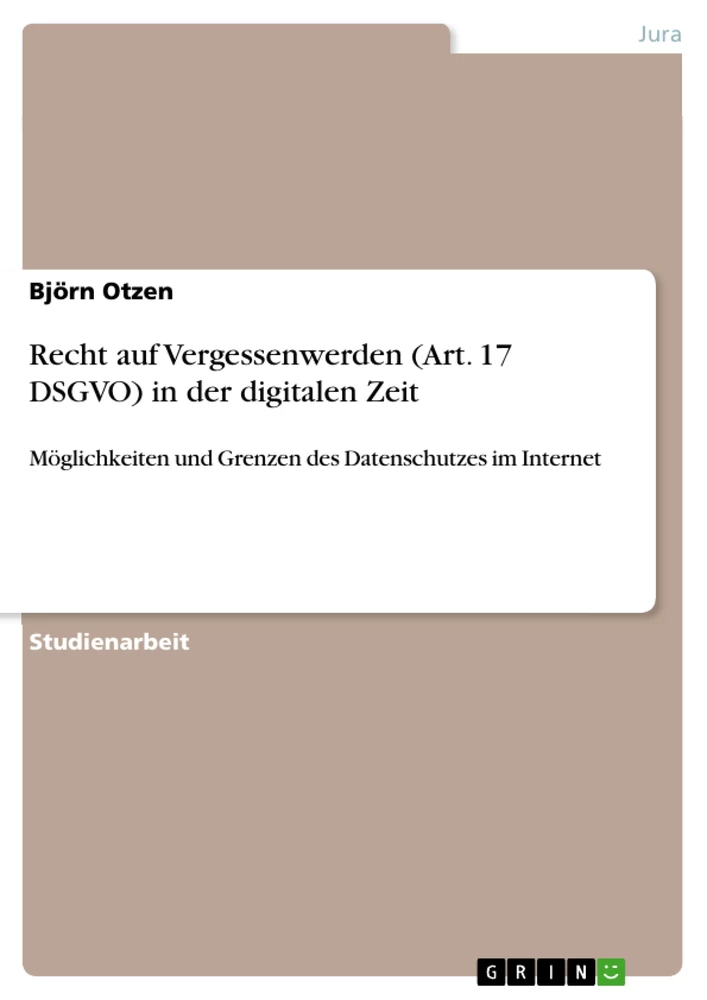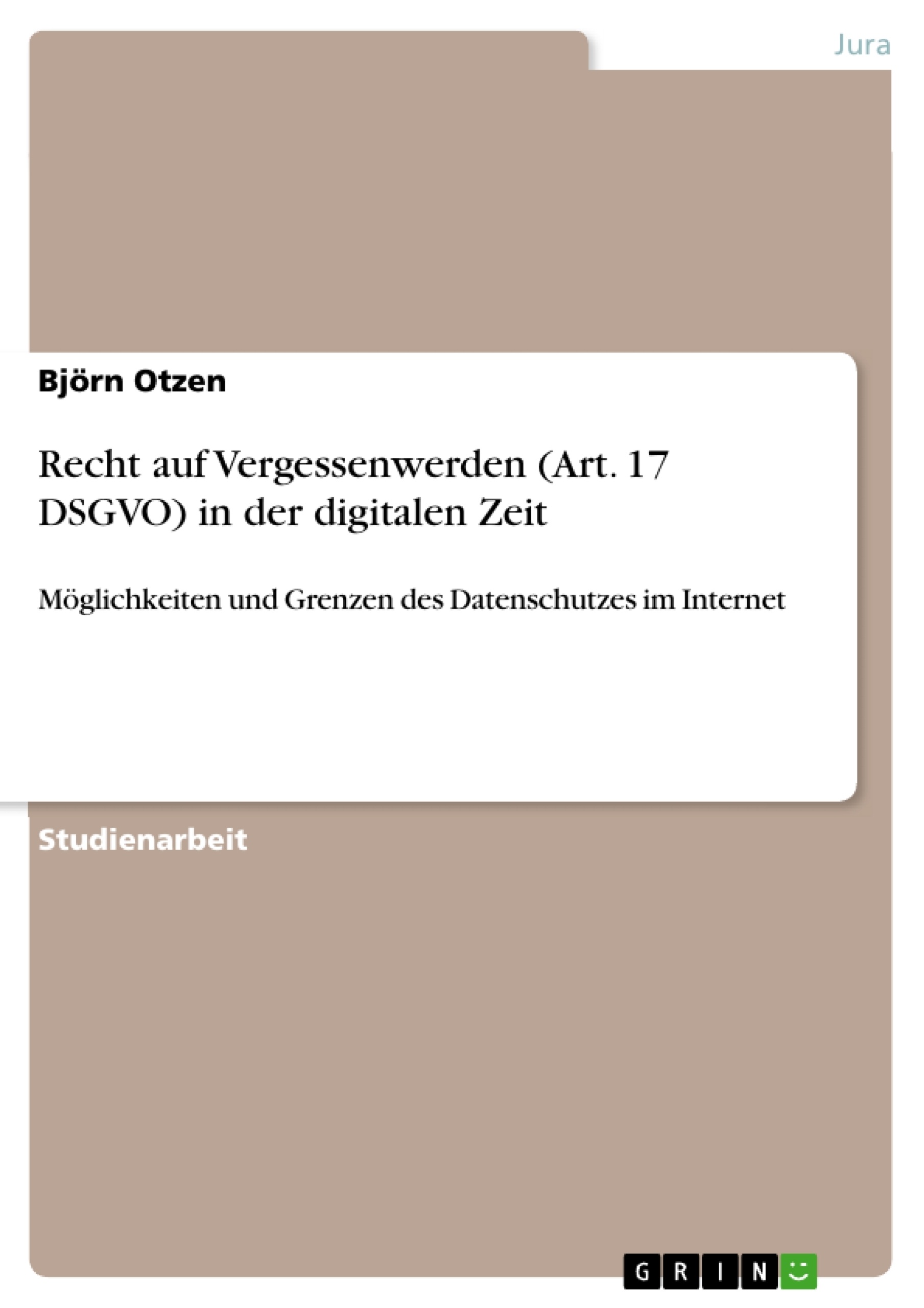Inwieweit die neue Verordnung, allen voran das Recht auf Vergessenwerden (Art. 17 DSGVO), die hohen Erwartungen in Zukunft erfüllen kann, soll in dieser Arbeit untersucht werden.
Der Umgang mit personenbezogenen Daten im Internet ist ein sensibles datenschutzrechtliches Thema. Bei der Nutzung des Internets wird eine Vielzahl von persönlichen Daten gespeichert. Dies ist dem Nutzer häufig nicht bewusst. Die Fragen des Datenschutzrechts im Internet sind dabei häufig sehr komplex und die geltenden Gesetze hinken der tatsächlichen Entwicklung im Netz dabei um Jahre hinterher. Für eine bessere Regulierung soll das Internet in Zukunft vergessen können. Dies sieht die neue EU-Verordnung zum Datenschutz in Art. 17 vor, welche ab dem 25. Mai 2018 in Kraft getreten ist.
Ziel dieser Arbeit ist es, herauszufinden welche Möglichkeiten, aber auch Grenzen in der Umsetzung liegen. Zusätzlich werden Ansätze und Maßnahmen erörtert, die die Zielsetzung des 17. Artikels unterstützen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Aufbau und methodisches Vorgehen
- 1.2 Abgrenzung
- 2. Definition
- 3. Rechtslage bis zur EU-Datenschutzgrundverordnung
- 3.1 Bundesdatenschutzgesetz
- 3.2 Der Fall Mario Costeja González
- 4. Die EU-Datenschutz-Grundverordnung
- 4.1 Aufbau und Ziel
- 4.2 Darstellung der Inhalte
- 4.3 Artikel 17 „Recht auf Vergessenwerden“
- 5. Diskussion
- 6. Fazit & Aussicht
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Recht auf Vergessenwerden im digitalen Kontext, insbesondere im Lichte der EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO). Sie beleuchtet die Möglichkeiten und Grenzen der Umsetzung dieses Rechts und erörtert unterstützende Ansätze und Maßnahmen. Der Fokus liegt auf der Analyse der Rechtslage vor und nach der DSGVO.
- Definition und Abgrenzung des Rechts auf Vergessenwerden
- Rechtslage vor der EU-DSGVO (inkl. Bundesdatenschutzgesetz und dem Fall Costeja González)
- Analyse von Artikel 17 der EU-DSGVO („Recht auf Vergessenwerden“)
- Diskussion der Herausforderungen bei der Umsetzung
- Ausblick auf zukünftige Entwicklungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik des Rechts auf Vergessenwerden im digitalen Zeitalter ein. Es beschreibt den Aufbau und die Methodik der Arbeit und grenzt den Untersuchungsgegenstand ab. Die Einleitung legt die Bedeutung des Themas im Kontext des Datenschutzes im Internet heraus und begründet die Notwendigkeit einer genaueren Betrachtung der Rechtslage und ihrer Umsetzung.
2. Definition: Dieses Kapitel liefert eine präzise Definition des Rechts auf Vergessenwerden, indem es den Begriff kontextualisiert und von ähnlichen Konzepten abgrenzt. Es legt die Grundlage für die spätere Analyse der Rechtslage und der Umsetzung des Rechts in der Praxis. Die klare Definition ist entscheidend für das Verständnis der folgenden Kapitel.
3. Rechtslage bis zur EU-Datenschutzgrundverordnung: Dieses Kapitel analysiert die Rechtslage zum Datenschutz und dem Recht auf Vergessenwerden vor Inkrafttreten der EU-DSGVO. Es untersucht das Bundesdatenschutzgesetz und den wegweisenden Fall Mario Costeja González vor dem Europäischen Gerichtshof, der maßgeblich zur Entwicklung des Rechts auf Vergessenwerden beigetragen hat. Die Kapitel erläutert die Lücken und Herausforderungen der bisherigen Rechtslage.
4. Die EU-Datenschutz-Grundverordnung: Dieses Kapitel befasst sich ausführlich mit der EU-Datenschutz-Grundverordnung und ihrem Artikel 17, der das Recht auf Vergessenwerden explizit regelt. Es analysiert den Aufbau und die Ziele der Verordnung sowie die konkreten Inhalte des Artikels 17, einschließlich der Voraussetzungen und Grenzen für die Ausübung dieses Rechts. Die Bedeutung der DSGVO für den Datenschutz und den Umgang mit persönlichen Daten im Internet wird hervorgehoben.
5. Diskussion: Dieses Kapitel diskutiert die Herausforderungen und Probleme bei der praktischen Umsetzung des Rechts auf Vergessenwerden. Es analysiert verschiedene Aspekte wie die technische Umsetzbarkeit, die Abwägung mit anderen Rechten (z.B. Meinungsfreiheit), sowie die Rolle der Suchmaschinenanbieter. Die Diskussion bietet einen kritischen Blick auf die Effektivität und Reichweite des Rechts.
Schlüsselwörter
Recht auf Vergessenwerden, Datenschutz, EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO), Artikel 17 DSGVO, Internet, digitale Daten, personenbezogene Daten, Suchmaschinen, Mario Costeja González, Bundesdatenschutzgesetz, Europäischer Gerichtshof (EuGH).
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Recht auf Vergessenwerden
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht umfassend das Recht auf Vergessenwerden im digitalen Kontext, insbesondere im Hinblick auf die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Sie analysiert die Rechtslage vor und nach der DSGVO, beleuchtet die Möglichkeiten und Grenzen der Umsetzung und erörtert unterstützende Maßnahmen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Abgrenzung des Rechts auf Vergessenwerden, die Rechtslage vor der DSGVO (inkl. Bundesdatenschutzgesetz und dem Fall Costeja González), die Analyse von Artikel 17 DSGVO, die Herausforderungen bei der Umsetzung und einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Definition des Rechts auf Vergessenwerden, ein Kapitel zur Rechtslage vor der DSGVO, ein Kapitel zur DSGVO und Artikel 17, eine Diskussionssektion und ein Fazit. Die Einleitung beschreibt Aufbau und Methodik und grenzt den Untersuchungsgegenstand ab. Die Kapitelzusammenfassungen bieten einen detaillierten Überblick über den Inhalt jedes Kapitels.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, das Recht auf Vergessenwerden im digitalen Kontext zu analysieren und die Möglichkeiten und Grenzen seiner Umsetzung zu beleuchten. Der Fokus liegt auf der Analyse der Rechtslage vor und nach der DSGVO, um ein umfassendes Verständnis des Themas zu ermöglichen.
Welche Rolle spielt der Fall Mario Costeja González?
Der Fall Costeja González vor dem Europäischen Gerichtshof ist ein wegweisender Präzedenzfall, der maßgeblich zur Entwicklung des Rechts auf Vergessenwerden beigetragen hat. Die Arbeit analysiert diesen Fall im Kontext der Rechtslage vor der DSGVO und seiner Bedeutung für die aktuelle Rechtsprechung.
Was ist die Bedeutung von Artikel 17 DSGVO?
Artikel 17 DSGVO regelt explizit das Recht auf Vergessenwerden. Die Arbeit analysiert diesen Artikel detailliert, einschließlich der Voraussetzungen und Grenzen für die Ausübung dieses Rechts. Die Bedeutung der DSGVO für den Datenschutz und den Umgang mit persönlichen Daten im Internet wird hervorgehoben.
Welche Herausforderungen werden bei der Umsetzung des Rechts auf Vergessenwerden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert Herausforderungen wie die technische Umsetzbarkeit, die Abwägung mit anderen Rechten (z.B. Meinungsfreiheit) und die Rolle der Suchmaschinenanbieter. Die Diskussion bietet einen kritischen Blick auf die Effektivität und Reichweite des Rechts.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Recht auf Vergessenwerden, Datenschutz, EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO), Artikel 17 DSGVO, Internet, digitale Daten, personenbezogene Daten, Suchmaschinen, Mario Costeja González, Bundesdatenschutzgesetz, Europäischer Gerichtshof (EuGH).
- Quote paper
- Björn Otzen (Author), 2018, Recht auf Vergessenwerden (Art. 17 DSGVO) in der digitalen Zeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/899996