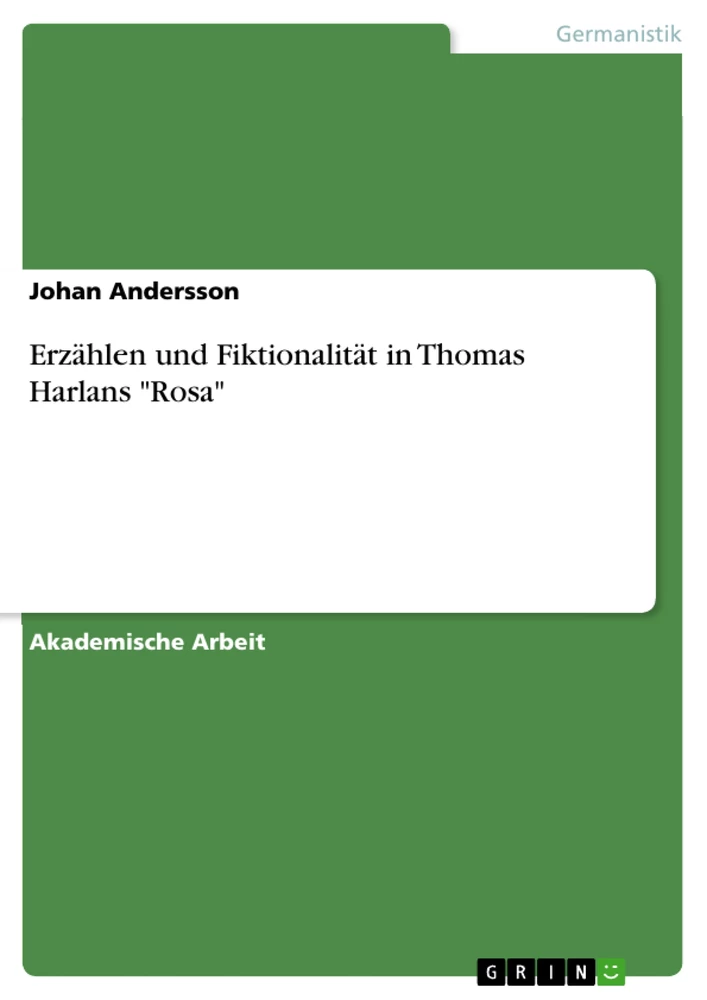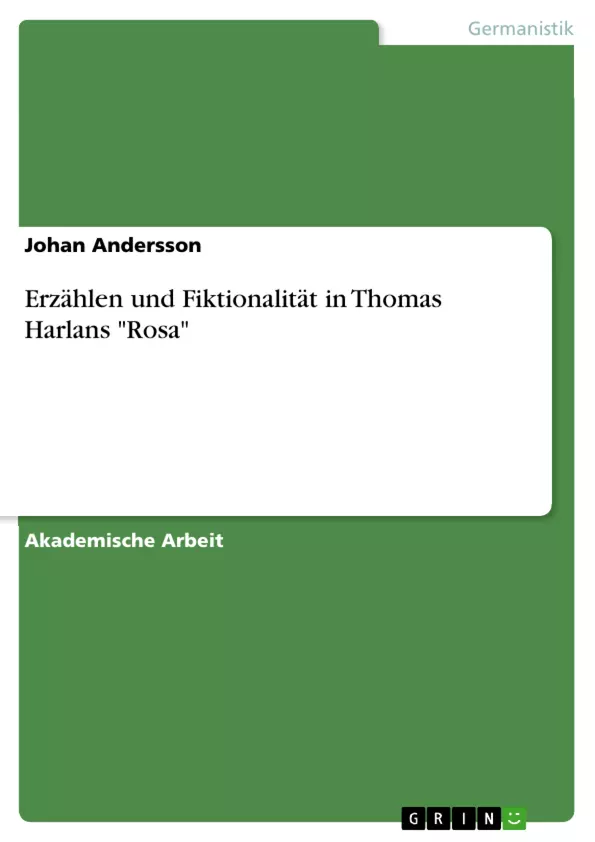Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht darin, das Werk "Rosa" von Thomas Harlan in Bezug auf dessen Fiktivität bzw. Fiktionalität zu beschreiben, Begriffe, die nach Frank Zipfel dem Begriff Fiktion untergeordnet sind. Diese und andere relevante Begriffe und Gedanken von Gérard Genette und Matías Martínez und Michael Scheffel werden unten kurz erläutert, und im Hauptteil der Arbeit weiterentwickelt.
Anhand von Beispielen sollen Ausschnitte des Werkes als fiktiv, bzw. fiktional beschrieben, und die Funktionen und Wirkung der Fiktivität bzw. Fiktionalität diskutiert werden. Fragen, die auch beantwortet werden sollen, sind, inwiefern der Paratext und die Vorkenntnisse des Rezipienten bestimmend für die Interpretation des Werkes als fiktional sind, und wie die verschiedenen Geschichten erzählt werden in Bezug auf die Erzählperspektiven Stimme und Modus nach der Definition Genettes. Eine weitere Frage, die hier beantwortet werden soll, ist, inwiefern das Werk oder Teile dessen eher als faktual bezeichnet werden kann/können.
Die komplexe Struktur des Werkes, wo mehrere Erzählstimmen ineinander eingeflochten, Text und Paratext einander widersprechen, und historisch verifizierbaren Daten mit Fantastischem eingeblendet werden, macht es ein gutes Objekt einer fiktionstheoretischen Studie aus. Diese Komplexität, sowie die vernachlässigbare Forschung an Harlans Werk, ist ein guter Ausgangspunkt für eine Analyse zur narrativen Struktur und Funktion des Werkes.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- 1. Einleitung
- 1.1 Zum Autor
- 1.2 Zum Werk
- 2. Ziel der Arbeit
- 3. Zum Stand der Forschung
- 4. Zur Erzähl- und Fiktionstheorie
- 4.1 Begriffsbestimmung
- 4.2 Erzählperspektive
- 4.3 Fiktionssignale
- 4.3.1 Paratextuelle Fiktionssignale
- 4.3.2 Textuelle Fiktionssignale
- 5. Textanalyse Rosa
- 5.1 Der Paratext
- 5.2 Die Geschichte von Rosa und Józef
- 5.3 Die wiedergefundenen Akte
- 5.4 Richards Sanatoriumsaufenthalt
- 5.5 Die veränderte Flora der Kulmhofer Blöße
- 5.6 Die Maderholzsche Umnachtung
- 5.7 Rosas Tod
- 6. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Verwendung von Fiktionalität und Fiktivität in Thomas Harlans Werk „Rosa“. Ziel ist es, die elementaren narrativen Strukturen wie Modus und Stimme zu analysieren und deren Beitrag zur Gestaltung der wahrgenommenen Fiktionalität beim Rezipienten aufzuzeigen. Weiterhin wird die Bedeutung von Paratext und Vorwissen für die Lenkung der Rezeption in Richtung Fiktionalität und Faktualität beleuchtet.
- Analyse der narrativen Strukturen in „Rosa“
- Untersuchung des Verhältnisses von Fiktionalität und Faktualität
- Bedeutung des Paratextes für die Rezeption
- Die Rolle von Stimme und Erzählperspektive
- Der Versuch, die Schrecken des Holocaust literarisch zu erfassen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Leben und Werk von Thomas Harlan ein. Sie präsentiert den Autor als Sohn des NS-Regisseurs Veit Harlan und beschreibt Harlans eigene Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus und seine spätere Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit. Besondere Aufmerksamkeit wird auf Harlans kritische Auseinandersetzung mit der Nachkriegsjustiz und der Aufarbeitung der NS-Verbrechen gelegt. Der Abschnitt führt anschließend zu Harlans Werk „Rosa“ ein, indem der Fund der Akte Różalia Peham als Ausgangspunkt für die Entstehung des Werkes benannt wird. Die Einleitung legt den Grundstein für die anschließende Analyse, indem sie den Kontext des Werkes und die Motivation des Autors beleuchtet.
4. Zur Erzähl- und Fiktionstheorie: Dieses Kapitel liefert die theoretischen Grundlagen für die anschließende Textanalyse. Es definiert zentrale Begriffe wie Fiktionalität und Fiktivität und analysiert verschiedene Erzählperspektiven und deren Einfluss auf die Rezeption. Besonders wichtig ist die Erörterung von Fiktionssignalen, sowohl paratextueller (z.B. Titel, Untertitel, Vorwort) als auch textueller Art (z.B. sprachliche Stilmittel, Erzählstruktur), und deren Funktion, die Lesart des Textes zu beeinflussen. Diese theoretischen Überlegungen bilden das analytische Gerüst für die spätere Interpretation von „Rosa“.
5. Textanalyse Rosa: Dieses Kapitel bietet eine detaillierte Analyse von Harlans „Rosa“. Es untersucht den Paratext, die Geschichte von Rosa und Józef, die wiedergefundenen Akte, Richards Sanatoriumsaufenthalt, die Flora der Kulmhofer Blöße und Rosas Tod. Die Analyse beleuchtet die komplexe Verflechtung verschiedener Erzählstränge, Perspektiven und Stimmen, und wie diese die Ambivalenz zwischen Fiktion und Realität konstruieren. Die Kapitel analysieren die Interdependenzen der verschiedenen Erzählteile und die Wirkung des komplexen Textgeflechts. Der Fokus liegt auf der Ergründung der verschiedenen Ebenen des Erzählens und deren Funktion im Kontext des literarischen Versuchs, das Unergründliche des Holocaust darzustellen.
Schlüsselwörter
Thomas Harlan, Rosa, Fiktionalität, Fiktivität, Erzähltheorie, Modus, Stimme, Paratext, Holocaust, NS-Vergangenheit, Nachkriegsjustiz, Textanalyse, Narrative Strukturen.
Häufig gestellte Fragen zu Thomas Harlans "Rosa"
Was ist der Inhalt der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Verwendung von Fiktionalität und Fiktivität in Thomas Harlans Werk „Rosa“. Sie untersucht die narrativen Strukturen, den Einfluss von Paratext und Vorwissen auf die Rezeption, und beleuchtet das Verhältnis von Fiktionalität und Faktualität im Kontext des Holocaust.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der narrativen Strukturen in „Rosa“, die Untersuchung des Verhältnisses von Fiktionalität und Faktualität, die Bedeutung des Paratextes für die Rezeption, die Rolle von Stimme und Erzählperspektive, und den Versuch, die Schrecken des Holocaust literarisch zu erfassen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Erzähl- und Fiktionstheorie, eine detaillierte Textanalyse von "Rosa" und eine Zusammenfassung. Die Einleitung beschreibt Leben und Werk von Thomas Harlan und den Entstehungskontext von „Rosa“. Das Kapitel zur Erzähltheorie liefert die theoretischen Grundlagen. Die Textanalyse untersucht verschiedene Aspekte des Werkes, wie den Paratext, die Geschichte von Rosa und Józef, und den Umgang mit der Darstellung des Holocaust.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung stellt Thomas Harlan als Autor vor, beleuchtet seine Biografie im Kontext des Nationalsozialismus und seiner Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit und der Nachkriegsjustiz. Sie führt in das Werk „Rosa“ ein und beschreibt den Fund der Akte Różalia Peham als Ausgangspunkt.
Welche Aspekte der Erzähltheorie werden behandelt?
Das Kapitel zur Erzähltheorie definiert zentrale Begriffe wie Fiktionalität und Fiktivität. Es analysiert verschiedene Erzählperspektiven und den Einfluss von Fiktionssignalen (paratextuell und textuell) auf die Rezeption.
Wie wird die Textanalyse von "Rosa" durchgeführt?
Die Textanalyse untersucht detailliert verschiedene Aspekte von "Rosa", darunter den Paratext, die Geschichte von Rosa und Józef, die wiedergefundenen Akte, Richards Sanatoriumsaufenthalt, die Flora der Kulmhofer Blöße und Rosas Tod. Die Analyse beleuchtet die komplexe Verflechtung von Erzählsträngen, Perspektiven und Stimmen und deren Beitrag zur Konstruktion der Ambivalenz zwischen Fiktion und Realität.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Thomas Harlan, Rosa, Fiktionalität, Fiktivität, Erzähltheorie, Modus, Stimme, Paratext, Holocaust, NS-Vergangenheit, Nachkriegsjustiz, Textanalyse, Narrative Strukturen.
Wo finde ich eine detaillierte Übersicht der Kapitel?
Eine detaillierte Übersicht der Kapitel mit kurzen Zusammenfassungen findet sich im Inhaltsverzeichnis der Arbeit.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Leser, die sich für Thomas Harlan, die Literatur des Holocaust, Erzähltheorie und die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit interessieren. Sie ist insbesondere für akademische Zwecke geeignet.
- Citation du texte
- Johan Andersson (Auteur), 2020, Erzählen und Fiktionalität in Thomas Harlans "Rosa", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/900282