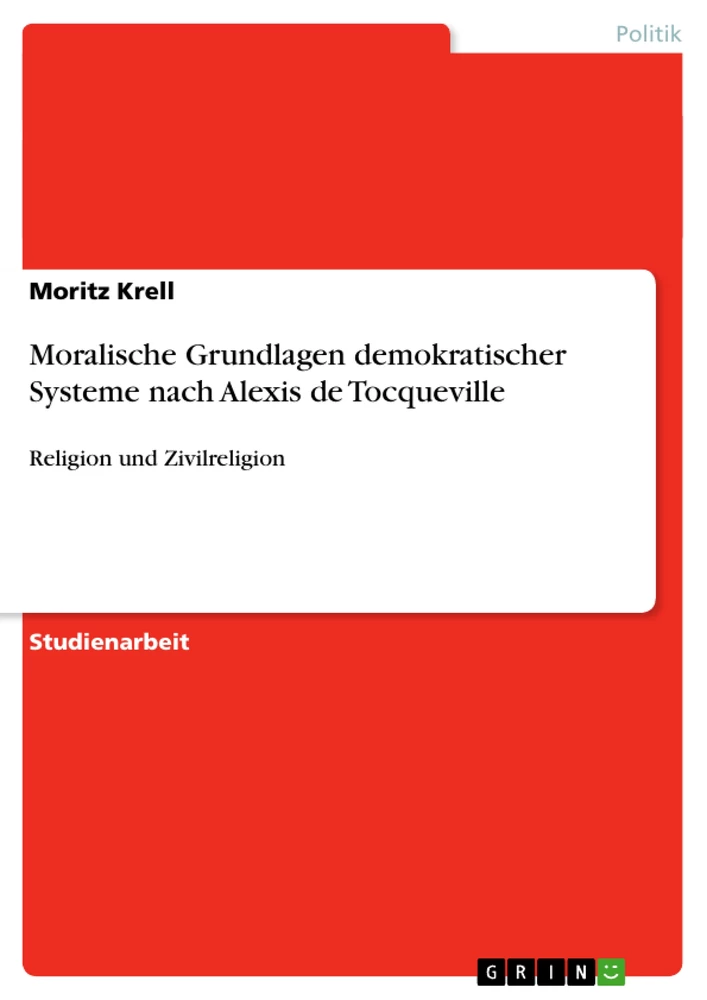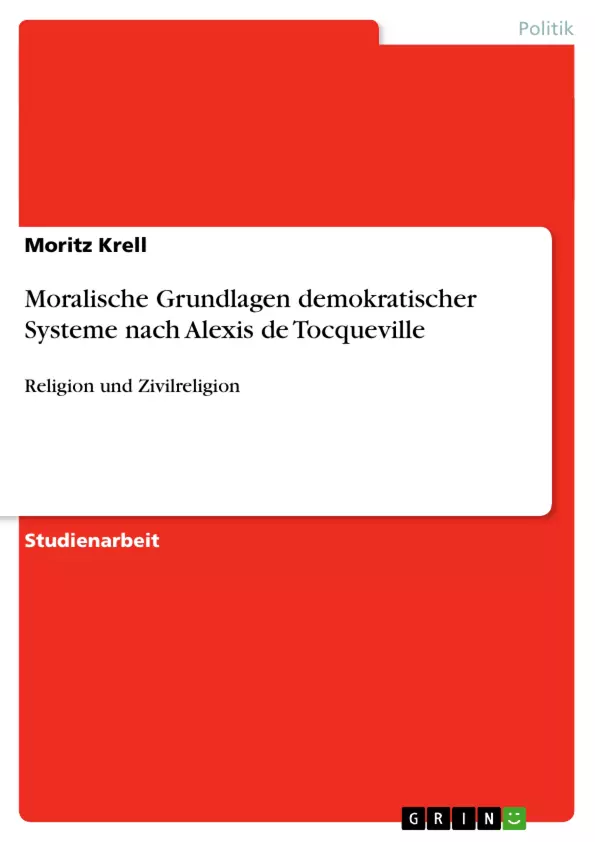Vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Verhältnis von Religion und demokratischem System. Damit knüpft sie an die zu Beginn des Seminars gemachte Themenerweiterung an, durch welche der Fokus nicht länger auf dem Verhältnis von Kirche und Staat im engeren Sinne sondern von Religion und demokratischem Staat lag.
Konkret wird im Folgenden eine theoretische Fragestellung verfolgt; nämlich die vom Verhältnis zwischen Religion und demokratischen Gesellschaftssystemen im Allgemeinen. (Der Einfachheit halber verwende ich im weiteren Verlauf den Begriff „Gesellschaft“ und meine damit eine demokratische Gesellschaft nach westlichem Vorbild; die genaue Institutionalisierung des demokratischen Prinzips ist für die weitere Argumentation von peripherer Bedeutung, weshalb diese Verallgemeinerung zulässig ist.)
Untersucht wird dabei, inwiefern die (transzendente) Religion als moralische Grundlage der Gesellschaft transzendentale Eigenschaften für das Funktionieren ebendieser besitzt. Somit ob es die Religion ist, welche die Subjekte mit grundlegenden Werten ausrüstet, die für ein geregeltes Ablaufen der institutionalisierten demokratischen Prinzipien Voraussetzung sind.
Dieser Ansatz führt dahin, eine zentrale Frage der politischen Theorie zu berücksichtigen. Nämlich die des Verhältnis' zwischen Freiheit und Gleichheit. Werden demokratische Gesellschaften als freie und gleiche Gesellschaften betrachtet, ist die Regelung des Spannungsverhältnis' beider bedeutsam für die genauere Ausprägung des demokratischen Systems. Exemplarisch seien die während des Kalten Krieges existierenden Blöcke genannt; der von den USA dominierte Westen proklamierte den Primat der Freiheit während die Sowjetunion die Gleichheit in den Mittelpunkt ihrer Ideologie stellte. Ich werde im Weiteren Verlauf zeigen, dass – wie so oft – ein ausgewogenes Maß der richtige Weg ist, also weder zu viel Freiheit noch zu viel Gleichheit für eine Gesellschaft positiv ist.
Auch Alexis de Tocqueville hat dieses Problem erkannt und sich ausführlich damit beschäftigt. Die von ihm genannte Prävention gegen einen Missbrauch der Gleichheit oder der Freiheit stellt nun die Religion dar. Eine sich selbst überlassene Demokratie, so sagt er, tendiert entweder in den Despotismus (als Form extremer Gleichheit) oder die Anarchie (als Form extremer Freiheit).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Tocqueville
- 1a) Freiheit und Gleichheit
- 1b) Die gefährdete Demokratie
- 1c) Die Rettung der Demokratie: Religion
- 2. Zivilreligion
- 2a) Allgemein
- 2b) Speziell: Hermann Lübbe
- 2c) Zusammenfassung
- 3. Demokratie und Moral
- 3a) Religion
- 3b) Zivilreligion
- 4. Zurück zu Tocqueville: Religion oder Zivilreligion?
- 5. Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Verhältnis von Religion und demokratischem System, wobei der Fokus auf der Frage liegt, ob die transzendente Religion als moralische Grundlage für das Funktionieren demokratischer Gesellschaften fungiert.
- Die Rolle der Religion als moralische Quelle der Demokratie
- Die Bedeutung von Freiheit und Gleichheit in demokratischen Gesellschaften
- Die Gefahr des Despotismus und der Anarchie in demokratischen Systemen
- Die Vorstellung von Zivilreligion als alternative moralische Grundlage
- Die Frage nach der Substituierbarkeit von Religion durch Zivilreligion
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Fragestellung nach dem Verhältnis von Religion und demokratischem System vor und definiert den Fokus auf die transzendente Religion als moralische Grundlage der Gesellschaft.
- 1. Tocqueville: Dieser Abschnitt beleuchtet Tocquevilles Analyse des Spannungsverhältnisses zwischen Freiheit und Gleichheit in demokratischen Gesellschaften und stellt seine These vor, dass Religion als moralische Quelle die Demokratie schützen kann.
- 2. Zivilreligion: Dieser Abschnitt präsentiert das Konzept der Zivilreligion und analysiert den Ansatz von Hermann Lübbe, der die Möglichkeit einer Zivilreligion als alternative moralische Grundlage diskutiert.
- 3. Demokratie und Moral: Dieser Abschnitt beleuchtet die Rolle von Religion und Zivilreligion als moralische Grundlagen der Demokratie und diskutiert deren jeweilige Auswirkungen auf das Funktionieren demokratischer Gesellschaften.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt zentrale Themen wie die Beziehung zwischen Religion und Demokratie, Freiheit und Gleichheit, die Gefahr des Despotismus und der Anarchie, das Konzept der Zivilreligion und die Rolle von Religion und Zivilreligion als moralische Grundlagen der Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt die Religion laut Tocqueville für die Demokratie?
Für Alexis de Tocqueville ist die Religion eine notwendige moralische Grundlage, die die Freiheit in einer Demokratie zügelt und verhindert, dass die Gesellschaft in Despotismus oder Anarchie abgleitet.
Wie stehen Freiheit und Gleichheit in einem Spannungsverhältnis?
Ein Übermaß an Gleichheit kann laut Tocqueville zur Unterdrückung der individuellen Freiheit führen (Despotismus), während absolute Freiheit ohne moralische Bindung in Instabilität (Anarchie) enden kann.
Was versteht man unter dem Konzept der Zivilreligion?
Zivilreligion bezeichnet ein System von gemeinsamen Werten und Symbolen einer Gesellschaft, die unabhängig von transzendenten Glaubensrichtungen eine einigende und moralisch stabilisierende Funktion übernehmen.
Kann Zivilreligion die traditionelle Religion ersetzen?
In der politischen Theorie wird debattiert, ob eine rein säkulare Zivilreligion die gleiche moralische Bindungskraft entfalten kann wie eine transzendente Religion, um das demokratische System langfristig zu stützen.
Warum sah Tocqueville die Demokratie als gefährdet an?
Er befürchtete, dass demokratische Gesellschaften durch Individualismus und das Streben nach materieller Gleichheit ihre Tugenden verlieren könnten, wenn sie nicht durch religiöse oder moralische Werte verankert sind.
- Quote paper
- Bachelor of Arts Moritz Krell (Author), 2007, Moralische Grundlagen demokratischer Systeme nach Alexis de Tocqueville, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/90081