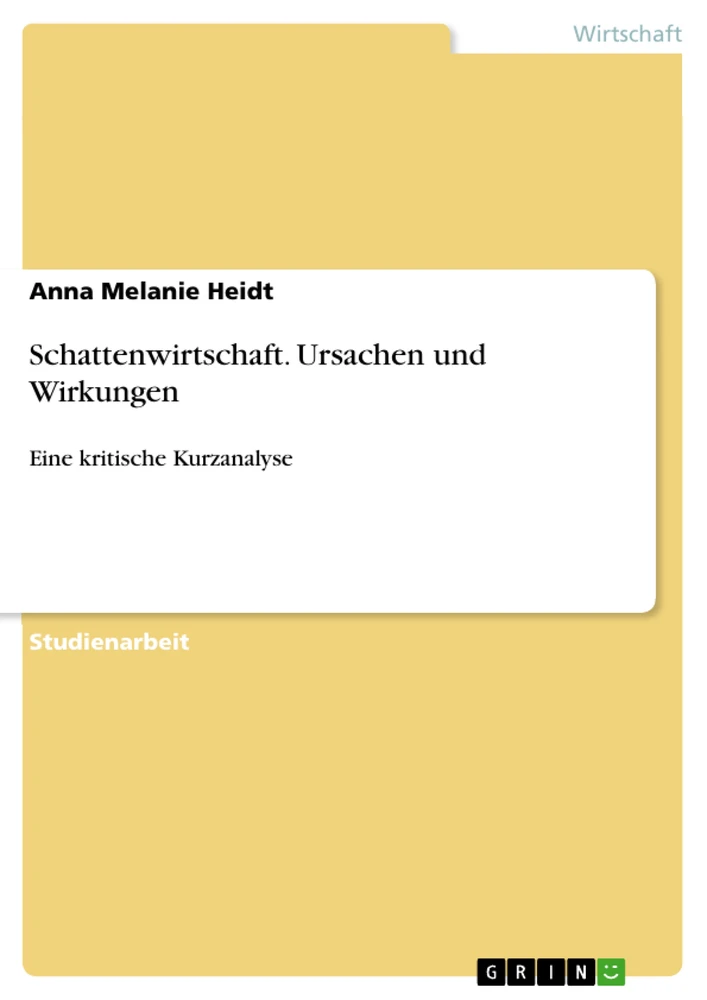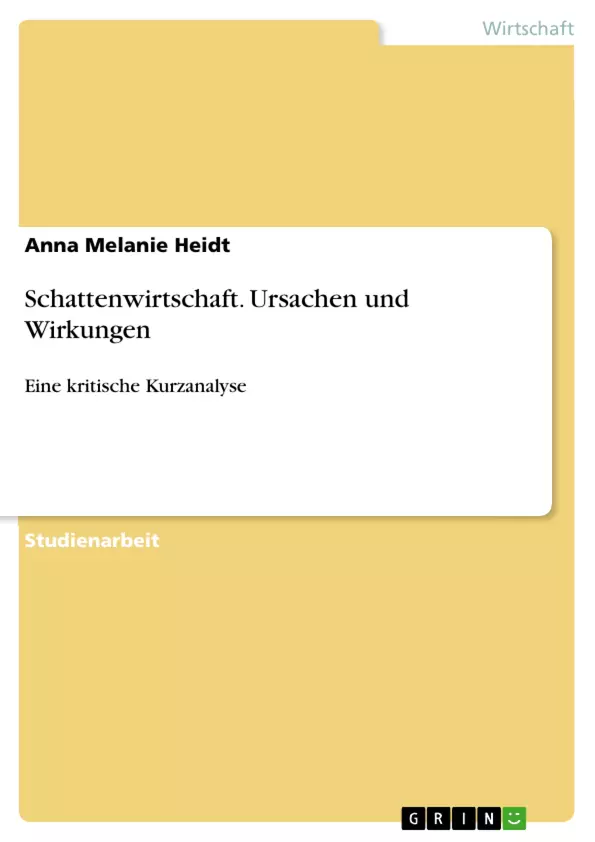Das Ziel dieser Arbeit ist, den Unterschied zwischen illegaler und legaler Schattenwirtschaft zu definieren, sowie auch ihre Ursachen als auch Auswirkungen zu analysieren. Anschließend wird die Schattenwirtschaft in Deutschland betrachtet und mit den OECD-Staaten verglichen und etwaige Lösungsansätze zu ihrer Einschränkung eruiert. Am Ende wird ein Schlussfazit gezogen, indem sowohl die Chancen und Risiken der Schattenwirtschaft erörtert werden.
Schattenwirtschaft ist ein Phänomen, welches die Wirtschafts- und Sozialpolitik schon seit vielen Jahren beschäftigt und durch ihren Anstieg auch häufig für Diskussionen sorgt. Zum einen, da sie eine Menge an wirtschaftspolitischen Problemen zu verantworten hat, wie beispielsweise die steigende Arbeitslosigkeit sowie die negativen Auswirkungen auf Sozialversicherungsträger und den Staat durch entgangene Einnahmen. Zum anderen, da sie oftmals moralisch und ethisch zweifelhafte Beschäftigungsverhältnisse mit sich bringt.
Doch was genau ist Schattenwirtschaft? Oftmals ist vielen selbst nicht bewusst, ab wann man sich bereits in der Schattenwirtschaft befindet und ab wann man sich noch im gesetzlichen Rahmen bewegt, weswegen dies häufig zu Verunsicherungen führt. Beispielsweise bei einem Kuchenverkauf für Vereine oder Schulklassen. Wie häufig darf ein solcher veranstaltet werden, um noch gesetzeskonform zu sein und ab wann befindet man sich bereits in einer juristischen Grauzone?
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Problematik
- Zielsetzung
- Theoretische Grundlagen
- Rechtliche Grundlagen
- Illegale Schattenwirtschaft
- Legale Schattenwirtschaft
- Ursachen und Wirkung
- Beweggründe für die Schattenwirtschaft und Schwarzarbeit
- Auswirkungen auf die Gesellschaft, den Staat und die Wirtschaft
- Schattenwirtschaft im Vergleich
- Schattenwirtschaft in Deutschland
- Schattenwirtschaft in den OECD-Staaten
- Rechtliche Grundlagen
- Fazitärer Ausblick
- Lösungsansätze
- Mehr Kontrollen
- Strengere Gesetze
- Abschaffung des Bargelds
- Schlussfazit
- Risiken der Schattenwirtschaft
- Chancen der Schattenwirtschaft
- Lösungsansätze
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert die Schattenwirtschaft, indem sie den Unterschied zwischen legaler und illegaler Schattenwirtschaft definiert und deren Ursachen und Auswirkungen untersucht. Die Arbeit betrachtet die Schattenwirtschaft in Deutschland im Vergleich zu OECD-Staaten und erörtert mögliche Lösungsansätze zur Eindämmung. Abschließend werden Chancen und Risiken der Schattenwirtschaft zusammengefasst.
- Definition und Abgrenzung von legaler und illegaler Schattenwirtschaft
- Analyse der Ursachen für Schattenwirtschaft (z.B. hohe Steuern, bürokratische Hürden)
- Bewertung der Auswirkungen auf Wirtschaft, Staat und Gesellschaft
- Internationaler Vergleich der Schattenwirtschaft (Deutschland vs. OECD-Staaten)
- Diskussion möglicher Lösungsansätze
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung: Die Arbeit beginnt mit der Darstellung der Problematik der Schattenwirtschaft anhand aktueller Beispiele, wie z.B. aufgedeckter Schwarzarbeit auf einem Weihnachtsmarkt. Sie hebt die wirtschaftlichen und sozialen Probleme hervor, die durch die Schattenwirtschaft entstehen, wie z.B. steigende Arbeitslosigkeit und entgangene Steuereinnahmen. Es wird der Fokus auf die moralisch und ethisch bedenklichen Aspekte von Beschäftigungsverhältnissen in der Schattenwirtschaft gelegt und die Bedeutung der Thematik im Bausektor angesprochen, der von kriminellen Netzwerken geprägt ist.
Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für das Verständnis der Schattenwirtschaft. Es werden die rechtlichen Grundlagen der illegalen und legalen Schattenwirtschaft differenziert dargestellt, die Beweggründe für die Teilnahme an der Schattenwirtschaft (z.B. Steuervermeidung, Umgehung von Sozialabgaben) und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft, den Staat und die Wirtschaft erläutert. Ein Vergleich der Schattenwirtschaft in Deutschland mit der in anderen OECD-Staaten wird durchgeführt.
Fazitärer Ausblick: Das Kapitel fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und diskutiert verschiedene Lösungsansätze zur Bekämpfung der Schattenwirtschaft, wie z.B. verstärkte Kontrollen, strengere Gesetze und die Abschaffung des Bargelds. Abschließend werden die Chancen und Risiken der Schattenwirtschaft gegeneinander abgewogen. Die Risiken konzentrieren sich auf den Verlust von Steuereinnahmen und die Gefährdung des Sozialsystems, während die Chancen eher in einer erhöhten wirtschaftlichen Aktivität liegen, die jedoch auf Kosten der Fairness und des Rechtsstaats erzielt wird.
Schlüsselwörter
Schattenwirtschaft, Schwarzarbeit, illegale Wirtschaft, legale Schattenwirtschaft, Steuerhinterziehung, Sozialabgaben, OECD-Staaten, Deutschland, Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik, Lösungsansätze, Risiken, Chancen.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Schattenwirtschaft
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit analysiert die Schattenwirtschaft, differenziert zwischen legaler und illegaler Schattenwirtschaft, untersucht deren Ursachen und Auswirkungen und erörtert mögliche Lösungsansätze. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der Schattenwirtschaft in Deutschland mit anderen OECD-Staaten.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Abgrenzung von legaler und illegaler Schattenwirtschaft; Analyse der Ursachen (z.B. hohe Steuern, bürokratische Hürden); Bewertung der Auswirkungen auf Wirtschaft, Staat und Gesellschaft; Internationaler Vergleich (Deutschland vs. OECD-Staaten); Diskussion möglicher Lösungsansätze (z.B. verstärkte Kontrollen, strengere Gesetze, Abschaffung des Bargelds); Chancen und Risiken der Schattenwirtschaft.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einführung, einen Teil mit theoretischen Grundlagen, einen abschließenden Ausblick mit Lösungsansätzen und einem Fazit, sowie eine Zusammenfassung. Die theoretischen Grundlagen umfassen rechtliche Grundlagen, Ursachen und Wirkungen der Schattenwirtschaft und einen internationalen Vergleich. Der Ausblick beinhaltet Lösungsansätze und eine Abwägung von Chancen und Risiken.
Welche konkreten Beispiele werden in der Einführung genannt?
Die Einführung nennt als Beispiel aufgedeckte Schwarzarbeit auf einem Weihnachtsmarkt, um die Problematik der Schattenwirtschaft zu veranschaulichen. Sie hebt die wirtschaftlichen und sozialen Probleme hervor (z.B. steigende Arbeitslosigkeit und entgangene Steuereinnahmen) und betont die moralisch und ethisch bedenklichen Aspekte, insbesondere im Bausektor.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse der theoretischen Grundlagen?
Die theoretischen Grundlagen differenzieren zwischen legaler und illegaler Schattenwirtschaft, erläutern die Beweggründe für die Teilnahme an der Schattenwirtschaft (z.B. Steuervermeidung, Umgehung von Sozialabgaben) und deren Auswirkungen. Ein Vergleich der Schattenwirtschaft in Deutschland mit anderen OECD-Staaten wird vorgestellt.
Welche Lösungsansätze werden im Fazit diskutiert?
Im Fazit werden verschiedene Lösungsansätze zur Bekämpfung der Schattenwirtschaft diskutiert, darunter verstärkte Kontrollen, strengere Gesetze und die Abschaffung des Bargelds. Die Chancen und Risiken der Schattenwirtschaft (Verlust von Steuereinnahmen vs. erhöhte wirtschaftliche Aktivität) werden gegeneinander abgewogen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Seminararbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Schattenwirtschaft, Schwarzarbeit, illegale Wirtschaft, legale Schattenwirtschaft, Steuerhinterziehung, Sozialabgaben, OECD-Staaten, Deutschland, Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik, Lösungsansätze, Risiken, Chancen.
Für wen ist diese Seminararbeit relevant?
Diese Seminararbeit ist für alle relevant, die sich mit den Themen Schattenwirtschaft, Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik auseinandersetzen, insbesondere für Studierende, Wissenschaftler und Personen, die sich für die ökonomischen und gesellschaftlichen Auswirkungen der Schattenwirtschaft interessieren.
- Citation du texte
- Anna Melanie Heidt (Auteur), 2020, Schattenwirtschaft. Ursachen und Wirkungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/901545