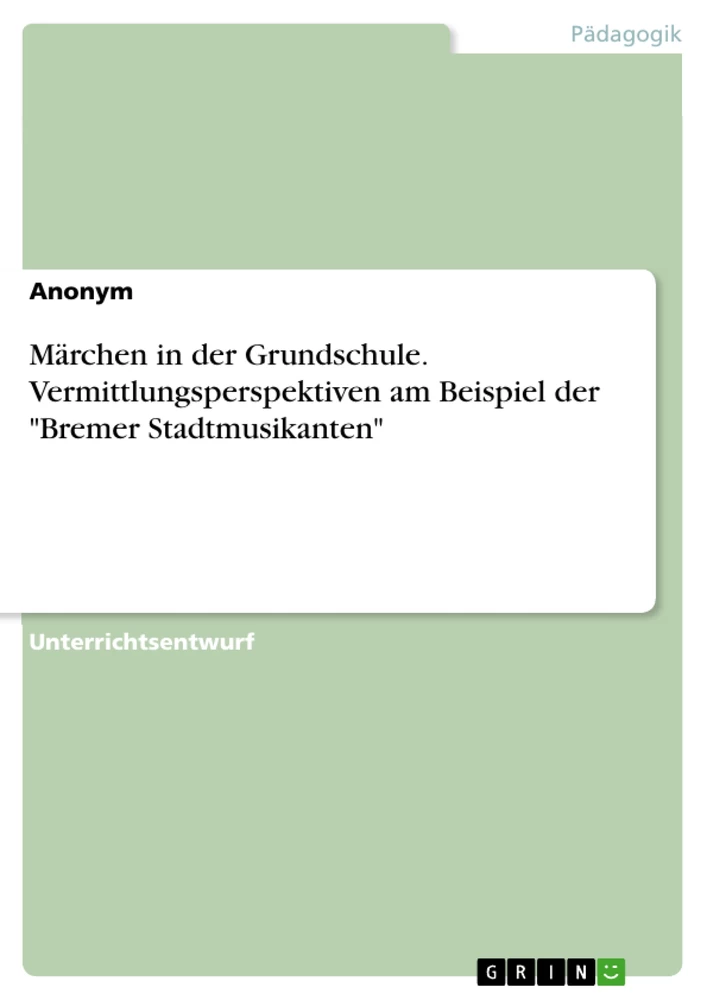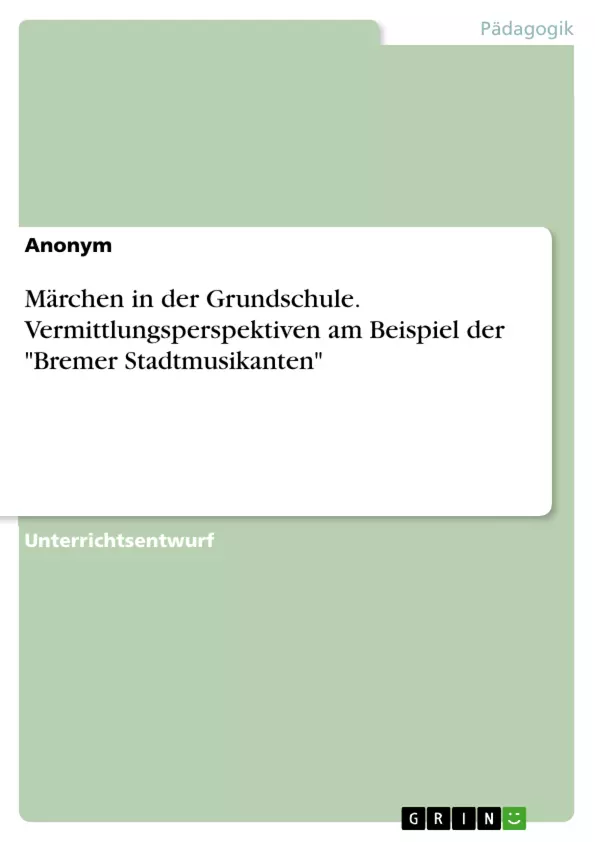In dieser Arbeit sollen die Vermittlungsperspektiven von Märchen in der Grundschule untersucht werden. Als Beispielmärchen für die Ausarbeitung ist das Märchen der „Bremer Stadtmusikanten“ gewählt worden.
Das Konzept gliedert sich in fünf Teile. Der erste besteht aus der Einleitung und einen kurzen Einblick in den Forschungsstand, welcher für die weiteren Ausführungen relevant erscheint. Im zweiten Teil wird auf der Basis dieser Forschungsliteratur der theoretische Hintergrund beleuchtet. Dabei soll die Literaturgattung der Märchen umrissen, sowie wichtige Strukturen und Kennzeichen deutlich gemacht werden. Anschließend wird in diesem Teil noch ein Blick auf die Gebrüder Grimm und das Beispielmärchen geworfen. Der sich anschließende dritte Teil des Vermittlungskonzepts beschäftigt sich mit der Planung des Unterrichtskonzepts und erläutert hierbei die Lernvorrausetzungen, die Einbindung der Konzeption in den Lehrplan, sowie Differenzierungsmöglichkeiten. Im vierten Teil wird dann anhand der „Bremer Stadtmusikanten“ eine konkrete Unterrichtsreihe mit einer ausgearbeiteten Stunde dargestellt. Im abschließenden Fazit, dem fünften Teil, wird resümiert, wie Märchen, im Besonderen das Beispielmärchen, in der Grundschule vermittelt werden können und welche genauen Kompetenzen die SchülerInnen hierbei erlangen können.
Insgesamt soll in diesem Vermittlungskonzept verdeutlicht werden, welche Lernchancen Märchen in der Grundschule bieten und wie diese den SchülerInnen nahegebracht werden können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsstand
- Theoretischer Hintergrund
- Märchen - eine Gattungsdefinition
- Merkmale von Volksmärchen
- Die Gebrüder Grimm
- Die Bremer Stadtmusikanten
- Planung des Unterrichtskonzepts
- Lernvoraussetzungen und Rahmenbedingungen
- Begründung des Lerngegenstandes
- Einbindung der Unterrichtskonzeption in den Lehrplan
- Differenzierungsmöglichkeiten
- Vermittlung anhand einer konkreten Unterrichtsskizze
- Thema und Ziel der Unterrichtsreihe
- Aufbau der Reihe
- Didaktischer Schwerpunkt der geplanten Stunde
- Lernziele der Unterrichtsstunde
- Verlaufsplan der Unterrichtsstunde
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Vermittlungskonzept analysiert die Vermittlungsperspektiven von Märchen in der Grundschule anhand des Beispielmärchens „Die Bremer Stadtmusikanten“. Das Konzept untersucht den Forschungsstand, den theoretischen Hintergrund, die Planung einer Unterrichtsreihe und die konkrete Gestaltung einer Unterrichtsstunde.
- Die Merkmale und Strukturen von Volksmärchen
- Die Bedeutung der Gebrüder Grimm für die Märchensammlung und -forschung
- Die Planung einer Unterrichtsreihe zum Thema Märchen in der Grundschule
- Die Entwicklung und Durchführung einer konkreten Unterrichtsstunde
- Die Lernchancen, die Märchen für Grundschüler bieten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Märchenvermittlung in der Grundschule ein und gibt einen kurzen Überblick über den Forschungsstand. Das zweite Kapitel befasst sich mit dem theoretischen Hintergrund von Märchen, definiert die Gattungsmerkmale und beleuchtet die Besonderheiten von Volksmärchen. Außerdem werden die Gebrüder Grimm und das Beispielmärchen „Die Bremer Stadtmusikanten“ vorgestellt.
Kapitel 3 widmet sich der Planung des Unterrichtskonzepts, indem es die Lernvoraussetzungen, die Einbindung der Konzeption in den Lehrplan und die Differenzierungsmöglichkeiten beleuchtet. Im vierten Kapitel wird eine konkrete Unterrichtsreihe anhand des Beispielmärchens „Die Bremer Stadtmusikanten“ mit einer ausgearbeiteten Unterrichtsstunde dargestellt.
Schlüsselwörter
Märchen, Volksmärchen, Gebrüder Grimm, „Die Bremer Stadtmusikanten“, Unterrichtskonzept, Grundschule, Vermittlungsperspektiven, Lernchancen, Lernziele, Didaktik, Phantasie, Kinderliteratur.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2018, Märchen in der Grundschule. Vermittlungsperspektiven am Beispiel der "Bremer Stadtmusikanten", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/901592