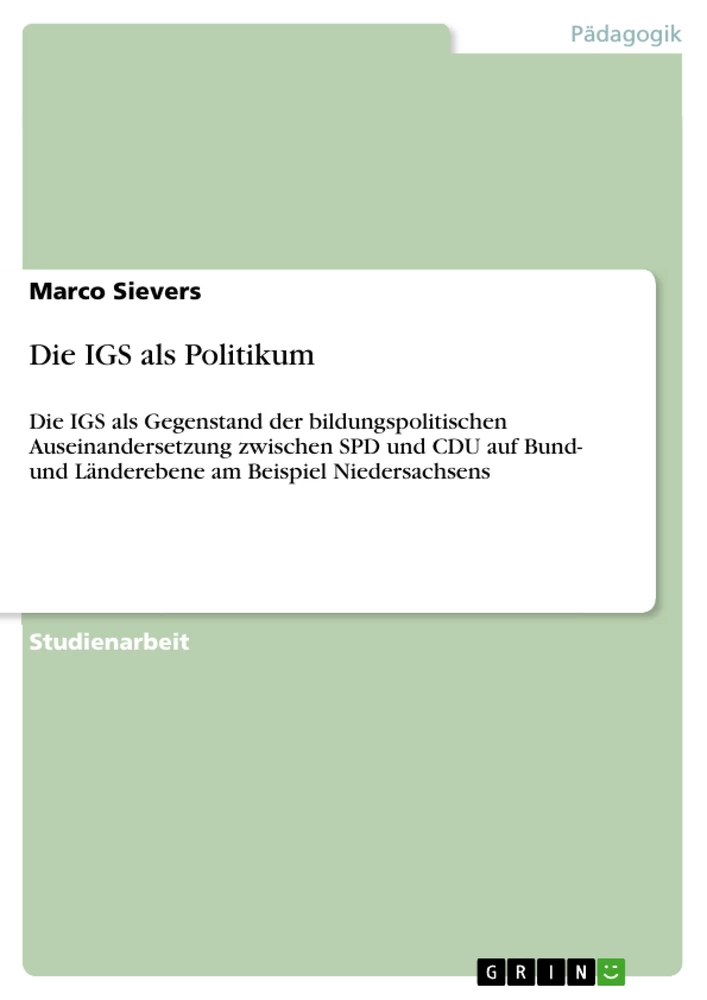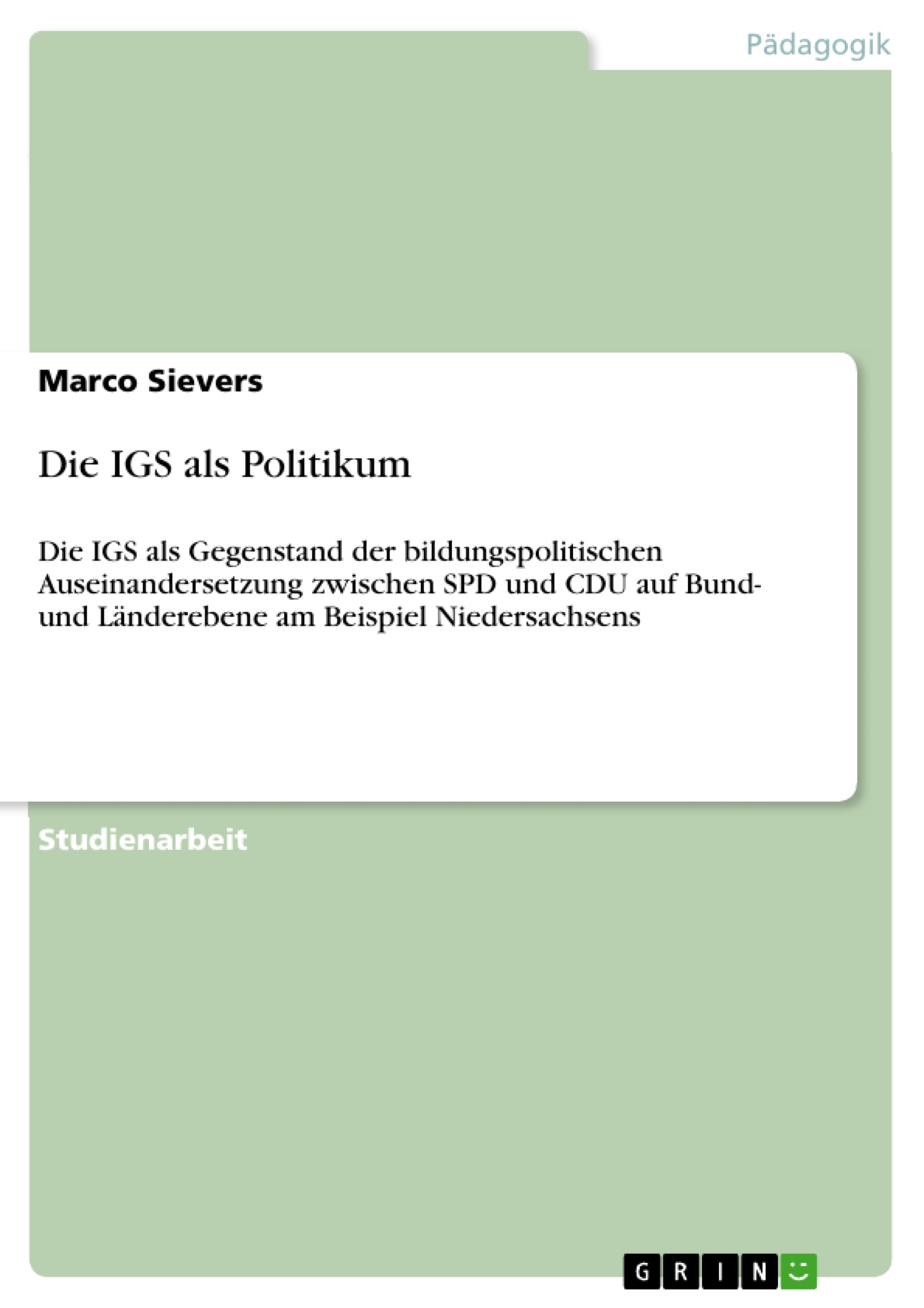Seit mehr als 35 Jahren existieren Integrierte Gesamtschulen in der bundesdeutschen Schullandschaft und sind für eine Vielzahl von SuS, Eltern, Lehrern und anderen bildungspolitisch interessierten Bürgern nicht mehr wegzudenken. Dennoch war die Einrichtung und Entwicklung dieser Schulform ein steiniger, umkämpfter Weg, der von Auseinandersetzungen zwischen den großen Volksparteien CDU und SPD geprägt wurde. Ziel der vorliegenden Abhandlung ist es, diese Kontroversen nachzuzeichnen. Dafür wird zunächst die Entwicklung der Gesamtschulen in der BRD dargestellt, um dann anhand der Schulgesetzgebung in Niedersachsen die politischen Auseinandersetzungen auf der Landesebene zu betrachten. Die Gesamtschule hat ideengeschichtlich eine lange Tradition, die sich bis ins 17. Jahrhundert zurückverfolgen lässt. Obwohl die Vorstellung einer Einheitsschule im Zuge der Reformpädagogik im ersten Drittel des 20.Jahrhunderts schon große Wirksamkeit erlangte, setzte die eigentliche Einrichtung von Gesamtschulen erst ab Anfang der 1970ziger Jahre ein und wurde zu einem heiß diskutierten Politikum.
Angestoßen durch die bildungspolitischen Schriften von Georg Picht zur „Bildungskatastrophe“ und Ralf Dahrendorf zur „Bildung als Bürgerrecht“, kam Ende der sechziger Jahre des letzten Jahrhunderts eine starke Kritik am dreigliedrigen Schulwesen der BRD auf und führte zu vielfältigen Reformdiskussionen. Der 1965 gegründete Deutsche Bildungsrat sprach sich daraufhin in seiner Empfehlung zur Einrichtung von Schulversuchen mit Gesamtschulen von 1969 dafür aus, probeweise Gesamtschulen einzuführen, die den überkommenen, konventionellen Schulformen als „neue, wesentlich systemfremde Erscheinung“ gegenüberstehen und diese letztendlich überwinden sollten. Dabei orientierte er sich an den US-amerikanischen High Schools, der neuen Comprehensive School in England und an der reformierten neunjährigen schwedischen Gesamtschule. Auf Basis dieser Empfehlung wurden bundesweit zunächst 40 Gesamtschulen als Versuchsschulen eingerichtet, sowohl in der Form der Integrierten Gesamtschule (IGS) als auch der Kooperativen Gesamtschule (KGS).
Der Bildungsrat verfolgte eine Reihe von Zielen. Zunächst sollte die Schulausbildung reformiert werden, um allen SuS bis zum Ende der Sekundarstufe I eine zeitgemäße, wissenschaftsorientierte Grundbildung zu vermitteln und um bessere Voraussetzungen für die Ausbildung qualifizierter Arbeitskräfte zu schaffen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Gesamtschulen als bundesweit bildungspolitische Kontroverse
- Stellung und Struktur der IGS in Niedersachsen
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, die Kontroversen um die Einführung und Entwicklung von Integrierten Gesamtschulen (IGS) in Deutschland nachzuzeichnen. Im Fokus steht dabei die Auseinandersetzung zwischen der SPD und der CDU auf Bundes- und Landesebene, insbesondere am Beispiel Niedersachsens.
- Die Entwicklung der Gesamtschulen in der Bundesrepublik Deutschland
- Die bildungspolitischen Zielsetzungen der Gesamtschulreform
- Die Kritik an der Gesamtschule aus konservativer Sicht
- Die Positionen der SPD und CDU in der Gesamtschuldebatte
- Die Rolle der Landesebene, am Beispiel Niedersachsens
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Relevanz der Gesamtschule als bildungspolitisches Thema dar und skizziert die Zielsetzung der Arbeit.
Die Gesamtschulen als bundesweit bildungspolitische Kontroverse
Dieses Kapitel beleuchtet die historischen Wurzeln der Gesamtschulbewegung und die Entstehung der Kontroversen um diese Schulform im Zusammenhang mit der „Bildungskatastrophe“ und der Forderung nach „Bildung als Bürgerrecht“. Es beschreibt die Einführung von Gesamtschulen als Versuchsschulen und die Zielsetzung des Deutschen Bildungsrates, die Chancengleichheit fördern und eine individualisierte Begabungsförderung ermöglichen sollte.
Stellung und Struktur der IGS in Niedersachsen
Dieses Kapitel wird sich mit der Position und Struktur der IGS in Niedersachsen befassen. Es wird die konkrete Umsetzung der Gesamtschuldebatte auf Landesebene sowie die spezifischen Herausforderungen und Chancen der IGS in Niedersachsen beleuchten.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Arbeit sind: Integrierte Gesamtschule, Gesamtschulreform, Bildungskatastrophe, Chancengleichheit, soziale Integration, Leistungsdifferenzierung, SPD, CDU, Niedersachsens, Bildungspolitik.
Häufig gestellte Fragen
Warum gilt die IGS als „Politikum“?
Die Einführung der Integrierten Gesamtschule war ein umkämpfter Weg, geprägt von ideologischen Auseinandersetzungen zwischen CDU und SPD.
Was löste die Bildungsreformdebatte Ende der 60er Jahre aus?
Schriften von Georg Picht („Bildungskatastrophe“) und Ralf Dahrendorf („Bildung als Bürgerrecht“) übten starke Kritik am dreigliedrigen Schulsystem.
Welche Ziele verfolgte der Deutsche Bildungsrat mit der Gesamtschule?
Ziel war eine zeitgemäße Grundbildung für alle Schüler, die Förderung der Chancengleichheit und die Überwindung systemfremder Barrieren.
Was ist der Unterschied zwischen IGS und KGS?
Die IGS integriert alle Bildungsgänge vollständig, während die Kooperative Gesamtschule (KGS) die Schulformen unter einem Dach organisatorisch verbindet.
Welche Rolle spielt Niedersachsen in dieser Analyse?
Anhand der niedersächsischen Schulgesetzgebung werden die politischen Auseinandersetzungen auf Landesebene exemplarisch nachgezeichnet.
- Arbeit zitieren
- Dipl.Jurist Marco Sievers (Autor:in), 2007, Die IGS als Politikum, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/90234