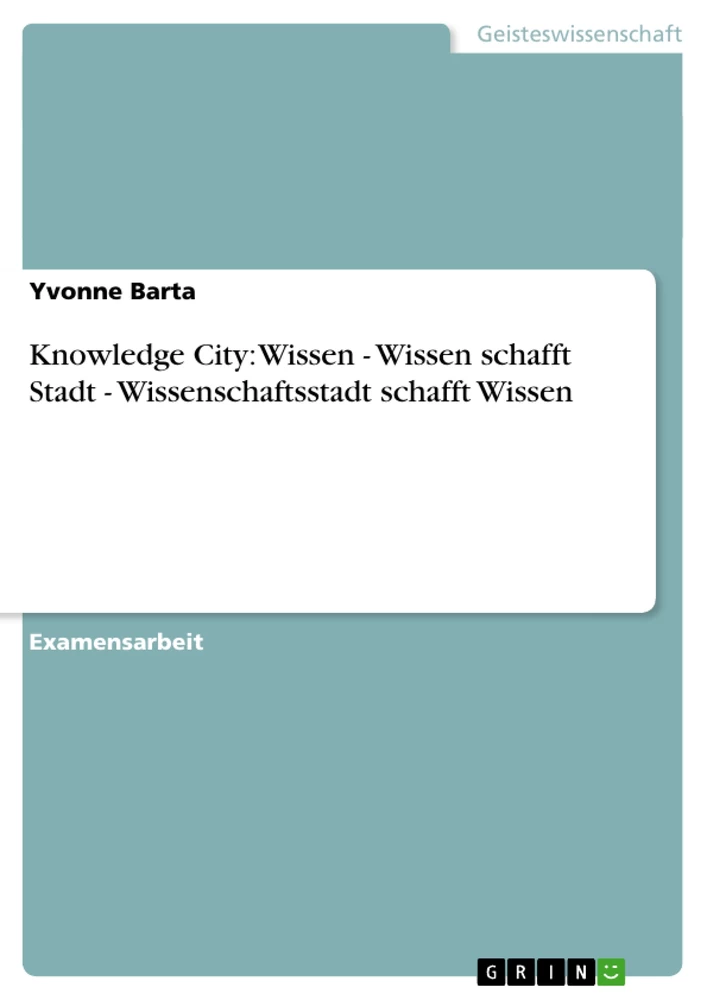Die deutschen Städte haben im letzten Jahrhundert mit zahlreichen Prob-lemen zu kämpfen. Im Laufe der Zeit wandelt sich unsere Gesellschaft zu einer Informations- und Wissensgesellschaft. Das Internet sowie moderne Telekommunikation halten Einzug in den privaten und wirtschaftlichen Bereich. Neue Kommunikationstechnologien lassen räumliche Entfernungen bedeutungslos werden. Dies gilt insbesondere für den Trend zur Projektarbeit, die immer wieder die Zusammenstellung neuer Teams erfordert. Dabei ist es vor allem die Internationalität der Wissensträger, welche die Innovation und Invention innerhalb eines Projektes begünstigt. Soziale Netzwerke wach-sen und dehnen sich über nationale Grenzen hinweg aus. Die Akteure der Wissensgesellschaft werden fortwährend mit einer Flut von Informationen konfrontiert. Diese gilt es zu verarbeiten und zu syste-matisieren, um sie anschließend ökonomisch verwertbar zu machen. Wissensinstitute nutzen die Chance, die sich aus der globalen Kommunika-tion und der Verfügbarkeit von Wissenspotentialen ergeben, um Forschung und Entwicklung voranzutreiben und sich dem internationalen Wettbewerb zu stellen. Sie sind Anziehungspunkt für nationale und internationale Wissensträger und Brutstätte für die Entstehung und Ansiedlung innovati-ver Unternehmen. Städte, die dieses Potential erkannt haben, schaffen Anreize, um diese Entwicklung zu stärken und die Entstehung von Wissensmilieus zu fördern. Ziel ist es, die gesellschaftliche Wohlfahrt zu maximieren und als Wissens-standort nationale sowie internationale Wettbewerbsvorteile zu erlangen. Metropolen, wie z.B. Berlin und München, ist es gelungen, durch urbane sowie suburbane Agglomerationen wissensintensiver Institutionen und das Vorhandensein von Wissensmilieus zur „Knowledge City“ aufzusteigen.
Diese Arbeit bietet dem Leser theoretische Grundlagen zum Begriff des Wissens, zur heutigen Wissensgesellschaft und zur Entwicklung von Wissensinstitutionen.
Die Bedeutung dieser theoretischen Grundlagen für die Stadt beeinflusst die wissensbasierten Stadtentwicklungsstrategien. Im Zuge der Vorstellung urbaner, standortspezifischer und politische Handlungspotentiale und der resultierenden Vorteile wird der Weg zur Knowledge City charakterisiert. Durch einen abschließenden Vergleich zweier ausgewählter Städte werden Wettbewerbsvorteile der Knowledge City gegenüber anderen Städten evident.
Inhaltsverzeichnis
- I ABSTRACT
- II SUMMARY
- III INHALTSVERZEICHNIS
- IV ABBILDUNGSVERZEICHNIS
- V TABELLENVERZEICHNIS
- VI ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
- 1 EINLEITUNG
- 2 KNOWLEDGE CITY ± HIER SCHAFFT WISSEN STADT
- 3 KNOWLEDGE ± WISSEN IM ZEITLICHEN WANDEL
- 3.1 DIE ROLLE DER UNIVERSITÄTEN
- 3.2 DIE ROLLE DER AKADEMIEN
- 3.3 DIE ROLLE DER WISSENSCHAFT UND WISSENSCHAFTLER
- 3.4 WISSEN, LEHRE, FORSCHUNG UND STAAT
- 3.5 WISSENSGESELLSCHAFT
- 3.6 WISSENSMILIEUS
- 3.7 BEDEUTUNG DES WISSENS FÜR KNOWLEDGE CITIES
- 4 CITY ± DIE STADT IM ZEITLICHEN WANDEL DER WISSENSGESELLSCHAFT
- 4.1 URBANE HANDLUNGSPOTENTIALE DER STADT
- 4.2 STANDORTSPEZIFISCHE HANDLUNGSPOTENTIALE
- 4.3 POLITISCHE HANDLUNGSPOTENTIALE
- 5 DER STÄDTEVERGLEICH
- 5.1 JENA ± HISTORIE
- 5.2 FRANKFURT (ODER) ± HISTORIE
- 5.3 VERGLEICHS-BILANZ
- 5.4 ERGEBNIS
- 6 RÉSUMÉ
- VII ANHANG
- VIII QUELLENVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung von Wissen für die Entwicklung von Städten im Kontext der Wissensgesellschaft. Sie analysiert den Begriff "Knowledge City", untersucht die Rolle von Universitäten, Forschungseinrichtungen und Wissensmilieus, und vergleicht zwei deutsche Städte hinsichtlich ihrer Strategien zur Wissensstadtentwicklung.
- Der Begriff "Knowledge City" und seine verschiedenen Interpretationen
- Die Rolle von Wissen in verschiedenen Gesellschaftsepochen
- Die Bedeutung von Wissensmilieus für die Stadtentwicklung
- Der Vergleich von Stadtentwicklungsstrategien verschiedener Städte
- Die Bedeutung von Politik und Planung für die Entwicklung von Knowledge Cities
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Diese Einleitung führt in die Thematik der Knowledge City ein und gibt einen Überblick über die Struktur der Arbeit. Sie stellt die zentralen Fragen nach der Definition und den Herausforderungen der Wissensstadtentwicklung.
2 Knowledge City ± Hier schafft Wissen Stadt: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Knowledge City" und untersucht seine Entwicklung im Kontext der Globalisierung und der Wissensgesellschaft. Es beleuchtet die Herausforderungen kleinerer Städte im Wettbewerb mit Metropolen und die Rolle von Initiativen wie "Stadt der Wissenschaft".
3 Knowledge ± Wissen im zeitlichen Wandel: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung des Wissensbegriffs über verschiedene Epochen hinweg, von der Agrargesellschaft bis zur Wissensgesellschaft. Es analysiert die Rolle von Universitäten, Akademien und Wissenschaftlern in der Wissensgenerierung und -verbreitung. Es beschreibt die Entstehung von Wissensmilieus und deren Bedeutung für Knowledge Cities. Es werden die Unterschiede zwischen implizitem und explizitem Wissen herausgearbeitet, sowie die verschiedenen Wissenstypen nach Matthiesen erklärt.
4 City ± Die Stadt im zeitlichen Wandel der Wissensgesellschaft: Dieses Kapitel diskutiert die Bedeutung von Wissensmilieus für die Stadtentwicklung in der Wissensgesellschaft. Es werden urbane, standortspezifische und politische Handlungspotentiale vorgestellt, die den Weg zur Knowledge City ebnen können. Es werden verschiedene Modelle der Stadtentwicklung, wie die Theorie der Kreativen Klasse und Agglomerationseffekte nach Marshall, analysiert. Der Einfluss verschiedener Standorttypen von Hochschulen auf die Stadtentwicklung wird untersucht.
5 Der Städtevergleich: Dieses Kapitel vergleicht die Städte Jena und Frankfurt (Oder) anhand der Kriterien des Wettbewerbs "Stadt der Wissenschaft". Es analysiert die historischen Entwicklungen, die Stärken und Schwächen beider Städte, und zieht Schlussfolgerungen über erfolgreiche Strategien der Wissensstadtentwicklung.
Schlüsselwörter
Knowledge City, Wissensgesellschaft, Wissensmilieus, Stadtentwicklung, Wissenschaft, Forschung, Innovation, Universitäten, Agglomerationseffekte, Wettbewerbsfähigkeit, Stadt der Wissenschaft, Jena, Frankfurt (Oder), Humankapital, Spillover-Effekte, Politische Handlungspotentiale.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Knowledge City – Wissensstadtentwicklung im Vergleich
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung von Wissen für die Entwicklung von Städten im Kontext der Wissensgesellschaft. Sie analysiert den Begriff "Knowledge City", untersucht die Rolle von Universitäten, Forschungseinrichtungen und Wissensmilieus und vergleicht zwei deutsche Städte (Jena und Frankfurt (Oder)) hinsichtlich ihrer Strategien zur Wissensstadtentwicklung.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: den Begriff "Knowledge City" und seine verschiedenen Interpretationen; die Rolle von Wissen in verschiedenen Gesellschaftsepochen; die Bedeutung von Wissensmilieus für die Stadtentwicklung; den Vergleich von Stadtentwicklungsstrategien verschiedener Städte; die Bedeutung von Politik und Planung für die Entwicklung von Knowledge Cities; die Rolle von Universitäten und Akademien; die Herausforderungen kleinerer Städte im Wettbewerb mit Metropolen; verschiedene Modelle der Stadtentwicklung (z.B. Theorie der Kreativen Klasse, Agglomerationseffekte); die Analyse von implizitem und explizitem Wissen und verschiedenen Wissenstypen nach Matthiesen; und den Einfluss verschiedener Standorttypen von Hochschulen auf die Stadtentwicklung.
Welche Städte werden im Städtevergleich untersucht?
Die Arbeit vergleicht die Städte Jena und Frankfurt (Oder) anhand von Kriterien des Wettbewerbs "Stadt der Wissenschaft". Der Vergleich analysiert historische Entwicklungen, Stärken und Schwächen beider Städte und zieht Schlussfolgerungen über erfolgreiche Strategien der Wissensstadtentwicklung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Knowledge City – Definition und Herausforderungen, Wissen im zeitlichen Wandel (inkl. Rolle von Universitäten, Akademien und Wissensmilieus), Die Stadt im zeitlichen Wandel der Wissensgesellschaft (inkl. urbaner, standortspezifischer und politischer Handlungspotentiale), Der Städtevergleich (Jena und Frankfurt (Oder)), Résumé, Anhang und Quellenverzeichnis.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Arbeit wichtig?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Knowledge City, Wissensgesellschaft, Wissensmilieus, Stadtentwicklung, Wissenschaft, Forschung, Innovation, Universitäten, Agglomerationseffekte, Wettbewerbsfähigkeit, Stadt der Wissenschaft, Jena, Frankfurt (Oder), Humankapital, Spillover-Effekte, Politische Handlungspotentiale.
Welche Methoden werden in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet eine Kombination aus Literaturrecherche, konzeptioneller Analyse des Begriffs "Knowledge City" und einem vergleichenden Fallstudiendesign anhand der Städte Jena und Frankfurt (Oder). Die Analyse basiert auf den Strategien der Städte im Kontext des Wettbewerbs "Stadt der Wissenschaft".
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit richtet sich an ein akademisches Publikum, das sich mit Stadtentwicklung, Wissensmanagement, Wissensgesellschaft und vergleichenden Stadtstudien beschäftigt.
Wo finde ich den vollständigen Text der Arbeit?
Der vollständige Text der Arbeit ist nicht in diesem FAQ enthalten. Dies ist lediglich eine Zusammenfassung.
- Citation du texte
- Yvonne Barta (Auteur), 2008, Knowledge City: Wissen - Wissen schafft Stadt - Wissenschaftsstadt schafft Wissen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/90298