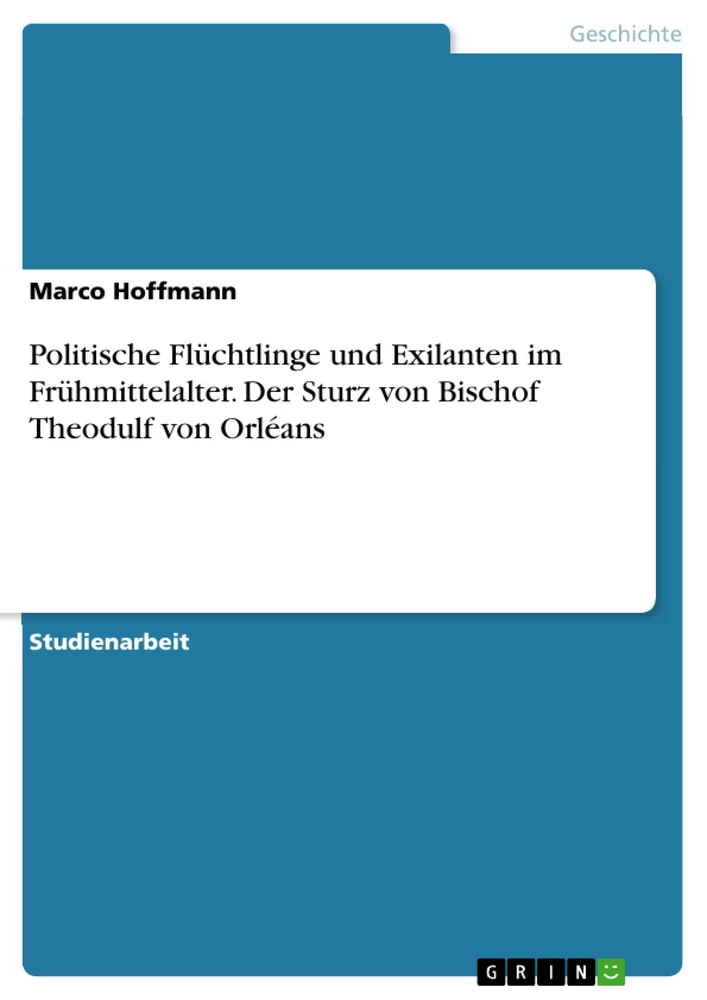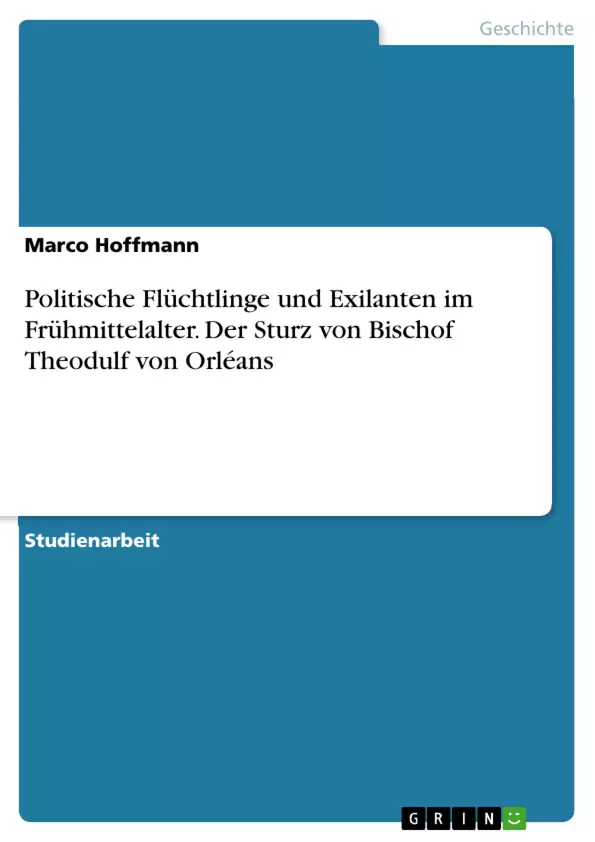Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Exilsituation des Bischofs Theodulf von Orléans im Frühmittelalter zu untersuchen und dabei insbesondere die Hintergründe, Gründe und Folgen seiner Verbannung am Hofe Karls des Großen zu beleuchten. Theodulf, ein Mitglied des Hofes Karls des Großen, sah sich nach einer einflussreichen Position in der Gunst des Herrschers schnell fallen und wurde in die Verbannung geschickt. Diese Arbeit widmet sich der Analyse seiner Exilsituation, seiner Selbstwahrnehmung und seinen schriftlichen Zeugnissen aus dieser Zeit.
Die Verbannung in der fränkischen Gesetzgebung wird im Kontext der damaligen Praxis der Exilierung betrachtet, um ein Verständnis für die Bedeutung und die Umstände von Theodulfs Verbanntwerden zu entwickeln. Dies ermöglicht es, den Sturz eines hochrangigen Hofbeamten und Bischofs im Frankenreich des 9. Jahrhunderts in einem breiteren historischen Kontext zu verstehen.
Ein besonderer Fokus liegt auf den Selbstzeugnissen Theodulfs, insbesondere seinen Briefgedichten, die während seiner Exilszeit in einem Kloster in Angers entstanden. Diese Texte bieten Einblicke in die Selbstwahrnehmung und den Umgang des Verbannten mit seinem Schicksal. Dabei wird analysiert, wie Theodulf auf die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen reagierte und wie er seine eigene Rolle in den politischen Geschehnissen interpretierte.
Die Forschungsarbeit beleuchtet auch die politischen und gesellschaftlichen Umstände am Hofe Karls des Großen, die zu Theodulfs Sturz führten, und untersucht, inwieweit persönliche Konflikte und politische Entwicklungen Einfluss auf seine Verbannung hatten.
Diese Studie zielt darauf ab, ein vertieftes Verständnis für die Praxis der Verbannung im Frühmittelalter zu schaffen und gleichzeitig die historische Bedeutung des Falls Theodulf von Orléans zu würdigen. Es bietet einen Einblick in die Exilsituation eines prominenten Bischofs und Hofbeamten und trägt zur breiteren Diskussion über Macht, Einfluss und Verbannung im Frankenreich des 9. Jahrhunderts bei.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Zur Person Theodulfs
- Theodulfs Herkunft
- Theodulf am Hofe Karls des Großen
- Theodulf als Bischof von Orléans
- Theodulfs Sturz
- Der Aufstand Bernhards von Italien
- Konsequenzen für Theodulf
- Theodulfs Verwicklung?
- Theodulf im Exil
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Praxis der Verbannung im frühmittelalterlichen Frankenreich anhand des Beispiels von Bischof Theodulf von Orléans. Im Fokus stehen die Gründe für seinen Sturz, die Folgen seiner Verbannung und die Analyse seiner Selbstzeugnisse aus der Exilzeit. Die Arbeit beleuchtet Theodulfs Rolle am Hof Karls des Großen, seine Beteiligung am Bilderstreit und seine literarische Tätigkeit.
- Die Praxis der Verbannung im Frankenreich
- Theodulfs Leben und Wirken am Hof Karls des Großen
- Die Gründe für Theodulfs Sturz und Verbannung
- Analyse von Theodulfs Selbstzeugnissen aus dem Exil
- Theodulfs Rolle im Bilderstreit
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung: Die Arbeit untersucht die Verbannung von Bischof Theodulf von Orléans im 9. Jahrhundert, indem sie seinen Fall als Beispiel für die damalige Praxis der Verbannung im Frankenreich nutzt. Die Selbstzeugnisse Theodulfs aus seiner Exilzeit, in Form von Briefgedichten, bieten einen einzigartigen Einblick in die Selbstwahrnehmung eines Exilanten und werden zentral analysiert. Der Fall Theodulfs ist besonders interessant, da er sowohl einflussreiches Mitglied des höfischen Beraterkreises als auch ein hoher Kleriker war.
Zur Person Theodulfs: Dieses Kapitel beleuchtet die Herkunft und den Werdegang Theodulfs. Seine westgotische Abstammung und seine mögliche Geburtsstätte in Nordspanien oder Septimanien werden diskutiert. Seine Karriere am Hof Karls des Großen wird beschrieben, wo er als Berater und Dichter fungierte und eine wichtige Rolle im Bilderstreit spielte. Seine literarische Tätigkeit, insbesondere seine Tierdichtungen, die versteckte Kritik und Ironie enthielten, wird ebenfalls untersucht.
Theodulfs Sturz: Dieses Kapitel behandelt den Sturz Theodulfs, der im Zusammenhang mit dem Aufstand Bernhards von Italien gegen Ludwig den Frommen stand. Die Konsequenzen dieses Aufstands für Theodulf werden untersucht, sowie die Frage nach seinem tatsächlichen Ausmaß der Beteiligung. Die Darstellung fokussiert die politischen und kirchlichen Aspekte seines Abstiegs.
Theodulf im Exil: Dieses Kapitel konzentriert sich auf Theodulfs Exilzeit in Angers, mit besonderem Fokus auf die Analyse seiner aus dieser Zeit stammenden Selbstzeugnisse. Diese literarischen Werke geben detaillierte Einblicke in seine Emotionen, seine Rechtfertigung und seinen Umgang mit dem Schicksal der Verbannung. Das Kapitel untersucht die Bedeutung dieser Selbstzeugnisse für das Verständnis des Frühmittelalters.
Schlüsselwörter
Theodulf von Orléans, Verbannung, Exil, Frühmittelalter, Frankenreich, Karl der Große, Ludwig der Fromme, Bilderstreit, Libri Carolini, Hofpoesie, Westgoten, Selbstzeugnisse, Briefgedichte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Theodulf von Orléans - Verbannung und Exil im Frühmittelalter
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Verbannung des Bischofs Theodulf von Orléans im 9. Jahrhundert als Beispiel für die Praxis der Verbannung im frühmittelalterlichen Frankenreich. Im Mittelpunkt stehen die Gründe für seinen Sturz, die Folgen seiner Verbannung und die Analyse seiner literarischen Selbstzeugnisse aus der Exilzeit.
Wer war Theodulf von Orléans?
Theodulf von Orléans war ein einflussreicher Bischof und Mitglied des Hofkreises Karls des Großen. Er stammte möglicherweise aus Westgothen und wirkte als Berater, Dichter und spielte eine Rolle im Bilderstreit. Seine literarische Tätigkeit, insbesondere seine Tierdichtungen, wird als versteckte Kritik interpretiert.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Praxis der Verbannung im Frankenreich, Theodulfs Leben und Wirken am Hof Karls des Großen, die Gründe für seinen Sturz und seine Verbannung, die Analyse seiner Selbstzeugnisse aus dem Exil, sowie seine Rolle im Bilderstreit.
Warum wurde Theodulf verbannt?
Theodulfs Sturz steht im Zusammenhang mit dem Aufstand Bernhards von Italien gegen Ludwig den Frommen. Die Arbeit untersucht die Konsequenzen dieses Aufstands für Theodulf und die Frage nach seinem tatsächlichen Ausmaß der Beteiligung an diesem Aufstand. Die politischen und kirchlichen Aspekte seines Abstiegs werden beleuchtet.
Welche Quellen werden verwendet?
Zentral sind Theodulfs eigene Selbstzeugnisse aus seiner Exilzeit in Angers, hauptsächlich in Form von Briefgedichten. Diese bieten einen einzigartigen Einblick in seine Selbstwahrnehmung und seinen Umgang mit der Verbannung.
Was ist die Bedeutung der Selbstzeugnisse Theodulfs?
Die Selbstzeugnisse Theodulfs aus dem Exil liefern detaillierte Einblicke in seine Emotionen, seine Rechtfertigung und sein Verständnis seines Schicksals. Sie sind wichtige Quellen für das Verständnis des Frühmittelalters und der Mentalität eines Exilanten.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einführung, ein Kapitel zu Theodulfs Person, ein Kapitel zu seinem Sturz, ein Kapitel zu seiner Exilzeit und ein Fazit. Jedes Kapitel untersucht spezifische Aspekte von Theodulfs Leben und seiner Verbannung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Theodulf von Orléans, Verbannung, Exil, Frühmittelalter, Frankenreich, Karl der Große, Ludwig der Fromme, Bilderstreit, Libri Carolini, Hofpoesie, Westgoten, Selbstzeugnisse, Briefgedichte.
- Quote paper
- Marco Hoffmann (Author), 2017, Politische Flüchtlinge und Exilanten im Frühmittelalter. Der Sturz von Bischof Theodulf von Orléans, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/903346