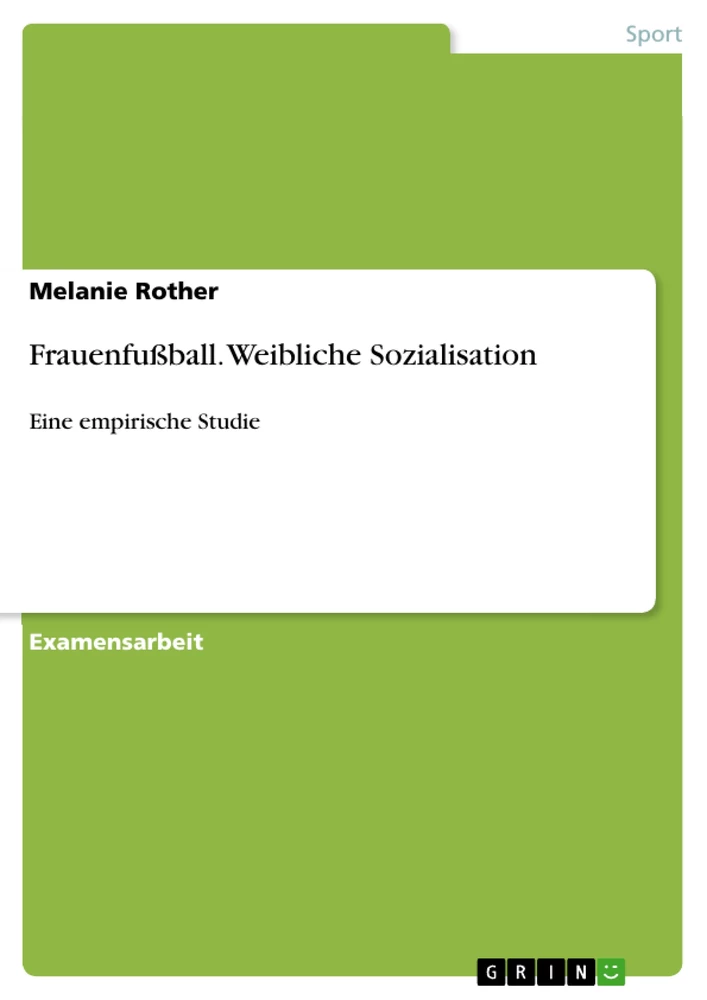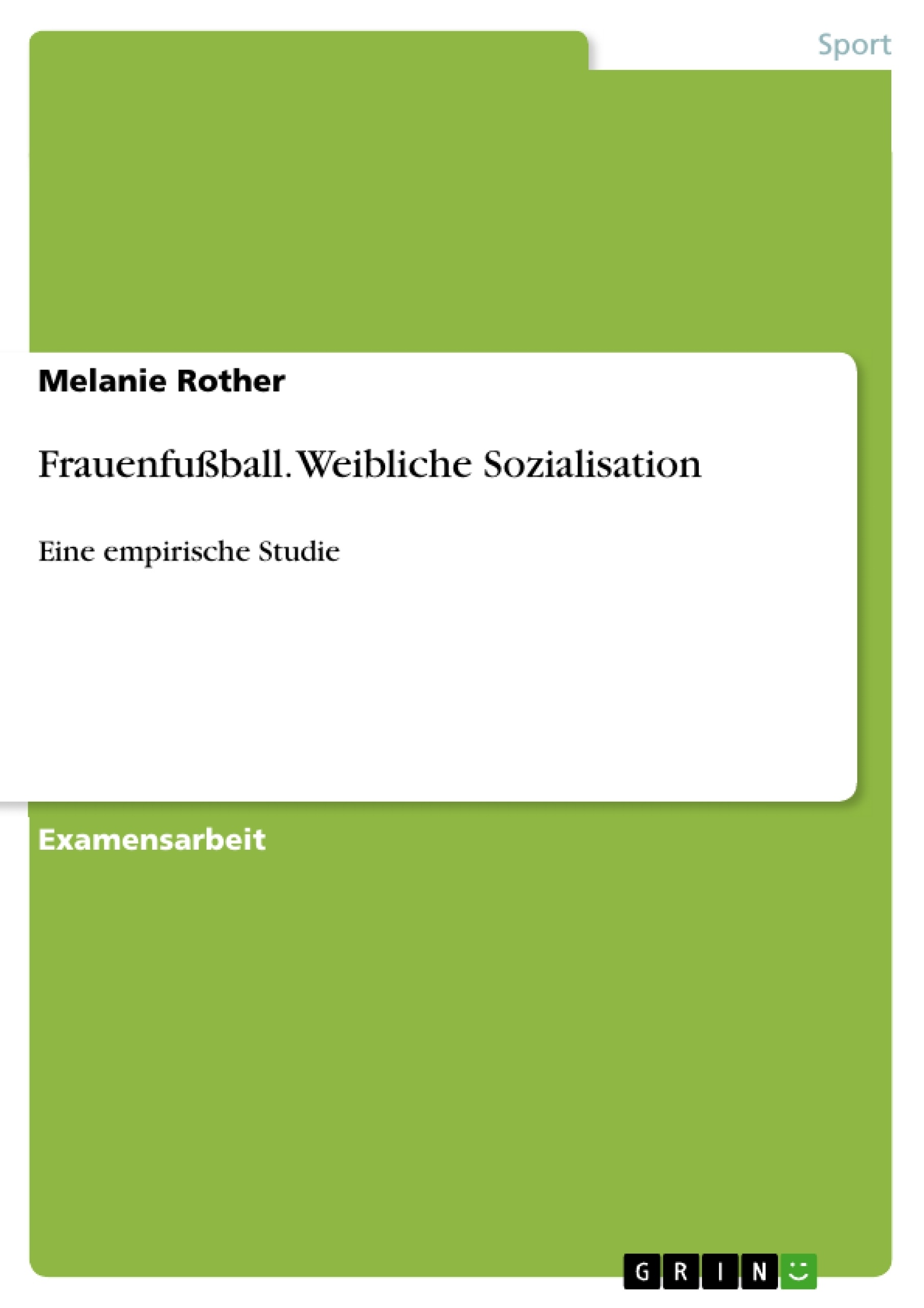Frauenfußball ist eine sehr junge Sportart, die praktisch noch in den Kinderschuhen steckt. Seit 1970 erst ist es auch Mädchen und Frauen in Deutschland erlaubt diesen Sport auszuüben. Es gab zwar vorher schon Bemühungen seitens der Frauen Fußball zu spielen, jedoch wurde dies durch die Verbände, allen voran dem DFB, verboten. Fußball war also eine sehr lange Zeit nur Männern vorbehalten. Bis der Frauenfußball wie heute zu Normalität wurde, mußten einige Barrieren gebrochen werden.
Viele Frauen wurden für ihre Leidenschaft zum Fußball belächelt oder gar beschimpft. Dies ist zum Teil heute noch so, was die Vorurteile über Fußballerinnen klar erkennen lassen. Aber warum drängen Frauen in diese Sportart? Wieso lassen sie Beleidigungen über sich ergehen, um dem runden Leder nachzujagen? Mit welchen Problemen werden sie konfrontiert? Stimmt es, daß Fußballerinnen eine männliche Ausstrahlung haben und viele von ihnen homosexuell veranlagt sind? Dies sind Fragen, die diese Arbeit versucht zu durchleuchten.
Der Männerfußball, einst Elitesport, wandelte sich im Lauf der Jahre zum Massensport. Heute wird er vornehmlich von Mitgliedern der unteren Mittel- und Unterschicht ausgeübt (Heinemann, 1998, S. 201). Über die Schichtenzugehörigkeit von Fußballerinnen sind bisher noch keine empirischen Untersuchungen durchgeführt worden. Diese Staatsexamensarbeit geht auch der Frage nach der sozialen Herkunft der fußballspielenden Frauen auf den Grund.
Um die oben genannten Fragen zu analysieren, wurde ein Fragebogen speziell für Fußballerinnen entwickelt. Dieser wurde in drei thematische Blöcke unterteilt. Der erste Teil fragt nach der Kinder- und Jugendzeit der Sportlerin, der zweite Teil befaßt sich mit der Zeit als Seniorin und in einem dritten Teil sollen demographische Fragen beantwortet werden. Die Auswertung dieses Fragebogens wird den größten Teil der Arbeit darstellen.
Doch bevor die empirische Studie dargelegt wird, sind einige Grundlagen zu erläutern. Zum einen die Sozialisation von Frauen im Sport, zum anderen die Geschichte des Frauenfußballs und dessen Organisation. Leider ist das Thema „Frau und Sport“ in der Literatur noch längst nicht ausreichend durchleuchtet worden. Auch zum „Frauenfußball“ findet man nicht besonders viele Autoren, die sich diesem Thema annehmen.
Nach den Grundlagen wird der Kern der Arbeit, die explorative Studie zum Frauenfußball, dargestellt und diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- THEORETISCHER BEZUGSRAHMEN
- Geschlechtsspezifische Sozialisation
- Zum Begriff der Sozialisation
- Geschlechtsspezifische Sozialisation - Entwicklung und Stand der Forschung
- Zum Zusammenhang von weiblicher Sozialisation und Sport
- Entwicklung des Frauenfußballs
- Organisation des Frauenfußballs
- Geschlechtsspezifische Sozialisation
- DARSTELLUNG DER EMPIRISCHEN UNTERSUCHUNG
- Fragestellungen
- Untersuchungsmethodik
- Personenstichprobe
- Ablauf der Untersuchung
- ERGEBNISSE
- Kindheit und Jugend der Fußballerinnen
- Fußballspielen außerhalb von Vereinen
- Mädchenfußball im Verein
- Die Fußballzeit in Frauenmannschaften
- Die fußballerische Laufbahn der Spielerinnen
- Der Verein
- Der Trainings- und Spielalltag
- Mannschaft und Trainer/Trainerin
- Engagement über die eigene Sporttreiben hinaus
- Motive für das Fußballspielen
- Familie, Freunde und Bekannte
- Freizeitbeschäftigungen außer Fußball
- Medien
- Frauenfußball und seine Vorurteile
- Kindheit und Jugend der Fußballerinnen
- ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der weiblichen Sozialisation im Kontext des Frauenfußballs. Sie untersucht die Entwicklung von Mädchen und Frauen im Fußball, die Rolle von Familie, Verein und Medien sowie die besonderen Herausforderungen und Vorurteile, denen Frauen im Sport begegnen. Die Studie analysiert die Motive und Erfahrungen von Fußballerinnen und betrachtet die spezifischen Einflussfaktoren auf ihre sportliche Laufbahn.
- Weibliche Sozialisation und ihre Auswirkungen auf die Teilnahme am Sport
- Entwicklung und Organisation des Frauenfußballs
- Motive und Erfahrungen von Fußballerinnen
- Vorurteile und Herausforderungen im Frauenfußball
- Die Rolle von Familie, Verein und Medien im Frauenfußball
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik der weiblichen Sozialisation im Frauenfußball vor und erläutert die Relevanz der Forschungsarbeit. Der theoretische Bezugsrahmen behandelt die geschlechtsspezifische Sozialisation, die Entwicklung des Frauenfußballs und die Organisationsstrukturen. Die empirische Untersuchung stellt die Fragestellungen und die Methodik der Studie vor, die sich auf eine Befragung von Fußballerinnen konzentriert. Die Ergebnisse analysieren die Kindheit und Jugend der Fußballerinnen, die Zeit in Frauenmannschaften und die Erfahrungen mit Vorurteilen. Die Zusammenfassung und der Ausblick fassen die zentralen Erkenntnisse der Arbeit zusammen und geben einen Ausblick auf zukünftige Forschungsmöglichkeiten.
Schlüsselwörter
Frauenfußball, weibliche Sozialisation, Sport, Geschlechtsspezifische Sozialisation, Vorurteile, Motivation, Familie, Verein, Medien, empirische Untersuchung, Befragung
Häufig gestellte Fragen
Seit wann ist Frauenfußball in Deutschland offiziell erlaubt?
Erst seit 1970 hob der DFB das offizielle Verbot für Frauenfußball auf, nachdem der Sport zuvor lange Zeit nur Männern vorbehalten war.
Mit welchen Vorurteilen haben Fußballerinnen zu kämpfen?
Die Arbeit untersucht gängige Klischees, wie die angebliche „männliche Ausstrahlung“ oder Vorurteile bezüglich der sexuellen Orientierung von Spielerinnen.
Welche Rolle spielt die soziale Herkunft im Frauenfußball?
Die empirische Studie geht der Frage nach, aus welchen gesellschaftlichen Schichten fußballspielende Frauen stammen, da hierzu bislang wenig Daten vorlagen.
Wie beeinflusst die Sozialisation die Teilnahme von Frauen am Sport?
Es wird analysiert, wie geschlechtsspezifische Erziehung und Rollenbilder den Zugang von Mädchen zum Fußballverein und ihre sportliche Laufbahn prägen.
Was sind die Hauptmotive für Frauen, Fußball zu spielen?
Die Arbeit beleuchtet durch eine Befragung die persönlichen Motive, den Trainingsalltag und die Bedeutung von Mannschaft und Trainern für die Spielerinnen.
- Arbeit zitieren
- Melanie Rother (Autor:in), 2004, Frauenfußball. Weibliche Sozialisation, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/90350