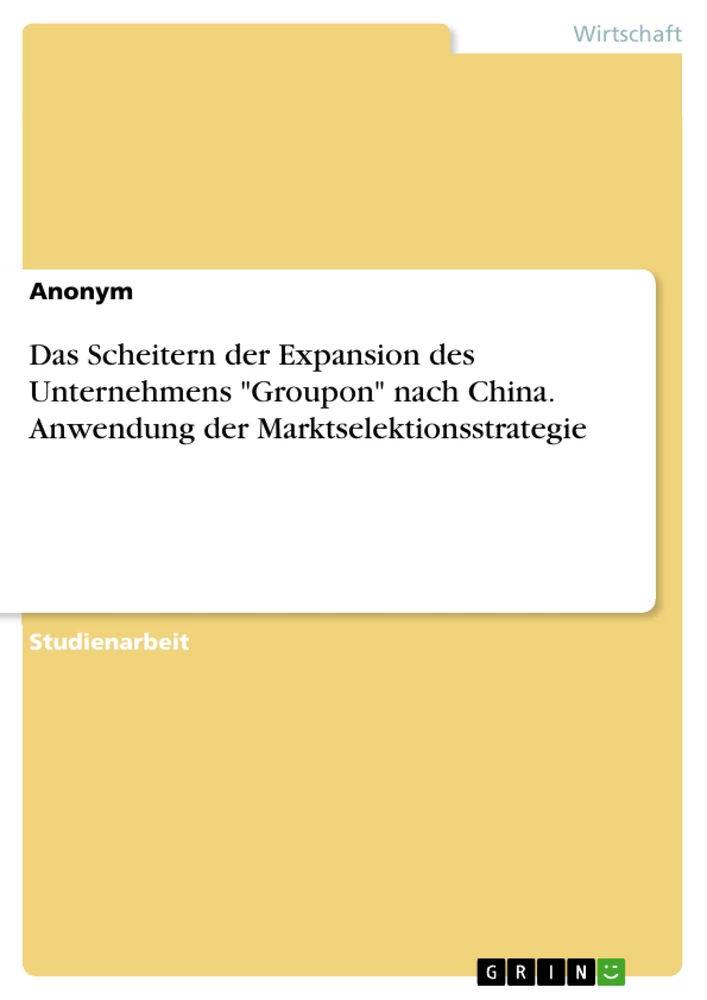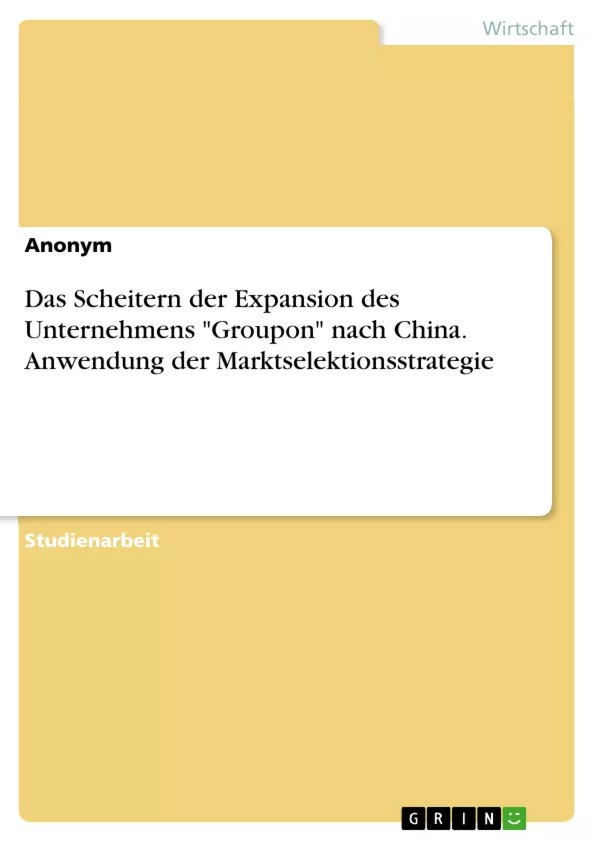Ziel der Arbeit ist es, die theoretischen Grundlagen und Methoden zum Thema Marktselektionsstrategien im internationalen Markteintritt zu erläutern und den Markteintritt des Unternehmens Groupon in China hinsichtlich dieser zu analysieren. Diese Ausarbeitung richtet sich an Praktiker, die sich über Marktselektionsstrategien und über die praxisnahe Anwendung der verwendeten Methoden näher informieren wollen. In diesem Zuge werden Aspekte der Product Readiness betrachtet.
Die Leitfrage der Arbeit lautet: "Weshalb scheiterte Groupon in China?" Des Weiteren soll der Frage: "Sind Analysen zur Marktselektion ein sinnvolles Instrument zur Ermittlung der Attraktivität und des Risikos eines Zielmarktes?" nachgegangen werden.
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel. Zu Beginn erläutert Kapitel 1 die Problemstellung, beschreibt die Zielsetzung und geht auf die zugrunde liegenden Vorgehensweisen ein. Darauf aufbauend werden im zweiten Kapitel theoretische Grundlagen über die Marktselektionsstrategien erläutert. Es werden Methoden zur Feststellung der Marktattraktivität, Marktrisiken sowie Markteintrittsbarrieren definiert. Darüber hinaus wird die Relevanz des Themas in verschiedenen Studien dargestellt. In diesem Kontext wird ein Einblick gegeben weshalb der Markteintritt von Groupon scheiterte. In Kapitel drei wird das Unternehmen Groupon hinsichtlich der Expansion in China vorgestellt. Kapitel 4 nimmt Bezug auf die in Kapitel 2 dargestellten Methoden, indem der Markteintritt analysiert wird. In Kapitel 5 wird ein Fazit gezogen und ein Aus- blick gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Zielsetzung und Forschungsfragen
- Vorgehensweise
- Literaturüberblick
- Definition
- Marktselektionsstrategien
- Marktattraktivität
- Marktrisiken
- Markteintrittsbarrieren
- Relevante Studien
- Competitive dynamics between multinational enterprises and local internet platform companies in the virtual market in China
- Groupon's Growth And Globalization Strategy: Structural And Technological Implications Of International Markets
- Fallbeschreibung
- Analyse: Markteintritt Groupon in China
- Marktattraktivität
- Marktrisiken
- Markteintrittsbarrieren
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit befasst sich mit der Marktselektionsstrategie des Unternehmens Groupon im Kontext seiner Expansion nach China. Das Ziel ist es, die theoretischen Grundlagen und Methoden zur Marktselektionsstrategie im internationalen Markteintritt zu erläutern und die Expansion von Groupon nach China unter dieser Perspektive zu analysieren. Die Arbeit richtet sich an Praktiker, die sich für Marktselektionsstrategien und deren praktische Anwendung interessieren.
- Marktselektionsstrategien
- Marktattraktivität
- Marktrisiken
- Markteintrittsbarrieren
- Expansion des Unternehmens Groupon nach China
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Dieses Kapitel stellt die Problemstellung der Studienarbeit vor, erläutert die Zielsetzung und die Vorgehensweise. Die zunehmende Internationalisierung und Globalisierung der Unternehmenstätigkeit führt zu einer wachsenden Bedeutung des internationalen Marketings, insbesondere bei der Expansion von Unternehmen in neue Märkte. Die Studienarbeit konzentriert sich auf die Expansion des amerikanischen E-Commerce Unternehmens Groupon nach China und untersucht die Faktoren, die zu dessen Scheitern geführt haben.
- Literaturüberblick: Dieses Kapitel definiert und erläutert verschiedene Konzepte, die für die Marktselektionsstrategie relevant sind, darunter Marktattraktivität, Marktrisiken und Markteintrittsbarrieren. Es werden verschiedene Studien vorgestellt, die die Expansion von Groupon nach China aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten.
- Fallbeschreibung: Dieses Kapitel stellt das Unternehmen Groupon und seine Expansion nach China im Detail vor. Es beleuchtet die Besonderheiten des chinesischen Marktes und die Herausforderungen, denen Groupon bei seiner Expansion begegnet ist.
- Analyse: Markteintritt Groupon in China: Dieses Kapitel analysiert den Markteintritt von Groupon in China anhand der in Kapitel 2 vorgestellten Methoden. Es betrachtet die Marktattraktivität, die Marktrisiken und die Markteintrittsbarrieren, denen Groupon in China begegnet ist.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Studienarbeit sind: Marktselektionsstrategie, internationale Expansion, Marktattraktivität, Marktrisiken, Markteintrittsbarrieren, China, Groupon, E-Commerce, Fallstudie.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Groupon beim Markteintritt in China gescheitert?
Ursachen waren unter anderem unterschätzte Markteintrittsbarrieren, starke lokale Konkurrenz und mangelnde Anpassung an den virtuellen Markt in China.
Was versteht man unter einer Marktselektionsstrategie?
Methoden zur Auswahl attraktiver Zielmärkte durch Analyse von Marktattraktivität, Risiken und Barrieren.
Sind Marktanalysen ein sinnvolles Instrument für Unternehmen?
Ja, die Arbeit zeigt, dass fundierte Analysen das Risiko eines Scheiterns minimieren können, sofern sie praxisnah angewendet werden.
Was ist "Product Readiness"?
Es bezeichnet den Grad, zu dem ein Produkt für einen spezifischen Zielmarkt (hier China) angepasst und bereit für den Verkauf ist.
Welche Rolle spielten lokale Internetplattformen in China?
Die Wettbewerbsdynamik zwischen multinationalen Unternehmen und lokalen Anbietern war ein entscheidender Faktor für Groupons Misserfolg.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2019, Das Scheitern der Expansion des Unternehmens "Groupon" nach China. Anwendung der Marktselektionsstrategie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/903832