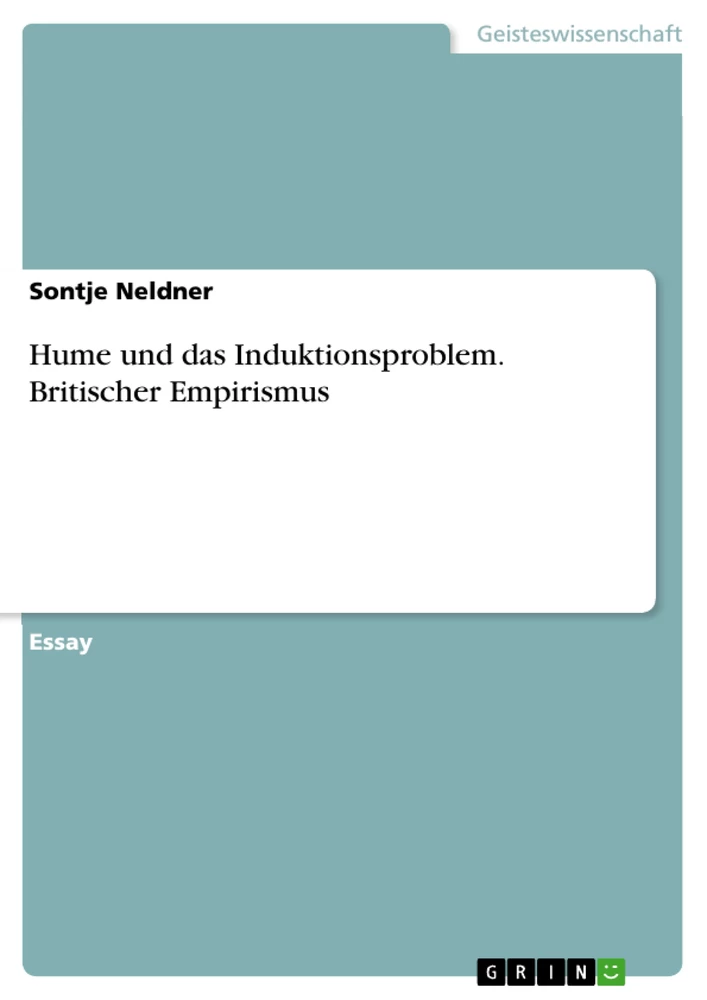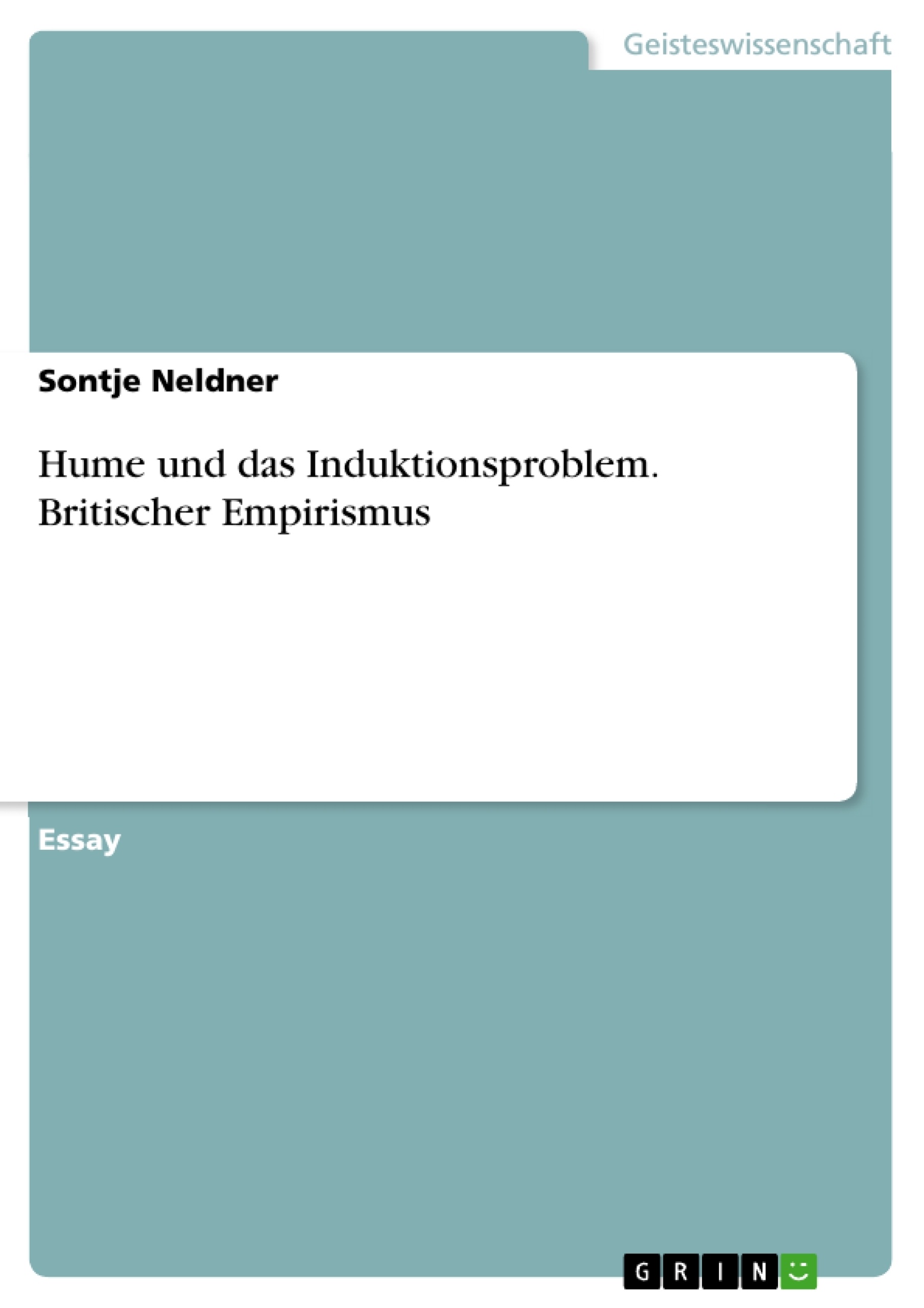Der schottische Philosoph David Hume ist ebenso wie Berkeley und Locke ein britischer Empirist gewesen und gilt als bedeutungsvoller Aufklärer seiner Zeit. Im Laufe seines Lebens hat er sich unter anderem mit der Metaphysik beschäftigt. Im Folgenden werden seine Thesen über den Zusammenhang zwischen dem Verstand und den menschlichen Annahmen über ihre Umwelt dargelegt. Ausgangspunkt ist hierbei die Fragestellung, worin unsere Annahmen über unsere Umwelt begründet seien. Außerdem wird besonders auf das daraus resultierende Induktionsproblem eingegangen. Darüber hinaus wird erläutert, welche Konsequenz Hume aus diesem Problem zieht. Als Grundlage hierfür dient Humes Werk An Enquiry concerning Human Understanding. Zunächst werde ich allerdings mit seinem Verständnis von Ideen und ihrer Assoziation beginnen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ideen und ihre Assoziation
- Der Ursprung von Ideen
- Die Assoziation der Ideen
- Skeptische Bedenken über die Wirksamkeit des Verstandes
- Annahmen und Erfahrungen
- Das Induktionsproblem
- Die Konsequenz aus dem Induktionsproblem
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Ziel dieser Arbeit ist es, die philosophischen Thesen von David Hume über den Zusammenhang zwischen Verstand und menschlichen Annahmen über die Umwelt zu untersuchen. Dabei steht insbesondere das Induktionsproblem im Vordergrund, das Hume aus dieser Verbindung ableitet. Die Arbeit basiert auf Humes Werk "An Enquiry concerning Human Understanding".
- Der Ursprung von Ideen: Humes Theorie, dass alle Ideen aus Sinneswahrnehmungen, Erinnerung und Einbildungskraft hervorgehen.
- Assoziation von Ideen: Humes drei Prinzipien der Ähnlichkeit, Angrenzung und Kausalität, die die Verknüpfung von Ideen erklären.
- Das Induktionsproblem: Die Frage, wie man von vergangenen Erfahrungen auf zukünftige Ereignisse schließen kann, da die Kausalität nicht logisch begründbar ist.
- Skeptische Bedenken: Humes Zweifel an der Wirksamkeit des Verstandes, insbesondere in Bezug auf die Gültigkeit von Annahmen über die Welt.
- Die Konsequenz aus dem Induktionsproblem: Die Einführung des Begriffs der "wahrscheinlichen Tatsachen" als Grundlage für menschliches Wissen.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt David Hume als wichtigen britischen Empiristen und Aufklärer vor. Sie beschreibt das Ziel der Arbeit: Humes Thesen über den Zusammenhang zwischen Verstand und menschlichen Annahmen über die Umwelt zu untersuchen, wobei das Induktionsproblem im Fokus steht.
Ideen und ihre Assoziation
Der Ursprung von Ideen
Hume behauptet, dass alle Ideen aus Sinneswahrnehmungen, Erinnerung und Einbildungskraft entspringen. Sinneswahrnehmungen sind dabei die Grundlage für Erinnerungen und Einbildungen. Die letzteren sind Kopien der ersten und weniger lebhaft. Allerdings können geisteskranke Personen Erinnerungen und Einbildungen ähnlich lebhaft wie Sinneswahrnehmungen erleben.
Die Assoziation der Ideen
Hume stellt drei Prinzipien der Assoziation von Ideen fest: Ähnlichkeit, Angrenzung und Kausalität. Ähnlichkeit bedeutet, dass sich Ideen von ähnlichen Dingen assoziieren, wie zum Beispiel ein Foto und die Landschaft, die es zeigt. Angrenzung bezieht sich auf den Zusammenhang zwischen einer Idee und ihrem Kontext, wie zum Beispiel ein Zimmer und das Haus, in dem es sich befindet. Kausalität beschreibt die Verbindung zwischen Ursache und Wirkung, wie zum Beispiel eine Wunde und der damit verbundene Schmerz.
Skeptische Bedenken über die Wirksamkeit des Verstandes
Annahmen und Erfahrungen
Hume teilt Annahmen in zwei Gruppen ein: Relationen zwischen Ideen und Tatsachen. Relationen sind durch logische Schlussfolgerungen begründbar, wie zum Beispiel mathematische Aussagen. Tatsachen hingegen basieren auf wiederholten Beobachtungen und sind nicht logisch begründbar. Das Gegenteil einer Tatsache ist denkbar, aber nicht belegbar.
Das Induktionsproblem
Humes Frage, wie man von vergangenen Erfahrungen auf zukünftige Ereignisse schließen kann, führt zum Induktionsproblem. Die Annahme, dass die Sonne morgen aufgehen wird, basiert auf der Erfahrung, dass sie bisher jeden Tag aufgegangen ist. Es fehlt jedoch der Beweis, dass diese Kausalität eine Gesetzmäßigkeit darstellt.
Die Konsequenz aus dem Induktionsproblem
Hume kommt zu dem Schluss, dass der Verstand das Induktionsproblem nicht lösen kann. Er stellt fest, dass alle Annahmen, auch die über Relationen von Ideen, auf Erfahrungen basieren und somit unbeständig sind. Dies führt ihn dazu, die Gruppe der Tatsachen in die Gruppe der wahrscheinlichen Tatsachen umzuwandeln, da die Zukunft nicht mit Sicherheit aus der Vergangenheit abgeleitet werden kann.
Schlüsselwörter
David Hume, Empirismus, Induktionsproblem, Kausalität, Annahmen, Erfahrungen, Verstand, Skepsis, wahrscheinliche Tatsachen, Ideen, Assoziation, Sinneswahrnehmungen, Einbildungskraft.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Induktionsproblem nach David Hume?
Das Problem beschreibt die Unmöglichkeit, logisch zu beweisen, dass zukünftige Ereignisse notwendigerweise so eintreten wie vergangene Erfahrungen (z.B. dass die Sonne morgen aufgeht).
Woher stammen laut Hume unsere Ideen?
Alle Ideen sind Kopien von vorhergegangenen Sinneswahrnehmungen (Impressions), die durch Erinnerung oder Einbildungskraft verarbeitet werden.
Welche drei Prinzipien der Ideenassoziation nennt Hume?
Hume nennt Ähnlichkeit, räumliche/zeitliche Angrenzung und Kausalität (Ursache und Wirkung) als Mechanismen, wie unser Verstand Ideen verknüpft.
Wie unterscheidet Hume zwischen Relationen und Tatsachen?
Relationen (z.B. Mathematik) sind rein durch Denken gewiss, während Tatsachen (Matters of Fact) auf Erfahrung beruhen und deren Gegenteil immer denkbar bleibt.
Warum ist Kausalität für Hume problematisch?
Weil wir nur die Abfolge von Ereignissen beobachten, aber nie die notwendige Verknüpfung (die „Kraft“) zwischen Ursache und Wirkung selbst wahrnehmen können.
Was ist die Konsequenz aus Humes Skeptizismus?
Er führt den Begriff der „wahrscheinlichen Tatsachen“ ein; wir handeln im Alltag nach Gewohnheit, auch wenn wir keine letzte rationale Gewissheit haben.
- Quote paper
- Sontje Neldner (Author), 2016, Hume und das Induktionsproblem. Britischer Empirismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/903850